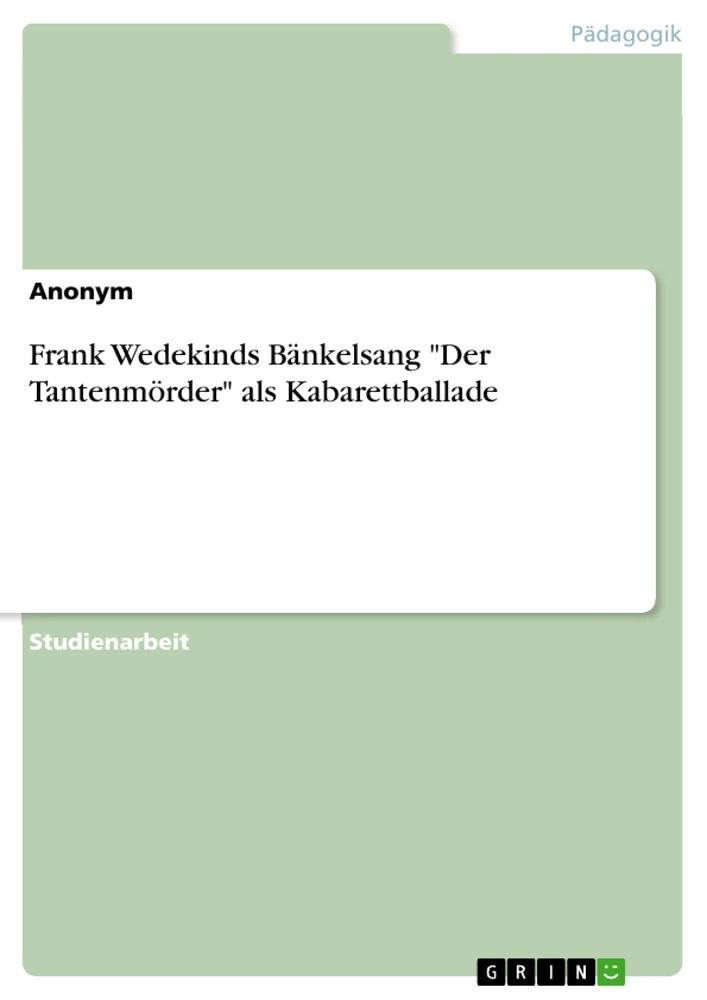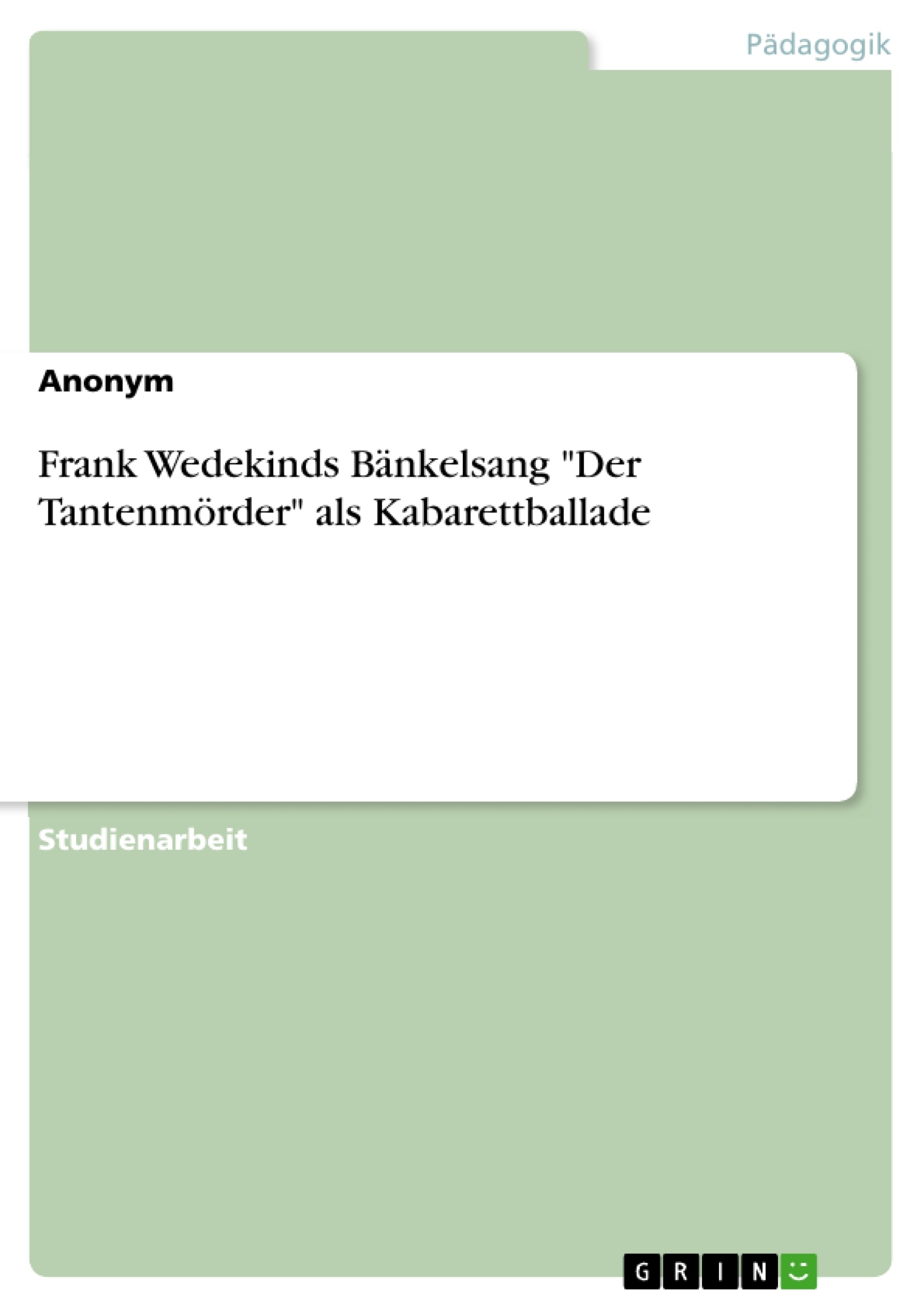In dieser Arbeit wird der historische Bänkelsang erläutert, dem die Ballade "Der Tantenmörder" zugrunde liegt. Weitergehend wird der Weg oder die Beweggründe Wedekinds beschrieben, seine Ballade "Der Tantenmörder" als Kabarettballade untersucht. Außerdem werden Interpretationsansätze zur Ballade wiedergegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der historische Bänkelsang
- Wedekinds Weg zum Kabarett
- Der Tantenmörder als Kabarettballade
- Interpretationsansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Frank Wedekinds „Der Tantenmörder“ als Beispiel für die Transformation des traditionellen Bänkelsangs zur Kabarettballade. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung des Bänkelsangs, Wedekinds Beweggründen für die Kabarettrezeption seiner Ballade und der Interpretation dieser außergewöhnlichen Form der literarischen Präsentation.
- Der historische Bänkelsang als vielschichtiges Phänomen aus Text, Bild und Ton.
- Frank Wedekinds künstlerische Entwicklung und sein Weg zur Kabarettbühne.
- „Der Tantenmörder“ als Kabarettballade und dessen spezifische Merkmale.
- Interpretationsansätze zur literarischen Bedeutung und Wirkung von Wedekinds Werk.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Frank Wedekind als einen vielseitigen Künstler vor und führt die Thematik der Arbeit ein, indem sie „Der Tantenmörder“ als Kabarettballade in den Mittelpunkt stellt. Das zweite Kapitel widmet sich dem historischen Bänkelsang und analysiert dessen Komponenten, Funktionen und Entwicklungen. Das dritte Kapitel beschreibt den Weg Wedekinds zum Kabarett und skizziert die Einflüsse, die seine künstlerische Entwicklung prägten.
Schlüsselwörter
Frank Wedekind, Bänkelsang, Kabarett, „Der Tantenmörder“, satirische Moritat, Kabarettballade, Interpretation, literarische Wirkung, Präsentation, Medien, Simplicissmus, „Elf Scharfrichter“.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Frank Wedekinds Bänkelsang "Der Tantenmörder" als Kabarettballade, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149285