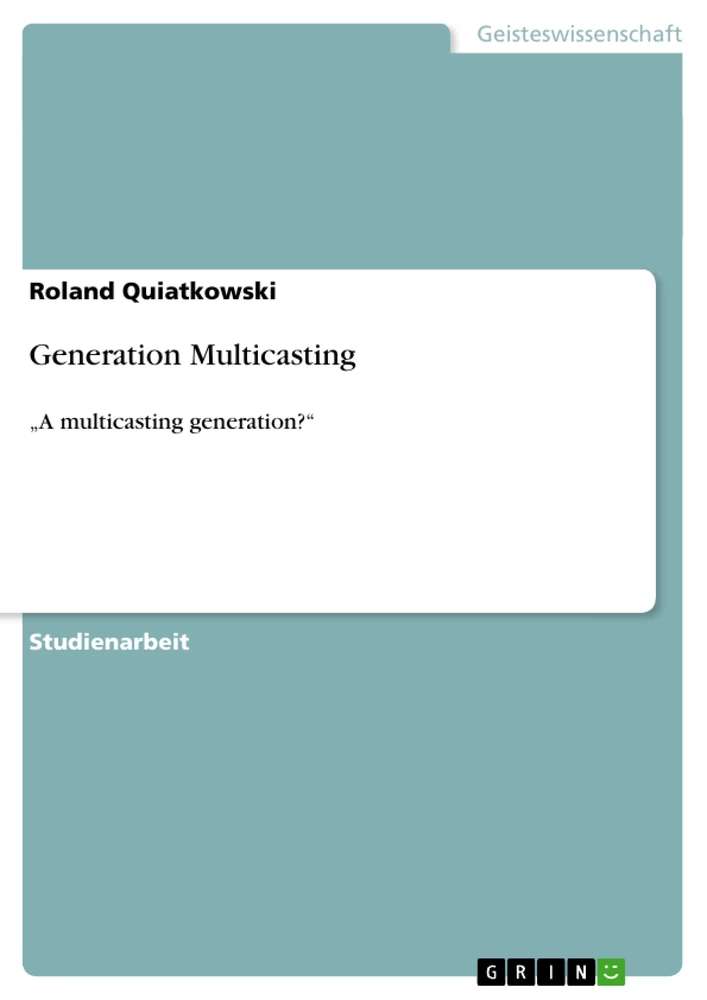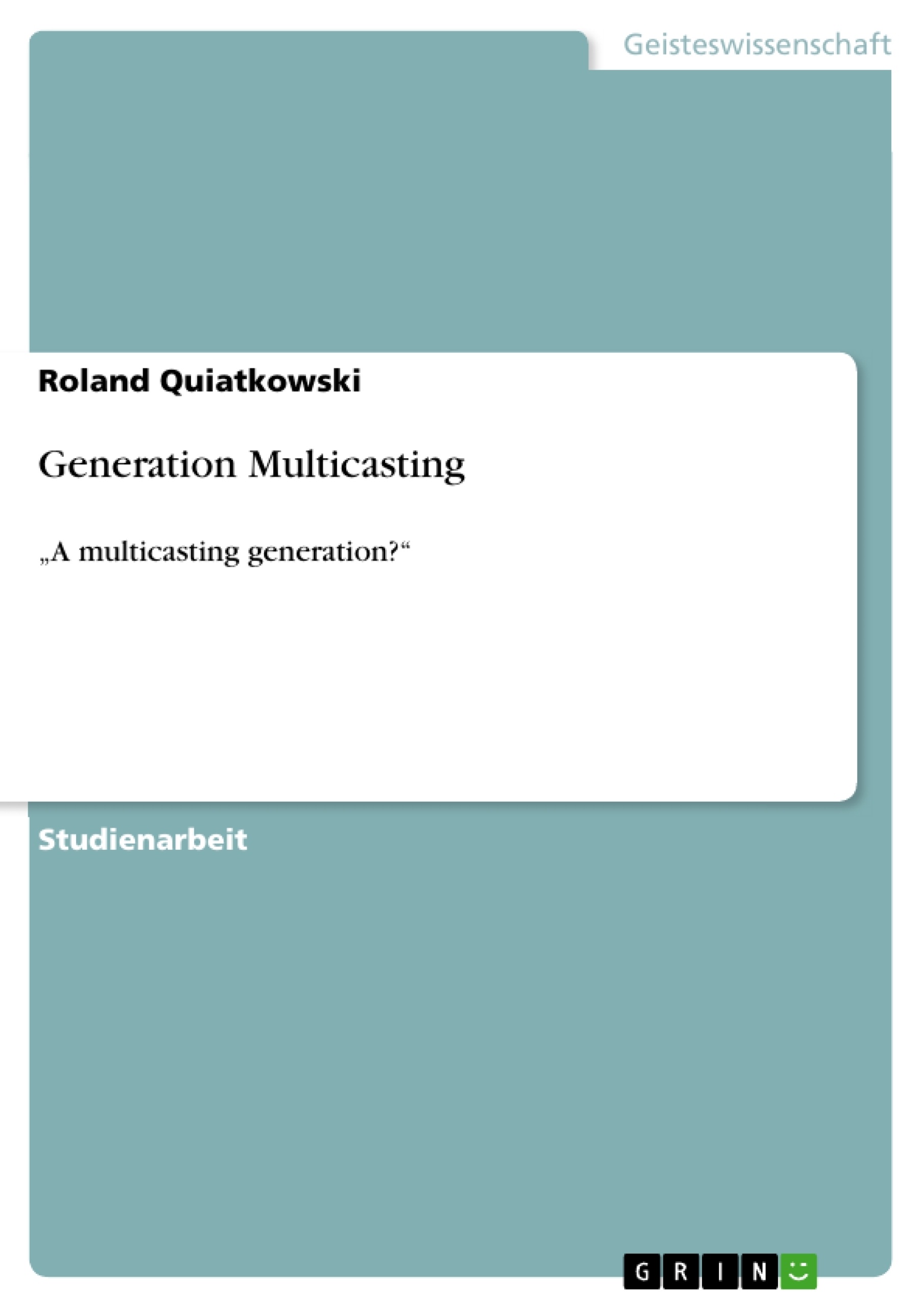Wohl spätestens seit Goethes „Leiden des jungen Werther“ steht die Medienrezeption von Jugendlichen scheinbar permanent zur Diskussion. War zu Zeiten des Sturm und Drang Annahme, ein Buch, welches einen Suizid mit Zufriedenheit und Hoffnung verbinde, sei in der Lage Jugendliche eben zum Selbstmord zu bewegen , so ist die heutige Situation fast nicht davon zu unterscheiden.
Im Jahr 2008 wird immer noch davon ausgegangen, dass abstraktes Töten, so es mit Punktgewinn und Spaß in Verbindung gebracht wird, die Betrachtung von Filmen mit Gewaltszenen oder pornographische Liedtexte in Popsongs Menschen zur Nachahmung der damit vermittelten Inhalte verleiten können. Aber schon mit Goethe selbst hätte die darum entbrannte Diskussion, wenn auch zynisch so doch einfach und klar, als beendet erklärt werden können. Er schrieb:
„Und nun wollt Ihr einen Schriftsteller zur Rechenschaft ziehen und ein Werk verdammen, das, durch einige beschränkte Geister falsch aufgefasst, die Welt höchstens von einem Dutzend Dummköpfen und Taugenichtsen befreit hat, die gar nichts besseres tun konnten, als den schwachen Rest ihres bisschen Lichtes vollends auszublasen.“
Der Jugendliche wird also schon lange als der sprichwörtlich als Affe geltende Nachahmer bezeichnet, der oft mit Inhalten konfrontiert wird, die er nicht versteht. Und er wird eingeschätzt, als würde er aufgrund einer Art klassischen Konditionierung über Belohnungsmechanismen dazu angetrieben, Handlungen zu vollziehen, derer Auswirkungen er sich, so macht es jedenfalls den Eindruck, nicht bewusst sein kann. Es scheint also, als gäbe es in Bezug auf heutige und damalige „Unterhaltungsindustrie“ eine grundsätzlich pessimistische Einstellung gegenüber Jugendlichen. Diesen wurde und wird immer noch qua Mangel an Erfahrungen eine Unfähigkeit nachgesagt, die Effekte menschlichen Tätigwerdens zur Genüge abschätzen zu können.
Diese Fähigkeit, egal ob sie vorhanden ist oder nicht, liegt aber nicht im Fokus des folgenden Aufsatzes. Vielmehr soll der Unterschied betont werden, dass zu Zeiten Goethes die Wahrnehmung von als problematisch geltenden Medieninhalten im Vergleich zu heute auf einzelne aufeinander folgende Wahrnehmungen limitiert war. Dieser überaus wichtige Unterschied soll die Annahme einer grundsätzlichen emotionalen und intellektuellen Abstumpfung von Jugendlichen beleuchten helfen. Dazu wird vorausgesetzt, bis ins späte 20. Jahrhundert stand der Empfänger von Medien stets vor der Wahl, ob er sich auf ein Buch oder ein Theaterstück oder ein Gesellschaftsspiel oder auf die Tageszeitung und so fort einließ. Und selbst als sich zu Zeitungen und Büchern Radios sowie kurze Zeit später auch Fernseher hinzugesellten, bestand sicher oft der Zwang, sich auf eines dieser Geräte zu bestimmten Zeitpunkten zu beschränken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Annahmen zur Ausgangssituation
- 1.1 Jugend- und Jugendgenerationsbegriff
- 1.2 Multiplikatoreffekte/ exponentielle Entwicklung
- 2. Bestandsaufnahme aktueller Grundvoraussetzungen
- 2.1 Stichworte? – Keine Stichworte!
- 2.2 Generation multicasting
- 2.3 Generation abgestumpft
- 3. Der angestrebte Definitions- Kategorisierungsversuch
- 3.1 Erwartungen der Jugendlichen
- 3.2 Ansprüche an Jugendliche
- 3.2.1 Generation Multicasting II
- 3.2.2 Überforderung von Jugendlichen?
- 3.2.3 Generation abgestumpft II
- 4. Zur Möglichkeit neuer Kategorien folgender Jugendgenerationen
- 4.1 Schlechter Zeitpunkt / guter Zeitpunkt
- 4.2 Was kommt nach der Generation Multicasting?
- Literatur:
- Onlineressourcen:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz befasst sich mit der Frage, wie sich die Mediennutzung auf die Lebensweise und das Selbstverständnis von Jugendlichen im beginnenden 21. Jahrhundert auswirkt. Ziel ist es, einen neuen Generationsbegriff zu entwickeln, der die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der heutigen Jugend im Kontext des digitalen Zeitalters berücksichtigt.
- Die Auswirkungen der exponentiellen Entwicklung von Medienangeboten auf die Wahrnehmung und das Verhalten von Jugendlichen
- Die Entstehung eines neuen Generationsbegriffs, der die spezifischen Merkmale der heutigen Jugend im Kontext des Multicastings beschreibt
- Die Frage, ob die heutige Jugend durch die Überflutung mit Medieninhalten emotional und intellektuell abstumpft
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich für die Entwicklung zukünftiger Jugendgenerationen ergeben
- Die Bedeutung des Begriffs „Generation Multicasting“ für die Analyse aktueller Generationenmodelle und gesellschaftlicher Phänomene
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Medienrezeption von Jugendlichen in den Kontext historischer Debatten und beleuchtet die Annahme einer grundsätzlichen emotionalen und intellektuellen Abstumpfung von Jugendlichen. Sie führt den Begriff des Multicastings ein, der die gleichzeitige Nutzung verschiedener Medien beschreibt und als Ausgangspunkt für die Analyse der heutigen Jugend dient.
Kapitel 1 beleuchtet die Annahmen zur Ausgangssituation, indem es den Jugend- und Jugendgenerationsbegriff sowie die Auswirkungen der exponentiellen Entwicklung von Medienangeboten auf die Wahrnehmung und das Verhalten von Jugendlichen analysiert.
Kapitel 2 nimmt eine Bestandsaufnahme aktueller Grundvoraussetzungen vor und untersucht die spezifischen Merkmale der heutigen Jugend im Kontext des Multicastings. Es werden die Begriffe „Generation multicasting“ und „Generation abgestumpft“ eingeführt und diskutiert.
Kapitel 3 widmet sich dem Versuch, die heutige Jugend mit einem neuen Begriff zu kategorisieren und die Erwartungen und Ansprüche an Jugendliche in der heutigen Zeit zu analysieren. Es werden die Begriffe „Generation Multicasting II“ und „Generation abgestumpft II“ eingeführt und die Frage der Überforderung von Jugendlichen im Kontext des Multicastings diskutiert.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Frage, welche neuen Kategorien für zukünftige Jugendgenerationen relevant sein könnten und welche Tendenzen sich aus den Überlegungen zum Begriff „Generation Multicasting“ ableiten lassen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Generation Multicasting, die Mediennutzung von Jugendlichen, die Abstumpfung durch Medien, die Überforderung durch Medien, die Entwicklung neuer Generationsbegriffe, die Herausforderungen und Möglichkeiten der heutigen Jugend im Kontext des digitalen Zeitalters, die Auswirkungen des Multicastings auf die Wahrnehmung und das Verhalten von Jugendlichen, die Bedeutung des Begriffs „Generation Multicasting“ für die Analyse aktueller Generationenmodelle und gesellschaftlicher Phänomene.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Generation Multicasting"?
Er beschreibt die heutige Jugendgeneration, die durch die gleichzeitige Nutzung und den permanenten Empfang verschiedenster digitaler Medieninhalte geprägt ist.
Führt der hohe Medienkonsum zur emotionalen Abstumpfung von Jugendlichen?
Die Arbeit untersucht diese verbreitete pessimistische Annahme kritisch und beleuchtet, wie die Überflutung mit Reizen die Wahrnehmung und das Verhalten tatsächlich verändert.
Wie unterscheidet sich die Mediennutzung heute von der Zeit Goethes?
Früher war die Rezeption auf einzelne, nacheinander folgende Erlebnisse limitiert (z.B. ein Buch lesen). Heute findet Medienkonsum oft parallel und exponentiell beschleunigt statt.
Was ist die zentrale Kritik an der "Unterhaltungsindustrie" in Bezug auf die Jugend?
Es herrscht oft die Ansicht vor, Jugendliche würden durch klassische Konditionierung (Belohnung in Spielen/Medien) zu Handlungen getrieben, deren Auswirkungen sie nicht abschätzen können.
Welche Herausforderungen ergeben sich für zukünftige Jugendgenerationen?
Die ständige Überforderung durch Informationsflut und die Notwendigkeit, neue Kategorien für das Selbstverständnis im digitalen Zeitalter zu finden.
- Quote paper
- Roland Quiatkowski (Author), 2008, Generation Multicasting, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115000