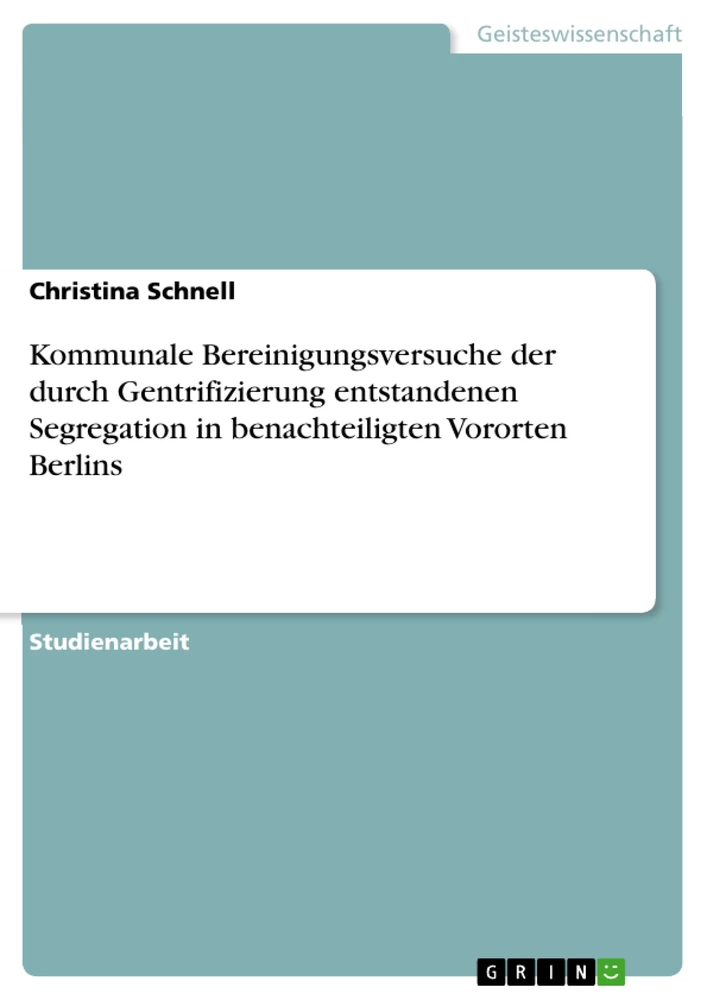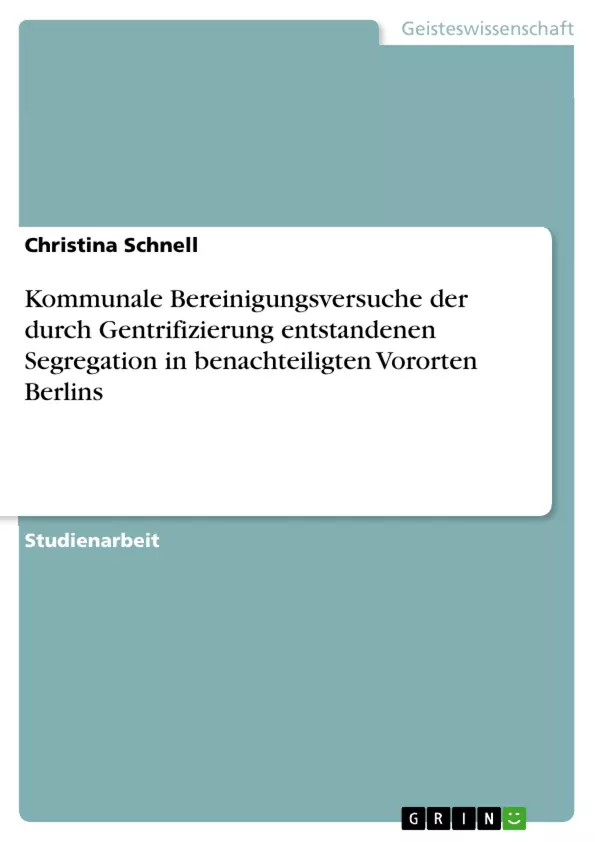Das Ziel dieser fiktiven Hausarbeit ist es, die kommunalen Inklusionsversuche einer nachhaltigeren Gestaltung zu erforschen, die die soziale Exklusion in Gebieten mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf, reduzieren sollen. Die Autorinnen Amy Lubitow, Kyla Tompkins und Madeleine Feldman untersuchen in ihrem Artikel die Komplexität der sozialen Barrieren für das Fahrradverhalten von Frauen und ethnischen Minderheiten in Portland, Oregon. Speziell richtet sich die Fragestellung auf die individuellen Erfahrungen während des Fahrradfahrens, die von ethnischen Minderheiten und Frauen, die ein Fahrrad besitzen, es jedoch nicht als regelmäßiges Transportationsmittel nutzen, erlebt werden. Es werden die individuellen Hindernisse, die einer regelmäßigen Fahrradnutzung der Zielgruppe entgegenstehen, wie auch Maßnahmen zu der Reduktion von vorhandenen sozialen Barrieren, erfragt.
Inhaltsverzeichnis
- Rezension
- Fragestellung
- Disziplinäre Sichtweise
- Argumentationslinie
- Ergebnis der Autoren
- Methoden der Autoren
- Wissenschaftlichkeit des Textes
- kritische Betrachtung des Textes
- Expose
- Entwicklung einer Fragestellung
- Theoretischer Ansatz
- Methoden
- Schlüsselbegriffe
- Gliederung des Hausarbeitskonzepts
- Begründung der Gliederung
- Suchstrategie der Literaturrecherche
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Artikel analysiert die sozialen Barrieren, die das Fahrradfahren von Frauen und ethnischen Minderheiten in Portland, Oregon erschweren. Die Autoren möchten verstehen, welche individuellen Erfahrungen während des Fahrradfahrens zu den bestehenden Ungleichheiten führen, und welche Maßnahmen zur Reduzierung dieser Barrieren ergriffen werden können.
- Soziale Barrieren beim Fahrradfahren von Frauen und ethnischen Minderheiten
- Rolle von Gentrifizierung und sozialräumlicher Segregation
- Einfluss von Rassismus und Sexismus im öffentlichen Raum
- Individuelle Erfahrungen und Hindernisse im städtischen Kontext
- Möglichkeiten zur Förderung von nachhaltiger und inklusiver Mobilität
Zusammenfassung der Kapitel
- Rezension: Die Autoren stellen die Forschungsfrage und den theoretischen Rahmen des Artikels vor. Sie betonen die Unterrepräsentanz von Frauen und Minderheiten als regelmäßige Fahrradnutzer in Portland und erläutern, wie Gentrifizierung und soziale Exklusion ihre Möglichkeiten zur Radnutzung einschränken. Sie argumentieren, dass die aktuelle Forschung die individuellen Erfahrungen von Minderheiten zu wenig berücksichtigt.
- Methoden und Daten: Die Autoren beschreiben die Methode der qualitativen Datenerhebung und die Zusammensetzung der Studienteilnehmer. Sie präsentieren Ergebnisse aus Interviews mit 30 Personen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die verschiedene Barrieren aufzeigen, wie z.B. Rassismus, Sexismus und Angst vor Belästigung im öffentlichen Raum.
Schlüsselwörter
Dieser Artikel untersucht die intersektionale Natur von sozialer Ungleichheit und Nachhaltigkeit in Bezug auf das Fahrradfahren. Die Schlüsselwörter umfassen: soziale Barrieren, Fahrradverhalten, Gentrifizierung, Rassismus, Sexismus, Minderheitenforschung, Stadtplanung, nachhaltige Mobilität, Portland, Oregon.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Gentrifizierung und Segregation in Berlin zusammen?
Gentrifizierung führt oft zur Verdrängung einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen, was die soziale und räumliche Segregation in benachteiligten Vororten verstärkt.
Welche Barrieren hindern Frauen und Minderheiten am Fahrradfahren?
Neben fehlender Infrastruktur spielen soziale Barrieren wie Rassismus, Sexismus und die Angst vor Belästigung im öffentlichen Raum eine entscheidende Rolle.
Was sind kommunale Inklusionsversuche?
Es sind Maßnahmen der Stadtplanung, die soziale Exklusion reduzieren und benachteiligte Gruppen besser in nachhaltige Mobilitätskonzepte einbinden sollen.
Warum ist nachhaltige Mobilität auch eine soziale Frage?
Weil der Zugang zu umweltfreundlichen Transportmitteln wie dem Fahrrad oft durch intersektionale Ungleichheiten (Klasse, Ethnizität, Geschlecht) erschwert wird.
Wie beeinflusst Gentrifizierung das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum?
Veränderte Nachbarschaftsstrukturen können dazu führen, dass sich marginalisierte Gruppen in ihren angestammten Vierteln weniger sicher oder willkommen fühlen.
- Citar trabajo
- Christina Schnell (Autor), 2021, Kommunale Bereinigungsversuche der durch Gentrifizierung entstandenen Segregation in benachteiligten Vororten Berlins, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1150434