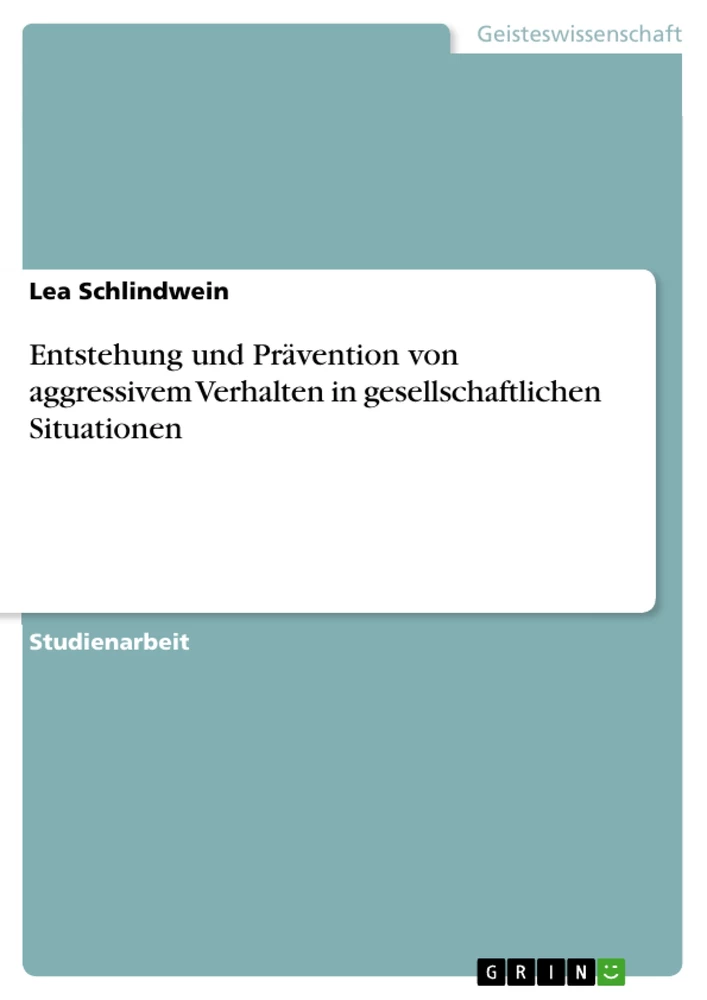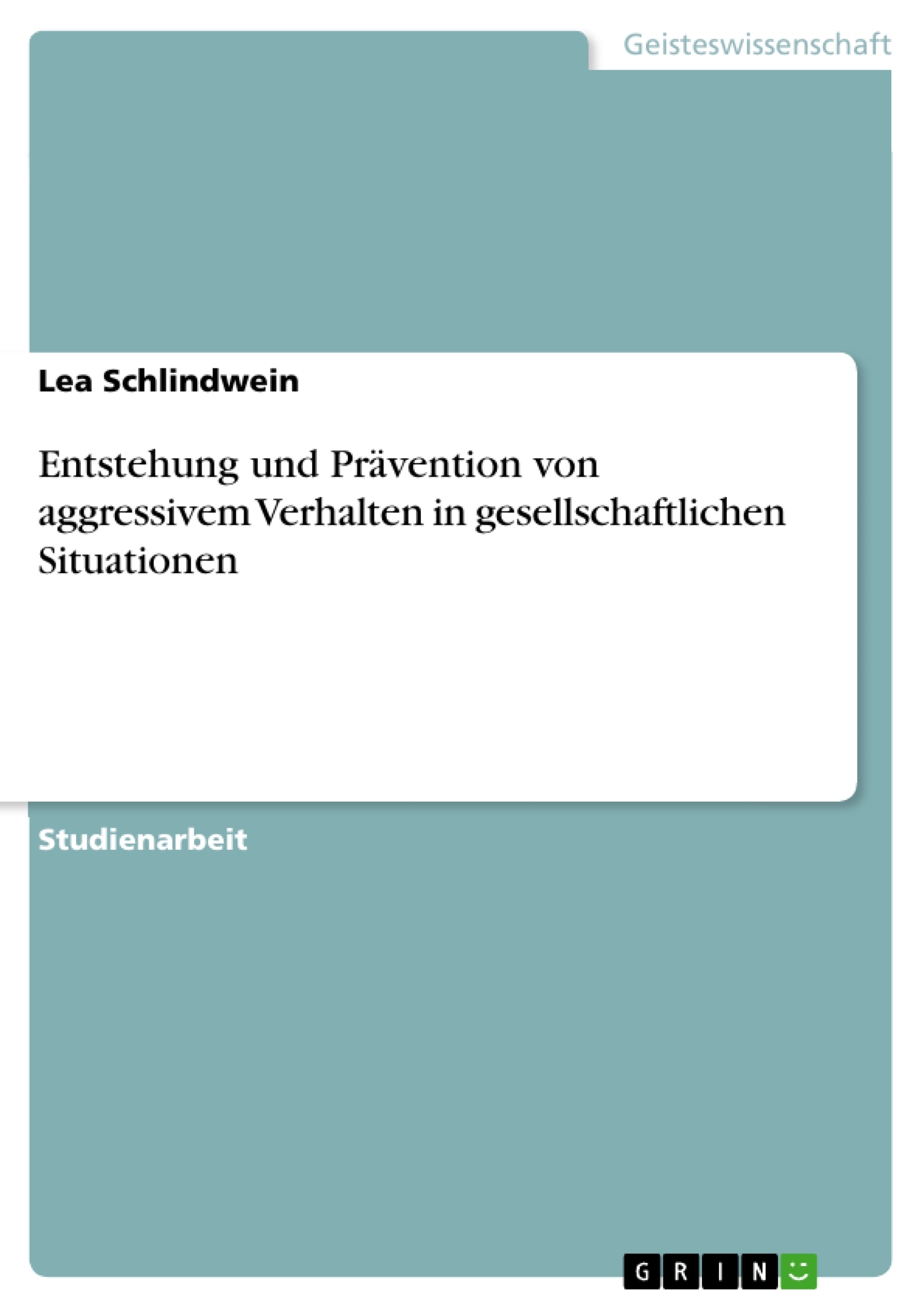Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, Präventionsmöglichkeiten von aggressivem Verhalten in gesellschaftlichen Situationen zu kreieren. Des Weiteren wird der Frage nach deren Stärken und Schwächen nachgegangen.
Zur Erreichung des Ziels sind zunächst die theoretischen Grundlagen von aggressivem Erleben und Verhalten auszuführen. Hierfür wird der Begriff der Aggression bestimmt und deren Entstehung mittels diverser Theorien erläutert. Die biologischen Theorien berücksichtigen die Evolution, die Genetik und die Hormone. Dagegen umfassen die psychologischen Konzepte das Frustrations-Aggression- und das kognitiv-neoassoziationistische Modell. Eine Unterkategorie bilden die Lerntheorien in Erscheinung des operanten Konditionierens und der Imitationsprozesse. Das Modell der allgemeinen Aggression vereinigt die unterschiedlichen Standpunkte. Dazu werden die zugrundeliegenden Annahmen sowie die personellen bzw. die situativen Determinanten dargelegt. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Theorie, auf deren Basis Möglichkeiten zur Prävention von aggressivem Verhalten bei Fußballspielen und politischen Demonstrationen kreiert werden. Im vierten Kapitel sind die Stärken und die Schwächen der entwickelten Interventionen zu diskutieren. Diese werden zuletzt auf ihre praktische Tauglichkeit überprüft. Zudem eröffnet sich ein Ausblick in die Zukunft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Bestimmung des Aggressionsbegriffs
- 2.2 Entstehung aggressiven Verhaltens
- 2.2.1 Biologische Theorien
- 2.2.1.1 Evolutionstheorie
- 2.2.1.2 Verhaltensgenetik
- 2.2.1.3 Chemische Botenstoffe
- 2.2.2 Psychologische Konzepte
- 2.2.2.1 Frustrations-Aggression-Theorie
- 2.2.2.2 Kognitiv-neoassoziationistische Theorie
- 2.2.2.3 Lerntheorie
- 2.2.2.4 Imitationstheorie
- 2.2.3 Integratives Modell der allgemeinen Aggression
- 2.2.3.1 Annahmen
- 2.2.3.2 Personelle Determinanten
- 2.2.3.3 Situative Determinanten
- 2.2.4 Zusammenfassung
- 3. Praktische Anwendungen
- 3.1 Prävention von aggressivem Verhalten bei Fußballspielen
- 3.2 Prävention von aggressivem Verhalten bei Demonstrationen
- 4. Diskussion
- 5. Fazit und Ausblick
- Bestimmung des Aggressionsbegriffs und Analyse der Entstehung aggressiven Verhaltens anhand verschiedener biologischer und psychologischer Theorien
- Anwendung des integrativen Modells der allgemeinen Aggression zur Analyse der Faktoren, die aggressives Verhalten in sozialen Situationen beeinflussen
- Entwicklung von Präventionsstrategien für aggressives Verhalten im Kontext von Fußballspielen und Demonstrationen
- Diskussion der Stärken und Schwächen der entwickelten Präventionsstrategien
- Bewertung der praktischen Tauglichkeit der Präventionsstrategien und Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Entstehung und Prävention von aggressivem Verhalten in gesellschaftlichen Situationen, insbesondere im Kontext von Fußballspielen und Demonstrationen. Sie verfolgt das Ziel, die theoretischen Grundlagen aggressiven Verhaltens zu beleuchten und daraus konkrete Präventionsmöglichkeiten zu entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problematik von aggressivem Verhalten in gesellschaftlichen Situationen anhand von konkreten Beispielen aus dem Fußball und der Politik. Sie stellt das Ziel der Arbeit dar, Präventionsmöglichkeiten zu entwickeln und die Stärken und Schwächen dieser Möglichkeiten zu untersuchen. Kapitel 2 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen von aggressivem Verhalten. Es definiert den Aggressionsbegriff und beleuchtet die Entstehung aggressiven Verhaltens unter Einbezug diverser biologischer, psychologischer und lerntheoretischer Konzepte. Kapitel 3 widmet sich der Anwendung der theoretischen Erkenntnisse auf praktische Situationen. Es entwickelt Präventionsstrategien für aggressives Verhalten im Kontext von Fußballspielen und Demonstrationen. Die Diskussion in Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Stärken und Schwächen der entwickelten Präventionsstrategien. Das Fazit und der Ausblick in Kapitel 5 resümieren die Ergebnisse der Arbeit und geben Hinweise auf zukünftige Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Aggression, Verhalten, Prävention, Fußball, Demonstrationen, Biologische Theorien, Psychologische Konzepte, Lerntheorien, Integratives Modell der allgemeinen Aggression, Personelle Determinanten, Situative Determinanten, Stärken, Schwächen, Praxisrelevanz.
Häufig gestellte Fragen
Welche biologischen Ursachen gibt es für Aggression?
Die Arbeit beleuchtet Evolutionstheorien, Verhaltensgenetik sowie den Einfluss von Hormonen und chemischen Botenstoffen auf das aggressive Erleben.
Was besagt die Frustrations-Aggressions-Theorie?
Dieses psychologische Konzept geht davon aus, dass Aggression immer eine Folge von Frustration ist, wenn Ziele oder Wünsche blockiert werden.
Wie kann Aggression bei Fußballspielen verhindert werden?
Die Arbeit entwickelt Präventionsstrategien, die sowohl situative Determinanten (z.B. Fantrennung) als auch personelle Faktoren berücksichtigen.
Was ist das "integrative Modell der allgemeinen Aggression"?
Dieses Modell vereinigt verschiedene Standpunkte und analysiert, wie personelle und situative Faktoren zusammenwirken, um aggressives Verhalten auszulösen.
Welche Rolle spielen Imitationsprozesse bei Gewalt?
Nach der Lerntheorie kann aggressives Verhalten durch Nachahmung (Modelllernen) erworben werden, was insbesondere in Gruppensituationen wie Demonstrationen relevant ist.
- Arbeit zitieren
- Lea Schlindwein (Autor:in), 2021, Entstehung und Prävention von aggressivem Verhalten in gesellschaftlichen Situationen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151486