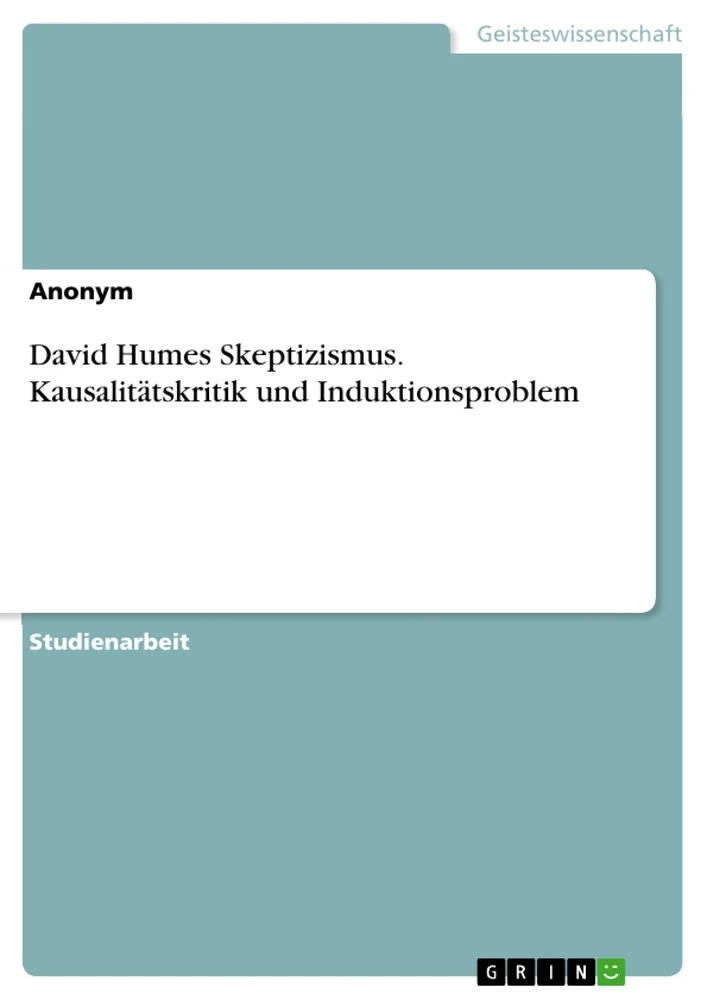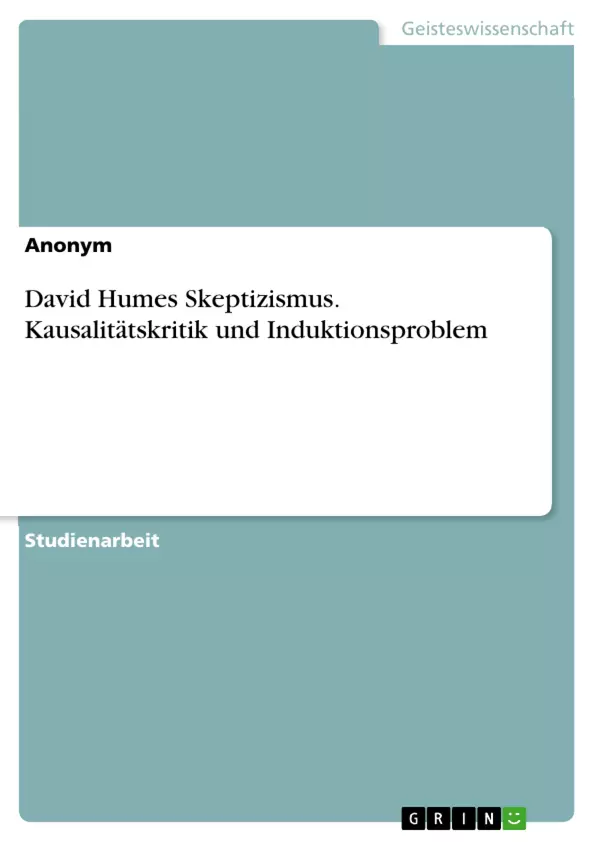In dieser Arbeit soll herausgearbeitet werden, aus welcher Perspektive heraus Hume den Verstand erkenntnistheoretisch eingrenzt und welche Möglichkeiten er trotz dieser Infragestellung innerweltlicher Erkenntnis für das pragmatische Handeln des Menschen in der Welt sieht. In seiner Untersuchung über den menschlichen Verstand aus dem Jahr 1748 stellt David Hume die Frage nach den Grenzen menschlicher Erkenntnis. Dabei schränkt er die Leistungsfähigkeit des Verstandes im Hinblick auf die Erfassung innerweltlicher Vorgänge radikal ein. Der Untersuchungsgang erfolgt in drei Schritten.
Im ersten Schritt soll die Konzeption der Untersuchung als essayistischer Sammelband vorgestellt werden. Bevor Hume im zweiten Abschnitt mit der Entwicklung seiner erkenntnistheoretischen Theorie beginnt, stellt er im ersten Abschnitt sein philosophisches Selbstverständnis dar. Dieses philosophische Programm bildet den Hintergrund, vor dem er seine erkenntnistheoretischen Grundsätze im zweiten und dritten Abschnitt formuliert. Die im zweiten Abschnitt eingeführte Unterscheidung zwischen Eindrücken und Vorstellungen und die im dritten Abschnitt dargestellten Assoziationsprinzipien werden als erkenntnistheoretische Grundlage Humes eingeführt.
Im zweiten Schritt folgt die Analyse des vierten und fünften Abschnitts, in welchen Hume am Beispiel der Kausal- und Induktionskritik seine Skeptischen Zweifel formuliert und schließlich durch einen Perspektivwechsel die Skeptische Lösung dieser Zweifel erreicht. Auf Grundlage der Ergebnisse der ersten beiden Teile der Arbeit soll in einem dritten Schritt eine Wertung erfolgen, welche zum einen Humes Lösung des Induktionsproblems würdigt, zum anderen aber auch deren skeptisch unabgeschlossenen und offenen Charakter problematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Konzeption der Untersuchung über den menschlichen Verstand
- Die literarische Konzeption – ein essayistischer Sammelband
- Das philosophische Programm
- Erkenntnistheoretische Voraussetzungen
- Die skeptischen Zweifel und die skeptische Lösung
- Die Abschnitte IV und V als Zentrum der Untersuchung
- Skeptische Zweifel
- Der Rahmen der Untersuchung
- Die Kausalitätskritik
- Die Induktionskritik
- Aporie des Denkens?
- Skeptische Lösung
- Gewohnheit als das der Induktion zugrundeliegende Prinzip
- Das Wesen des Glaubens
- Abschließende Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht David Humes Skeptizismus in seiner "Untersuchung über den menschlichen Verstand" aus dem Jahr 1748. Ziel ist es, Humes erkenntnistheoretische Einschränkungen des menschlichen Verstandes darzulegen und seine pragmatische Sichtweise auf das menschliche Handeln in der Welt zu beleuchten.
- Humes philosophische Grundannahmen und seine Kritik an der "malenden Philosophie"
- Die Unterscheidung zwischen Eindrücken und Vorstellungen als Grundlage für Humes Erkenntnistheorie
- Die skeptischen Zweifel Humes, insbesondere seine Kritik an Kausalität und Induktion
- Humes "skeptische Lösung" und die Rolle von Gewohnheit und Glauben in der menschlichen Erkenntnis
- Die Bedeutung von Humes Skeptizismus für die Frage nach den Grenzen menschlicher Erkenntnis und die Möglichkeiten des menschlichen Handelns
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Zielsetzung und den methodischen Ansatz der Untersuchung von Humes "Untersuchung über den menschlichen Verstand" dar. Sie fokussiert sich auf Humes skeptische Zweifel und deren Lösung im Kontext seiner erkenntnistheoretischen Grundannahmen.
- Die Konzeption der Untersuchung über den menschlichen Verstand: Dieses Kapitel analysiert die literarische Konzeption von Humes Werk als essayistischer Sammelband und beleuchtet sein philosophisches Programm, welches eine "anatomisierende Philosophie" gegenüber der "malenden Philosophie" bevorzugt. Es stellt zudem die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen seiner Argumentation dar, insbesondere die Unterscheidung zwischen Eindrücken und Vorstellungen und die Prinzipien der Assoziation.
- Die skeptischen Zweifel und die skeptische Lösung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Abschnitte IV und V von Humes "Untersuchung über den menschlichen Verstand", in denen er seine skeptischen Zweifel an der Kausalität und Induktion entwickelt und schließlich eine "skeptische Lösung" präsentiert. Es analysiert die Argumentationsstruktur von Humes Kritik und zeigt, wie er auf die Problematik der Kausalitäts- und Induktionskritik reagiert. Es untersucht dabei die Rolle von Gewohnheit und Glauben in seiner Lösung des Skeptizismus.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Erkenntnistheorie, insbesondere David Humes Skeptizismus, seine Kritik an der Kausalität und Induktion, die Unterscheidung zwischen Eindrücken und Vorstellungen, die Rolle von Gewohnheit und Glauben in der menschlichen Erkenntnis, sowie die Abgrenzung zwischen "anatomisierender Philosophie" und "malender Philosophie".
Häufig gestellte Fragen
Was ist David Humes Kritik an der Kausalität?
Hume argumentiert, dass wir keine notwendige Verknüpfung zwischen Ursache und Wirkung wahrnehmen können, sondern nur eine regelmäßige Abfolge von Ereignissen.
Was versteht Hume unter dem Induktionsproblem?
Es ist die Frage, warum wir glauben, dass die Zukunft der Vergangenheit entsprechen wird, obwohl es dafür keine rationale Beweisführung gibt.
Wie lautet Humes „skeptische Lösung“?
Da die Vernunft uns keine Gewissheit gibt, übernimmt die „Gewohnheit“ (Custom) die Führung. Wir glauben an Kausalität, weil es für unser praktisches Leben notwendig ist.
Was ist der Unterschied zwischen Eindrücken und Vorstellungen?
Eindrücke (Impressions) sind unmittelbare, lebhafte Wahrnehmungen, während Vorstellungen (Ideas) nur schwache Abbilder dieser Eindrücke im Denken sind.
Was bedeutet „anatomisierende Philosophie“ bei Hume?
Es ist sein Ansatz, die menschliche Natur und den Verstand wissenschaftlich zu untersuchen, statt sie nur moralisch-belehrend zu „malen“.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, David Humes Skeptizismus. Kausalitätskritik und Induktionsproblem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151745