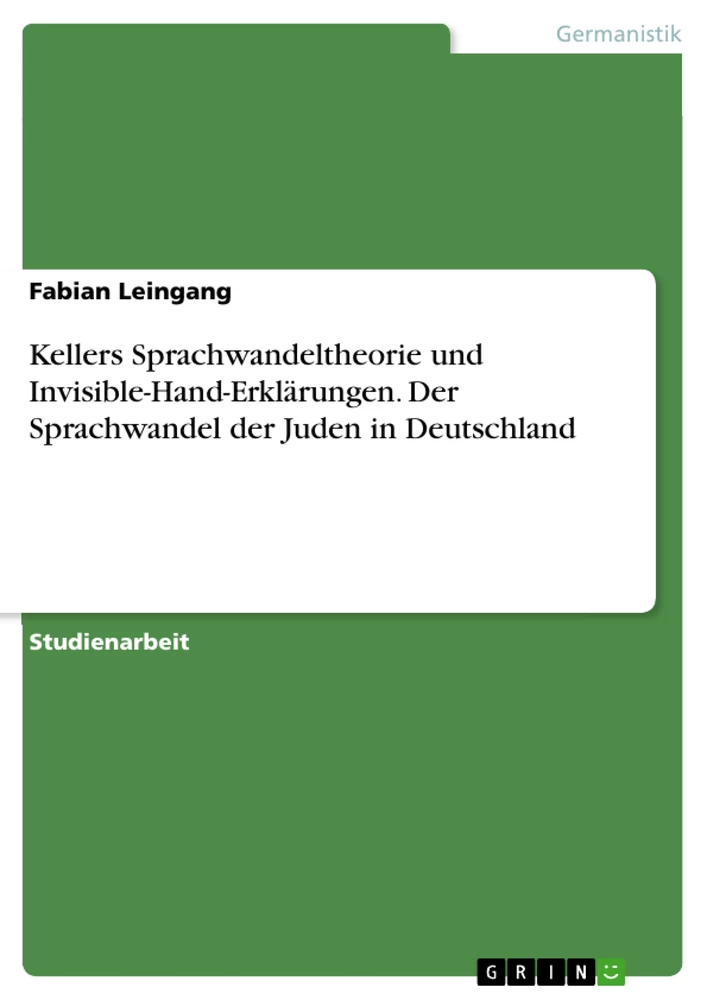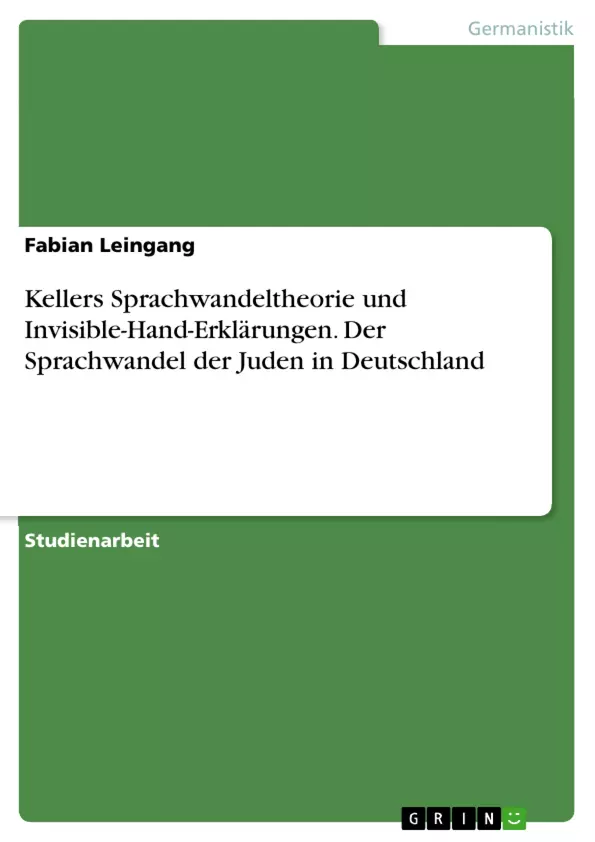In dieser Arbeit wird Rudi Kellers Sprachwandeltheorie untersucht. Dabei sollen vor allem Kellers „Invisible-Hands-Erklärungen“ (Erklärungen der unsichtbaren Hand) und seine Handlungsmaximen im Fokus stehen und ausführlich diskutiert werden. Es wird der Frage nachgegangen, wie diese überhaupt funktionieren und wie man mit ihrer Hilfe den Sprachwandel erklären und darstellen kann. Darüber hinaus sollen Kellers Aussagen im Rahmen dieser Arbeit präsentiert, analysiert und diskutiert werden. An dieser Stelle könnte man darüber nachdenken, mögliche Gegenpositionen und Kritiker Kellers vorzubringen, jedoch verzichtet diese Arbeit auf diesen Punkt, da es sonst in der Kürze der Zeit nicht möglich wäre, Kellers Ausführung gerecht zu werden.
Der zweite Teil dieser Arbeit liefert ein Fallbeispiel für den Sprachwandel. Dabei wird das Verschwinden des Westjiddisch unter den deutschen Juden thematisiert, der Ablauf dessen dargestellt und darüber hinaus mögliche Ursachen dafür untersucht. Was bewirkte überhaupt die Aufgabe der bis dato angestammte Alltagssprache der Juden? In einem abschließenden Kapitel soll geklärt werden, ob sich Hinweise für die Motive des Verschwindens bei Kellers Sprachwandeltheorie finden lassen. Dabei wird die Frage aufgearbeitet, ob und inwieweit Kellers Thesen einen Nährboden zur Erklärung dieses Wandels liefern können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kellers Sprachwandeltheorie
- Invisible-Hand-Erklärungen
- Kellers Handlungsmaximen
- Der Sprachwandel der Juden in Deutschland
- Ein kurzer historischer Abriss
- Anwendung von Kellers Sprachwandeltheorie auf das Westjiddische
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Rudi Kellers Sprachwandeltheorie, insbesondere seine "Invisible-Hand-Erklärungen" und Handlungsmaximen. Sie analysiert, wie diese Theorien den Sprachwandel erklären und wird anhand des Verschwindens des Westjiddisch bei deutschen Juden angewendet. Die Arbeit zielt darauf ab, Kellers Thesen zu präsentieren, zu analysieren und ihre Anwendbarkeit auf ein konkretes Beispiel des Sprachwandels zu überprüfen.
- Rudi Kellers Sprachwandeltheorie
- Kellers "Invisible-Hand-Erklärungen"
- Kellers Handlungsmaximen
- Der Sprachwandel des Westjiddisch
- Anwendung von Kellers Theorie auf den Fall des Westjiddisch
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Sprachwandels und die Bedeutung von Rudi Kellers Sprachwandeltheorie ein. Sie erläutert die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Analyse von Kellers "Invisible-Hand-Erklärungen" und Handlungsmaximen sowie deren Anwendung auf das Verschwinden des Westjiddisch bei deutschen Juden. Die Arbeit beschränkt sich bewusst auf die Darstellung und Analyse von Kellers Theorie, ohne eingehende Auseinandersetzung mit gegensätzlichen Positionen.
Kellers Sprachwandeltheorie: Dieses Kapitel stellt Kellers Sprachwandeltheorie vor. Es beschreibt den Sprachwandel als einen dynamischen Prozess, vergleichbar mit einem Organismus, der sich ständig verändert. Keller hinterfragt die Annahme, Sprache könnte unverändert bleiben und argumentiert, dass eine lebendige Sprache sich an neue Gegebenheiten anpassen muss. Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, den Sprachwandel zu erklären und differenziert zwischen den organistischen und mechanistischen Versionen der Frage nach den Gründen des Sprachwandels. Kritisch wird angemerkt, dass Kellers Aussagen keine befriedigende Antwort auf die Frage nach den Ursachen des Sprachwandels liefern.
Invisible-Hand-Erklärungen: [Dieses Kapitel fehlt im Auszug und kann daher nicht zusammengefasst werden.]
Kellers Handlungsmaximen: [Dieses Kapitel fehlt im Auszug und kann daher nicht zusammengefasst werden.]
Der Sprachwandel der Juden in Deutschland: Dieses Kapitel präsentiert ein Fallbeispiel für Sprachwandel: das Verschwinden des Westjiddisch unter deutschen Juden. Es liefert einen kurzen historischen Abriss und untersucht mögliche Ursachen für den Sprachwechsel. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Prozesses und der Suche nach Erklärungen für das Aufgeben des Jiddisch als Alltagssprache. Die spätere Anwendung von Kellers Theorie auf diesen konkreten Fall wird angekündigt.
Schlüsselwörter
Sprachwandel, Rudi Keller, Invisible-Hand-Erklärungen, Handlungsmaximen, Westjiddisch, Sprachkontakt, Sprachverschiebung, deutsch-jüdische Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Rudi Kellers Sprachwandeltheorie am Beispiel des Westjiddisch
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Rudi Kellers Sprachwandeltheorie, insbesondere seine "Invisible-Hand-Erklärungen" und Handlungsmaximen. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieser Theorie auf den Sprachwandel des Westjiddisch bei deutschen Juden. Die Arbeit präsentiert und analysiert Kellers Thesen und untersucht deren Anwendbarkeit auf ein konkretes Beispiel des Sprachwandels.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Rudi Kellers Sprachwandeltheorie, Kellers "Invisible-Hand-Erklärungen", Kellers Handlungsmaximen, den Sprachwandel des Westjiddisch bei deutschen Juden, einen historischen Abriss des Sprachwandels des Westjiddisch und die Anwendung von Kellers Theorie auf den Fall des Westjiddisch.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt: Einleitung, Kellers Sprachwandeltheorie, Invisible-Hand-Erklärungen, Kellers Handlungsmaximen, Der Sprachwandel der Juden in Deutschland (mit Unterkapiteln: kurzer historischer Abriss und Anwendung von Kellers Theorie auf das Westjiddische) und Fazit. Die Kapitel "Invisible-Hand-Erklärungen" und "Kellers Handlungsmaximen" sind im vorliegenden Auszug nicht vollständig enthalten.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Kellers Sprachwandeltheorie zu präsentieren und zu analysieren und ihre Anwendbarkeit auf den konkreten Fall des Sprachwandels des Westjiddisch zu überprüfen. Sie untersucht, wie Kellers Theorien den Sprachwandel erklären können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachwandel, Rudi Keller, Invisible-Hand-Erklärungen, Handlungsmaximen, Westjiddisch, Sprachkontakt, Sprachverschiebung, deutsch-jüdische Geschichte.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt die Einleitung, die Kellers Theorie vorstellt und die Fragestellung formuliert. Das Kapitel zu Kellers Theorie selbst beleuchtet den Sprachwandel als dynamischen Prozess und die Schwierigkeiten, diesen zu erklären. Die Kapitel zu den "Invisible-Hand-Erklärungen" und den Handlungsmaximen sind im Auszug nicht zusammengefasst. Das Kapitel zum Sprachwandel der Juden in Deutschland bietet einen historischen Überblick zum Verschwinden des Westjiddisch und kündigt die Anwendung von Kellers Theorie an.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit wendet eine analytische Methode an, indem sie Kellers Theorie präsentiert und diese auf den konkreten Fall des Sprachwandels des Westjiddisch anwendet. Gegensätzliche Positionen werden im vorliegenden Auszug nicht behandelt.
- Arbeit zitieren
- Fabian Leingang (Autor:in), 2017, Kellers Sprachwandeltheorie und Invisible-Hand-Erklärungen. Der Sprachwandel der Juden in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1153528