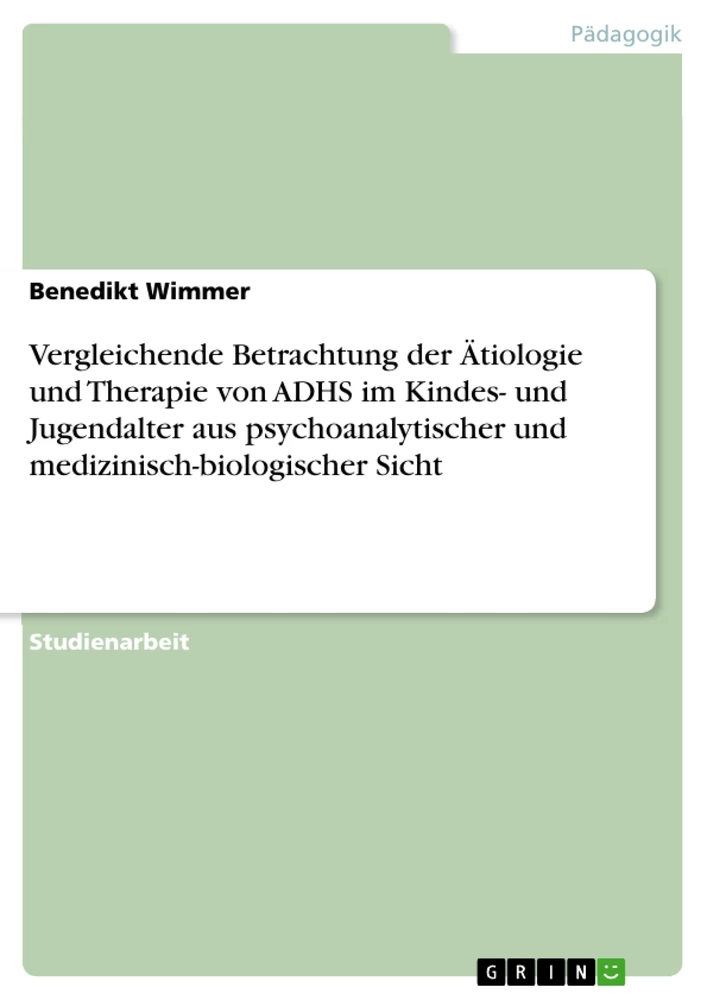Die Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung ist eine der am häufigsten diagnostizierten psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen, wobei die Prävalenz auf ca. 5 % weltweit geschätzt wird. Obwohl viele Menschen weltweit an der Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung leiden, ist trotz intensiver Forschung in den letzten Jahrzehnten immer noch nicht vollständig geklärt, welches die Ursachen der Entstehung von ADHS sind. Der aktuelle Stand der Forschung zeigt derzeit, dass ein Zusammenspiel mehrere Variablen von Genetik, Umwelt und neurobiologischen Faktoren die Störung hervorrufen bzw. begünstigen. Aufgrund der pluralen Erklärungsweisen haben unterschiedliche Disziplinen, kontroverse Therapieformen entwickelt. Dabei beschreibt der Kinder- und Jugendpsychiater Peter Riedesser ADHS als eine der größten Kontroversen in der Geschichte der Kinder- und Jugendpsychatrie.
Im Rahmen dieser Hausarbeit möchte ich mich dieser Thematik näher widmen und zwei der vielleicht kontroversesten diskutierten Ursachen und deren Therapieformen im Kinder- und Jugendalter näher beleuchten. Zum einen, die im Diskurs am prominentesten vertretene Sicht der Medizin, welche die ätiologische Erklärung aufgrund eines Neurotransmitter-Defizites im Frontalhirn sieht. Zum anderen, die psychoanalytische Kinder- und Jugendpsychologie, welche die Ursache der Entstehung von ADHS im Zusammenhang mit schmerzlichen Erfahrungen im Kleinkindalter erklärt. Dabei kann die Psychoanalyse auf verschiedenste Theorien, wie der Ich-Psychologie, sowie Objektbeziehungstheorie als auch Bindungstheorie zurückgreifen.
Resultierend aus den unterschiedlichen Ätiologie Modellen entstehen auch dementsprechend konträre Behandlungsformen. Daraus ergibt sich schließlich meine Fragestellung, inwiefern sich die Ätiologie von der Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung im Kinder- und Jugendalter aus medizinisch-biologischer, sowie psychoanalytischer Sichtweise unterscheiden und welche Therapieformen sich daraus ergeben? Im Fazit soll es dann darum gehen, die beiden Sichtweisen in einen sinnvollen Kontext zu stellen und eventuelle daraus sich ergebenden Therapieansatz zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Krankheitsbild der ADHS
- 2.1 Symptome
- 2.2 Diagnose
- 3 Medizinisch-biologische Perspektive auf ADHS
- 3.1 Ätiologie aus medizinisch-biologischer Perspektive
- 3.2 Medikamentöse Behandlung
- 4 Psychoanalytische Betrachtungsweise auf ADHS
- 4.1 Ätiologie aus psychoanalytischer Perspektive
- 4.2 Psychoanalytische Interventionen bei ADHS
- 5 Diskussion der Ergebnisse
- 5.1 Symptomverständnis
- 5.2 Ätiologische und therapeutische Unterschiede
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die kontroversen Sichtweisen auf die Ätiologie und Therapie von ADHS im Kindes- und Jugendalter. Sie vergleicht die medizinisch-biologische und die psychoanalytische Perspektive, um die Unterschiede in der Ursachenklärung und den daraus resultierenden Behandlungsansätzen aufzuzeigen.
- Vergleich der ätiologischen Erklärungen von ADHS aus medizinisch-biologischer und psychoanalytischer Sicht.
- Analyse der jeweiligen Therapieansätze (medikamentös vs. psychoanalytisch).
- Untersuchung der Kernsymptome von ADHS (Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität).
- Diskussion der diagnostischen Herausforderungen bei ADHS.
- Zusammenführung der unterschiedlichen Perspektiven und Ableitung möglicher integrativer Therapieansätze.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der ADHS-Kontroverse ein und beschreibt die häufige Diagnose von ADHS bei Kindern und Jugendlichen, trotz ungeklärter Ursachen. Sie hebt die unterschiedlichen Erklärungsmodelle der Medizin und der Psychoanalyse hervor und formuliert die Forschungsfrage nach den Unterschieden in der Ätiologie und Therapie aus beiden Perspektiven. Die Arbeit beabsichtigt, diese Kontroverse zu beleuchten und mögliche integrative Therapieansätze zu diskutieren.
2 Krankheitsbild der ADHS: Dieses Kapitel beschreibt das Krankheitsbild der ADHS, indem es die drei Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität detailliert darstellt. Es erläutert das Auftreten dieser Symptome bei Kindern und Jugendlichen und geht auf den diagnostischen Prozess ein, inklusive der verwendeten Klassifikationssysteme (ICD-10, DSM-V) und der Herausforderungen einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose. Die Bedeutung der Differentialdiagnostik zur Abgrenzung von anderen Störungen wird ebenfalls betont.
3 Medizinisch-biologische Perspektive auf ADHS: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die medizinisch-biologische Sichtweise der ADHS-Ätiologie. Es beleuchtet neuroanatomische und neurochemische Erklärungen, insbesondere die Rolle des Frontalhirns und des Dopaminsystems. Die genetische Komponente wird anhand von Zwillingsstudien hervorgehoben. Der Abschnitt legt den Fokus auf die neurobiologischen Befunde, die auf ein Ungleichgewicht im Neurotransmittersystem hindeuten und somit die Grundlage für die medikamentöse Behandlung bilden.
4 Psychoanalytische Betrachtungsweise auf ADHS: Dieses Kapitel präsentiert die psychoanalytische Perspektive auf ADHS, die die Ursachen der Störung in frühkindlichen Erfahrungen und Beziehungsmustern sieht. Es diskutiert verschiedene psychoanalytische Theorien (Ich-Psychologie, Objektbeziehungstheorie, Bindungstheorie) als mögliche Erklärungsansätze. Im Fokus stehen hier die psychodynamischen Prozesse und deren Einfluss auf die Symptomatik. Der Abschnitt beschreibt die psychoanalytischen Interventionen zur Behandlung von ADHS.
5 Diskussion der Ergebnisse: Diese Diskussion vergleicht die medizinisch-biologische und die psychoanalytische Perspektive auf ADHS. Sie analysiert die Unterschiede im Symptomverständnis, in der Ätiologie und in den daraus resultierenden Therapieformen. Der Abschnitt dient der kritischen Auseinandersetzung mit den jeweiligen Stärken und Schwächen der beiden Ansätze und bereitet den Weg für das Fazit.
Schlüsselwörter
ADHS, Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung, Ätiologie, Therapie, medizinisch-biologische Perspektive, psychoanalytische Perspektive, Neurotransmitter, Frontalhirn, Dopamin, frühkindliche Erfahrungen, medikamentöse Behandlung, psychoanalytische Interventionen, Differentialdiagnostik, ICD-10, DSM-V, Komorbiditäten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: ADHS - Ein Vergleich medizinisch-biologischer und psychoanalytischer Perspektiven
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit vergleicht die medizinisch-biologische und die psychoanalytische Perspektive auf die Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes- und Jugendalter. Sie untersucht die Unterschiede in der Ursachenklärung (Ätiologie) und den daraus resultierenden Behandlungsansätzen. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Beschreibung des Krankheitsbildes von ADHS, die Darstellung beider Perspektiven (medizinisch-biologisch und psychoanalytisch), eine Diskussion der Ergebnisse und ein Fazit. Zusätzlich werden Schlüsselwörter und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel bereitgestellt.
Welche Perspektiven werden auf ADHS untersucht?
Die Hausarbeit vergleicht zwei gegensätzliche Perspektiven auf ADHS: die medizinisch-biologische und die psychoanalytische. Die medizinisch-biologische Perspektive konzentriert sich auf neuroanatomische und neurochemische Erklärungen, während die psychoanalytische Perspektive die Ursachen in frühkindlichen Erfahrungen und Beziehungsmustern sucht.
Welche Aspekte der ADHS werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Aspekte: die drei Kernsymptome von ADHS (Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität), die diagnostischen Herausforderungen, die ätiologischen Erklärungen aus medizinisch-biologischer und psychoanalytischer Sicht, die jeweiligen Therapieansätze (medikamentös vs. psychoanalytisch), und eine Diskussion der Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Perspektiven.
Wie werden die medizinisch-biologischen Aspekte von ADHS dargestellt?
Der medizinisch-biologische Teil der Hausarbeit beleuchtet neuroanatomische und neurochemische Erklärungen für ADHS, insbesondere die Rolle des Frontalhirns und des Dopaminsystems. Die genetische Komponente wird anhand von Zwillingsstudien erläutert. Der Fokus liegt auf neurobiologischen Befunden, die ein Ungleichgewicht im Neurotransmittersystem nahelegen und die medikamentöse Behandlung begründen.
Wie werden die psychoanalytischen Aspekte von ADHS dargestellt?
Der psychoanalytische Teil der Hausarbeit betrachtet ADHS als Folge frühkindlicher Erfahrungen und Beziehungsmuster. Verschiedene psychoanalytische Theorien (Ich-Psychologie, Objektbeziehungstheorie, Bindungstheorie) werden als mögliche Erklärungsansätze diskutiert. Der Fokus liegt auf den psychodynamischen Prozessen und deren Einfluss auf die Symptomatik. Die psychoanalytischen Interventionen zur Behandlung von ADHS werden ebenfalls beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit vergleicht die Stärken und Schwächen der medizinisch-biologischen und der psychoanalytischen Perspektive auf ADHS und diskutiert mögliche integrative Therapieansätze. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und bewertet die beiden Ansätze kritisch.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: ADHS, Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung, Ätiologie, Therapie, medizinisch-biologische Perspektive, psychoanalytische Perspektive, Neurotransmitter, Frontalhirn, Dopamin, frühkindliche Erfahrungen, medikamentöse Behandlung, psychoanalytische Interventionen, Differentialdiagnostik, ICD-10, DSM-V, Komorbiditäten.
Welche Kapitel beinhaltet die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Krankheitsbild der ADHS, Medizinisch-biologische Perspektive auf ADHS, Psychoanalytische Betrachtungsweise auf ADHS, Diskussion der Ergebnisse und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Hausarbeit separat zusammengefasst.
- Quote paper
- Benedikt Wimmer (Author), 2021, Vergleichende Betrachtung der Ätiologie und Therapie von ADHS im Kindes- und Jugendalter aus psychoanalytischer und medizinisch-biologischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1156424