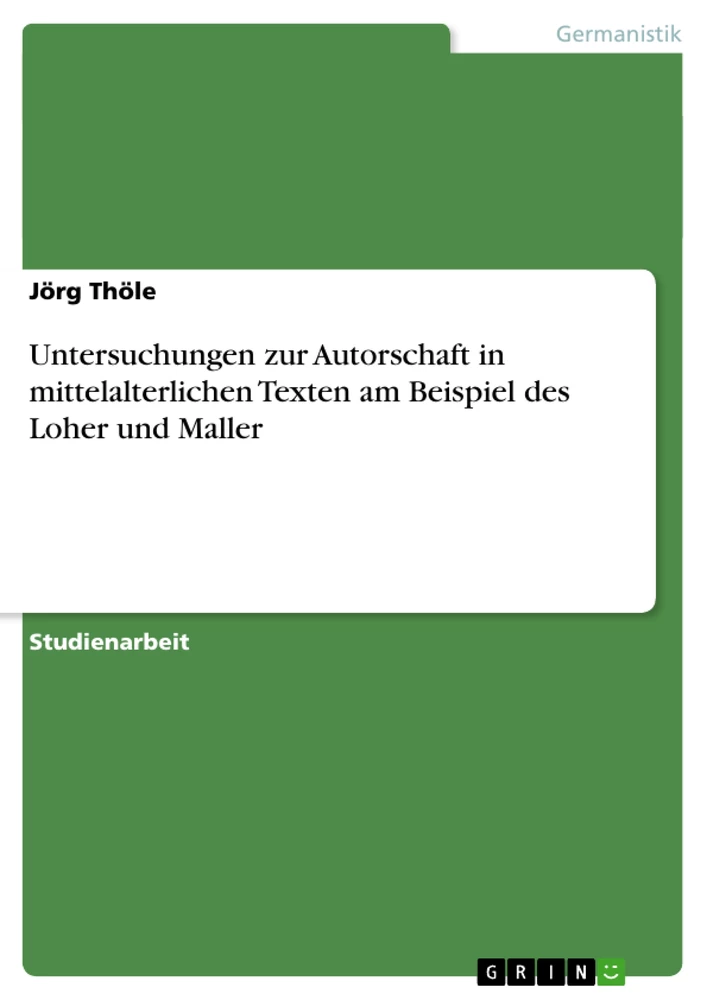Der Roman Loher und Maller, der üblicherweise Elisabeth von Nassau Saarbrücken
zugeschrieben wird, ist in der Forschung nicht gerade für seine literarische Hochwertigkeit
bekannt. Konczak (1991), der sich in seiner Dissertation mit der Druckgeschichte
des Loher und des Herpin beschäftigt, lehnt sogar „eine umfassende Darstellung
der Textgeschichte“ ab, denn sie „hätte den damit verbundenen Aufwand nicht
gerechtfertigt und wäre angesichts der recht bescheidenen literarischen Qualität der
Texte nicht vertretbar“ (S. 19). Von Bloh (2002) ist nur wenig diplomatischer und
gibt an, dass die Texte „von den heutigen Standards für das Erzählen beinahe ebenso
weit entfernt sind wie vom Erzählen in hochmittelalterlichen Romanen“ und „sprachliche
Glanzleistungen tatsächlich nicht präsentieren“ (S. 1). Sie gibt aber zu, dass
diese Wertungen vor allem unseren heutigen Maßstäben geschuldet sein können (S.
8) und dass der Loher über eine „durchaus komplizierte Erzähltechnik“ verfügt (S.
103).
In diese Diskussion soll sich hier nicht eingemischt werden. Der Roman ist nämlich
aus anderen Gründen von hohem wissenschaftlichen Interesse. So ist es einer der ersten
Prosaromane der deutschen Literaturgeschichte. Zudem wird er, ungewöhnlich
für das Mittelalter, einer adligen Frau zugeschrieben. Schließlich handelt es sich um
die deutschsprachige Umsetzung einer nur noch fragmentarisch vorhandenen französischen
Vorlage.
Aus all diesen Gründen werden weniger interpretatorische Fragen als Fragen zur
Autorschaft seit geraumer Zeit in der Wissenschaft diskutiert. Daher bietet es sich
geradezu an, Theorien zur Autorschaft anhand dieses Romans zu überprüfen und
weiterzuentwickeln. Dies soll das Ziel der vorliegenden Arbeit sein.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Booth: Implizierter Autor
- Genette gegen Booth
- Eco
- Paratexte: Genette
- Zusammenfassung
- Autorkonstrukt
- Grundlegendes zur Biographie Elisabeths von Nassau-Saarbrücken
- Quellen- und Überlieferungslage
- Aufbau
- Stilistische Eigenheiten
- Paratexte im Loher und Maller
- Subskription / Proömium
- Illustrationen
- Anwendung auf das Schema
- Schlussfolgerungen
- Schlussworte
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Autorschaft des mittelalterlichen Romans "Loher und Maller", der traditionell Elisabeth von Nassau-Saarbrücken zugeschrieben wird. Ziel ist es, anhand dieses Beispiels Theorien zur Autorschaft zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Dabei werden verschiedene theoretische Ansätze, insbesondere von Booth, Genette und Eco, herangezogen, um ein eigenes Konzept zur Analyse der Autorschaft zu entwickeln.
- Analyse der Autorschaft anhand des Romans "Loher und Maller"
- Anwendung und Weiterentwicklung theoretischer Ansätze zur Autorschaft
- Untersuchung der Rolle von Paratexten in der Autorschaftsbestimmung
- Entwicklung eines eigenen Konzepts zur Analyse der Autorschaft
- Beurteilung der Zuschreibung des Romans "Loher und Maller" an Elisabeth von Nassau-Saarbrücken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Roman "Loher und Maller" vor und erläutert seine Bedeutung für die deutsche Literaturgeschichte. Sie beleuchtet die Debatte um die literarische Qualität des Romans und betont die Relevanz der Autorschaftsfrage. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Theorien zur Autorschaft anhand dieses Romans zu überprüfen und weiterzuentwickeln.
Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" behandelt verschiedene Ansätze zur Autorschaft, darunter Booths Konzept des impliziten Autors, Genettes Kritik an Booth und Ecos Theorie der Textinterpretation. Es werden die Grenzen und Möglichkeiten der verschiedenen Ansätze diskutiert und ein eigenes Konzept zur Analyse der Autorschaft entwickelt.
Das Kapitel "Grundlegendes zur Biographie Elisabeths von Nassau-Saarbrücken" bietet einen Überblick über das Leben der möglichen Autorin des Romans. Es werden wichtige Stationen ihrer Biografie beleuchtet, die für die Interpretation des Romans relevant sein könnten.
Das Kapitel "Quellen- und Überlieferungslage" untersucht die verschiedenen Versionen des Romans und die Überlieferung des Textes. Es werden die wichtigsten Quellen und ihre Bedeutung für die Autorschaftsfrage beleuchtet.
Das Kapitel "Aufbau" analysiert die Struktur des Romans und seine einzelnen Teile. Es werden die wichtigsten Handlungselemente und die narrative Struktur des Textes untersucht.
Das Kapitel "Stilistische Eigenheiten" beschäftigt sich mit der Sprache und dem Stil des Romans. Es werden charakteristische Merkmale des Textes analysiert und in Bezug auf die mögliche Autorschaft gesetzt.
Das Kapitel "Paratexte im Loher und Maller" untersucht die Rolle von Paratexten, wie Subskriptionen und Illustrationen, für die Autorschaftsbestimmung. Es werden die verschiedenen Formen von Paratexten im Roman analysiert und ihre Bedeutung für die Interpretation des Textes und die Zuschreibung an Elisabeth von Nassau-Saarbrücken beleuchtet.
Das Kapitel "Anwendung auf das Schema" wendet die im vorherigen Kapitel entwickelten theoretischen Ansätze auf den Roman "Loher und Maller" an. Es werden die Ergebnisse der Analyse der verschiedenen Aspekte des Romans zusammengefasst und in Bezug auf die Autorschaftsfrage interpretiert.
Das Kapitel "Schlussfolgerungen" fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die Autorschaftsfrage. Es werden die Grenzen und Möglichkeiten der verschiedenen Ansätze zur Autorschaftsbestimmung diskutiert und die Bedeutung des Romans "Loher und Maller" für die deutsche Literaturgeschichte hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Autorschaft, den mittelalterlichen Roman, "Loher und Maller", Elisabeth von Nassau-Saarbrücken, Paratexte, Subskription, Illustration, Booth, Genette, Eco, Textinterpretation, Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist die mutmaßliche Autorin von „Loher und Maller“?
Der mittelalterliche Prosaroman wird traditionell Elisabeth von Nassau-Saarbrücken zugeschrieben, einer adligen Frau des 15. Jahrhunderts.
Was macht diesen Roman literaturgeschichtlich bedeutend?
Es handelt sich um einen der ersten Prosaromane der deutschen Literaturgeschichte und stellt eine Umsetzung französischer Vorlagen dar.
Was sind Paratexte und warum sind sie hier wichtig?
Paratexte sind Beigaben zum Text wie Vorreden (Proömien), Subskriptionen oder Illustrationen. Sie geben wichtige Hinweise auf die Entstehung und die Autorschaft des Werkes.
Welche Autortheorien werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit nutzt Konzepte von Wayne C. Booth (implizierter Autor), Gérard Genette (Paratexte) und Umberto Eco, um die Frage der Autorschaft wissenschaftlich zu untersuchen.
Wie wird die literarische Qualität des Romans bewertet?
In der älteren Forschung wurde die Qualität oft als bescheiden abgetan; modernere Ansätze betonen jedoch die komplizierte Erzähltechnik und den historischen Wert des Textes.
- Citar trabajo
- Jörg Thöle (Autor), 2007, Untersuchungen zur Autorschaft in mittelalterlichen Texten am Beispiel des Loher und Maller, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115809