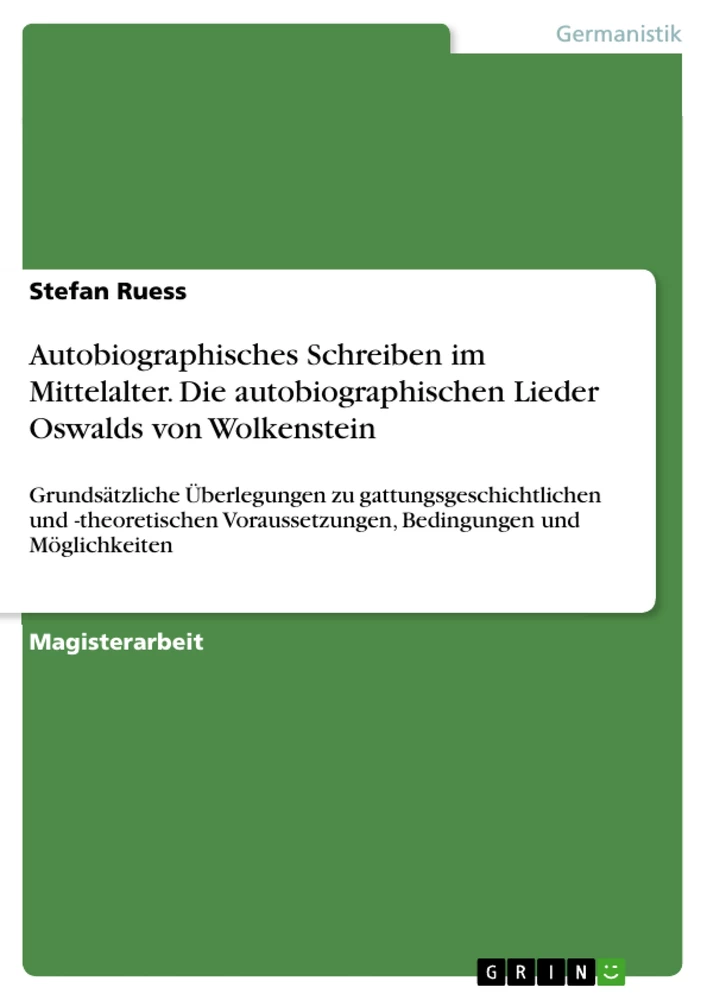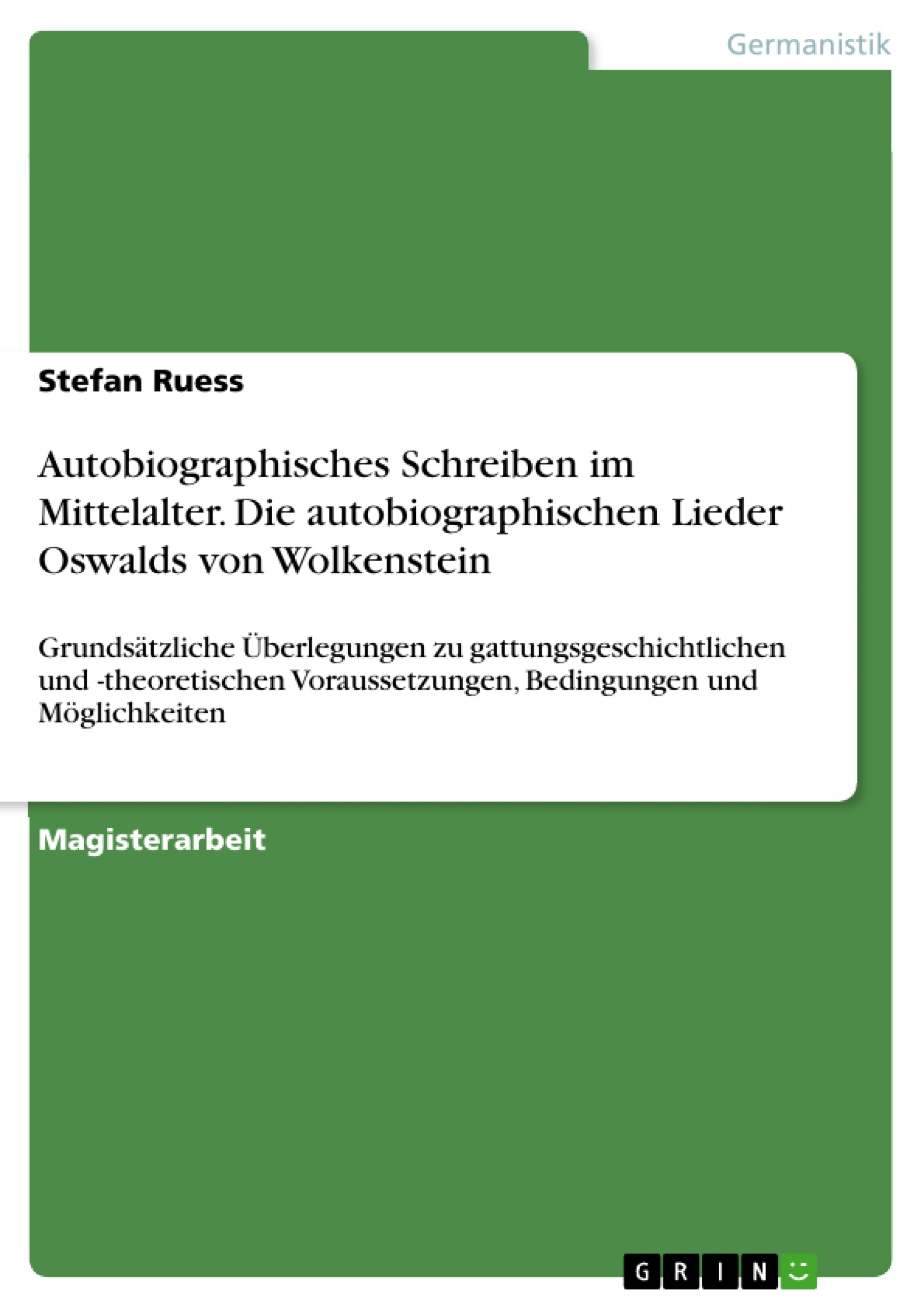Anstoß zur Thematik vorliegender Arbeit, das
Autobiographische in seiner spezifischen Ausprägung bei
Oswald von Wolkenstein näher zu untersuchen, war ein
anfängliches, instinktives Unbehagen, den Terminus
"autobiographisch" auf die lyrische Dichtung eines
spätmittelalterlichen Autors angewandt zu sehen.(1) Die
erste Überlegung war, das vieles, was in Oswalds Lyrik
der vorschnellen Zuschreibung des Autobiographischen
unterliegt, der literarischen Tradition verpflichtet
sein müsse, etwa so, wie es CURTIUS in seiner Geschichte
der mittelalterlichen Topik untersucht hat.(2) Ich nahm an,
daß das lyrische Ich, welches in Oswalds Dichtung zum
Vorschein kommt, ein irgendwie stilisiertes sein müßte,
das nicht mit dem realen Ich des Dichters übereinstimmt.
Diese Annahme hing eng zusammen mit einer zweiten
Überlegung, daß nämlich der Gattungsnahme "Autobiographie" eine neuzeitliche Prägung ist und die Anfänge der literarischen Gattung meist im 18.Jahrhundert gesucht werden.(3)
Die Vorstellung, die somit in uns auftaucht, wenn wir den Begriff
"Autobiographie" oder "autobiographisch" hören, ist ganz
wesentlich vom 'klassischen' Zeitalter der Gattung im
18. und 19.Jahrhundert beeinflußt. Daraus folgt, daß wir
Gefahr laufen, ein bestimmtes Verständnis, das im
Begriff "autobiographisch" seit jener Zeit mitschwingt,
auf ein Zeitalter zu übertragen, dessen geistiggeschichtliche
Voraussetzungen andere waren.(4) Bedingungen und Möglichkeiten autobiographischen Schreibens mußten deshalb ebenfalls verschieden sein.
[...]
______
1 Vgl. MÜLLER, U.: "Wahrheit" und "Dichtung", S.1:[...]
2 CURTIUS: Europäische Literatur.
3 Während für die Autobiographie ohne künstlerischen Anspruch das
16.Jahrhundert als Zeitalter der Gattungsgenese betrachtet wird. Eine
Ausnahme bildet die italienische Tradition der Renaissance.
4 "Heute ist 'Autobiographie' ein gängiger, umfassender Begriff
für alle denkbaren literarischen und nicht-literarischen Formen der
Lebensbeschreibung und der Selbstdarstellung geworden. Trotzdem haftet ihm auch die modellhafte Vorstellung einer auf die Entwicklung der Persönlichkeit konzentrierte Lebensbeschreibung an.", VELTEN: Leben, S.8.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- TEIL 1: DIE AUTOBIOGRAPHIE ALS GATTUNG
- A. Forschungsbericht zur Autobiographie
- B. Zur Entwicklung der Autobiographik - Stationen der Gattungsgeschichte
- 1. Die religiöse Autobiographik
- a) Die Confessiones des Augustinus
- b) Die deutsche Mystik
- 2. Die weltliche Autobiographik
- 3. Renaissance und Barock
- 4. Die religiöse Autobiographik des Pietismus
- 5. Die klassische Zeit der Autobiographie
- a) Jean-Jacques Rousseau
- b) Johann Wolfgang von Goethe
- 6. Die Autobiographik im 19. und 20. Jahrhundert
- 1. Die religiöse Autobiographik
- TEIL 2: DAS MITTELALTER ALS BEDINGUNGSRAHMEN FÜR AUTOBIOGRAPHISCHES SCHREIBEN
- A. Historische Voraussetzungen und Zugangsweisen
- 1. Historische Bedingtheit der Subjektivität
- a) Historische Distanz und Annäherungsversuche
- b) Historischer Wandel der Mentalitäten
- c) Historische Anthropologie
- 1. Historische Bedingtheit der Subjektivität
- B. Das Autobiographische im Mittelalter
- 1. Zur Forschungslage
- 2. Überlegungen zur Begrifflichkeit von Autobiographie im Mittelalter
- 3. Stationen der Gattungsgeschichte im Mittelalter
- a) Vita, Legende und Confessiones
- b) Abälard
- c) Autobiographik im späteren Mittelalter
- d) Frauendienst
- A. Historische Voraussetzungen und Zugangsweisen
- TEIL 3: DIE "AUTOBIOGRAPHISCHE LYRIK" OSWALDS VON WOLKENSTEIN
- A. Exkurs: Zur Forschung zu Oswald von Wolkenstein
- B. Versuch einer Definition des Autobiographischen im Mittelalter
- C. Darstellungsdispositionen des Autobiographischen im Mittelalter
- 1. Weltliche und geistliche Autobiographik unter formalen Gesichtspunkten
- 2. Oswalds Alterslieder - Variationen geistlicher Autobiographik
- 3. Die autobiographische Mitteilung
- a) der autobiographische Beweis
- 4. Die Handlungs-Autobiographie
- 5. Die Darstellung eines einzelnen Ereignisses innerhalb der autobiographischen Lyrik Oswalds von Wolkenstein
- 6. Räumliche und zeitliche Disposition der Verlaufsform von Handlungs-Autobiographie
- 7. Typenstammbaum für das Autobiographische im Mittelalter
- D. Die "autobiographische Lyrik" Oswalds im Kontext wesentlicher Einflußfaktoren
- 1. Dichtung und Wahrheit - ein zulässiger Dualismus bei der Bewertung von Kunstwerken
- 2. "Realismus" im Spätmittelalter und bei Oswald?
- 3. Oswalds autobiographische Lyrik als Erlebnisdichtung?
- 4. Das Problem des lyrischen Ichs
- 5. Oswalds Namensnennung und ihre Bedeutung für seine autobiographischen Lieder
- 6. Exkurs: Die mittelhochdeutsche Lyrik als Darstellungsrahmen des Autobiographischen im Mittelalter
- 7. "Autobiographische Lieder" und Publikum
- 8. "Autobiographische Lieder" - Motivation und Funktion
- 9. Artistik und literarische Kompetenz als Primärimpetus für autobiographisches Schreiben bei Oswald
- E. Zusammenfassung und Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Anwendung des Begriffs "autobiographisch" auf die lyrische Dichtung Oswalds von Wolkenstein. Sie hinterfragt die gängige Annahme einer direkten Übereinstimmung zwischen lyrischem Ich und realem Autor und beleuchtet die gattungsgeschichtlichen und -theoretischen Voraussetzungen autobiographischen Schreibens im Mittelalter. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Bedingungen und Möglichkeiten autobiographischen Schreibens im Kontext der spätmittelalterlichen Literatur.
- Gattungsgeschichte der Autobiographie vom Mittelalter bis zur Neuzeit
- Definition und Abgrenzung des "Autobiographischen" im Mittelalter
- Analyse der "autobiographischen Lieder" Oswalds von Wolkenstein
- Untersuchung des Verhältnisses von Dichtung und Wahrheit in Oswalds Werk
- Kontextualisierung von Oswalds Lyrik innerhalb der spätmittelalterlichen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangshypothese der Arbeit, die den gängigen Gebrauch des Begriffs "autobiographisch" in Bezug auf Oswalds Lieder hinterfragt und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise betont. Sie verweist auf die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung eines neuzeitlichen Begriffs auf mittelalterliche Texte ergeben.
TEIL 1: DIE AUTOBIOGRAPHIE ALS GATTUNG: Dieser Teil bietet einen umfassenden Überblick über die Gattungsgeschichte der Autobiographie von ihren religiösen Ursprüngen (Augustinus' Confessiones, deutsche Mystik) bis zur Neuzeit. Er skizziert die Entwicklung der weltlichen Autobiographie, ihre Blütezeit in der klassischen Periode (Rousseau, Goethe) und die weitere Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse von Oswalds Werk.
TEIL 2: DAS MITTELALTER ALS BEDINGUNGSRAHMEN FÜR AUTOBIOGRAPHISCHES SCHREIBEN: Dieser Teil untersucht die historischen und kulturellen Bedingungen für autobiographisches Schreiben im Mittelalter. Er analysiert die Entwicklung der Subjektivität und die Herausforderungen, die sich aus der historischen Distanz bei der Interpretation mittelalterlicher Texte ergeben. Der Teil beleuchtet verschiedene Formen autobiographischen Ausdrucks im Mittelalter, von Viten und Legenden bis zu Familienbüchern und Reisebeschreibungen.
TEIL 3: DIE "AUTOBIOGRAPHISCHE LYRIK" OSWALDS VON WOLKENSTEIN: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Analyse der Lyrik Oswalds von Wolkenstein. Er beinhaltet eine Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur, einen Versuch der Definition von "autobiographisch" im Kontext des Mittelalters, und die Analyse der verschiedenen Darstellungsformen des Autobiographischen in Oswalds Werk. Der Teil untersucht Oswalds Lieder im Kontext wesentlicher Einflussfaktoren und diskutiert Fragen des "Realismus", des lyrischen Ichs und der Funktion seiner Lieder.
Schlüsselwörter
Oswald von Wolkenstein, Autobiographie, Mittelalter, Lyrik, Gattungsgeschichte, Spätmittelalter, Lyrisches Ich, Dichtung und Wahrheit, Erlebnisdichtung, mittelhochdeutsche Lyrik, Autobiographische Lieder.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Die ‚autobiographische Lyrik‘ Oswalds von Wolkenstein"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anwendung des Begriffs "autobiographisch" auf die lyrische Dichtung Oswalds von Wolkenstein. Sie hinterfragt die gängige Annahme einer direkten Übereinstimmung zwischen lyrischem Ich und realem Autor und beleuchtet die gattungsgeschichtlichen und -theoretischen Voraussetzungen autobiographischen Schreibens im Mittelalter. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Bedingungen und Möglichkeiten autobiographischen Schreibens im Kontext der spätmittelalterlichen Literatur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Gattungsgeschichte der Autobiographie vom Mittelalter bis zur Neuzeit, die Definition und Abgrenzung des "Autobiographischen" im Mittelalter, die Analyse der "autobiographischen Lieder" Oswalds von Wolkenstein, die Untersuchung des Verhältnisses von Dichtung und Wahrheit in Oswalds Werk und die Kontextualisierung von Oswalds Lyrik innerhalb der spätmittelalterlichen Literatur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Teil 1 bietet einen Überblick über die Gattungsgeschichte der Autobiographie. Teil 2 untersucht die historischen und kulturellen Bedingungen für autobiographisches Schreiben im Mittelalter. Teil 3 konzentriert sich auf die Analyse der Lyrik Oswalds von Wolkenstein, einschließlich einer Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur und der Analyse verschiedener Darstellungsformen des Autobiographischen in seinem Werk.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit hinterfragt den gängigen Gebrauch des Begriffs "autobiographisch" in Bezug auf Oswalds Lieder und betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise. Sie untersucht die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung eines neuzeitlichen Begriffs auf mittelalterliche Texte ergeben und analysiert die verschiedenen Formen autobiographischen Ausdrucks im Mittelalter.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Forschungsliteratur zu Oswald von Wolkenstein und zur Autobiographie im Mittelalter. Sie analysiert die Lieder Oswalds von Wolkenstein selbst und setzt diese in den Kontext der spätmittelalterlichen Literatur.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Anwendung des Begriffs "autobiographisch" auf die Lyrik Oswalds von Wolkenstein und liefert eine differenzierte Betrachtungsweise des Verhältnisses zwischen lyrischem Ich und realem Autor im Kontext des Mittelalters. Die Ergebnisse werden im letzten Kapitel zusammengefasst.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Oswald von Wolkenstein, Autobiographie, Mittelalter, Lyrik, Gattungsgeschichte, Spätmittelalter, Lyrisches Ich, Dichtung und Wahrheit, Erlebnisdichtung, mittelhochdeutsche Lyrik und Autobiographische Lieder.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studenten der Germanistik, Literaturwissenschaft, Mittelalterforschung und alle, die sich für Oswald von Wolkenstein, mittelalterliche Literatur und die Gattungsgeschichte der Autobiographie interessieren.
- Arbeit zitieren
- Stefan Ruess (Autor:in), 1997, Autobiographisches Schreiben im Mittelalter. Die autobiographischen Lieder Oswalds von Wolkenstein, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1160