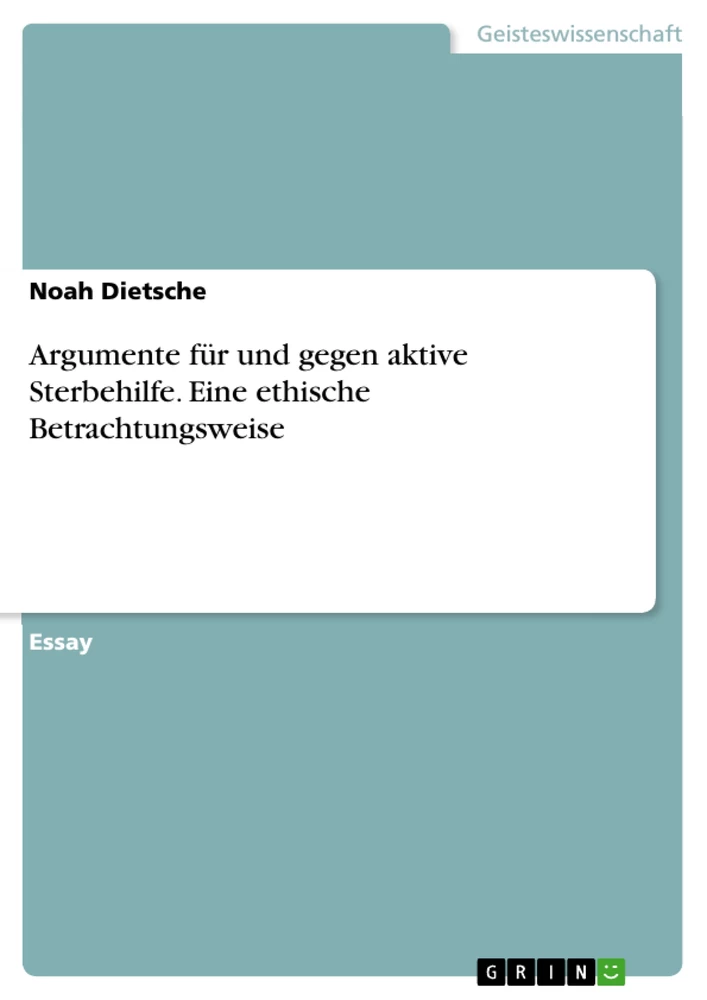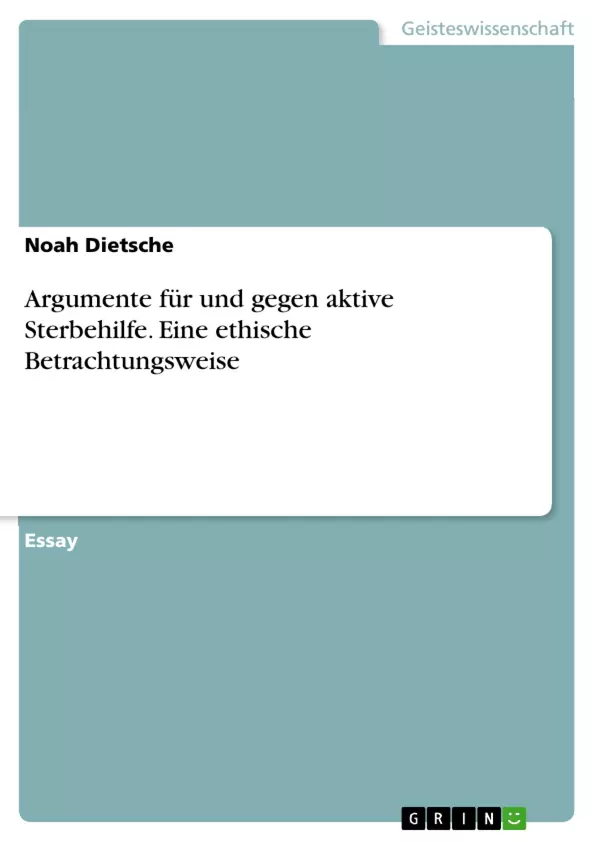Die Frage, ob das Verbot der Tötung auf Verlangen aufgehoben werden sollte, ist Gegenstand vieler Diskussionen und beschäftigt nicht nur Juristen und Ärzte, sondern auch Ethiker und Philosophen. In der folgenden Arbeit sollen Für- und Gegenargumente aus ethischer Sicht betrachtet und erläutert werden.
Dank des anhaltenden medizinischen Fortschritts und einer immer besser werdenden Behandlung und Betreuung ist es heute einer Vielzahl von Menschen möglich ein vergleichsweise hohes Alter zu erreichen, wodurch die durchschnittliche Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich stieg. Doch nicht immer bedeutet dies, dass die letzten Jahre eines Lebens gesund, erfüllend und für die Betroffenen wünschenswert sind. Zwar mag der Tod durch Medikamente und Therapien hinausgezögert werden können, damit kann jedoch ein langwieriger und qualvoller Sterbensprozess verbunden sein. Zudem gibt es Krankheiten, bei denen eine Heilung nicht absehbar oder gar unmöglich ist. Solche Patienten haben täglich mit Schmerzen und Einschränkungen zu kämpfen, die die Lebensqualität soweit beeinträchtigen, dass einige Menschen die Art und den Zeitpunkt ihres Todes selbst bestimmen möchten.
Während in Deutschland die Tötung auf Verlangen gesetzlich verboten, und somit eine aktive Sterbehilfe nicht angeboten werden kann, ist diese in Ländern wie Belgien, den Niederlanden oder der Schweiz legal. Unter der aktiven Sterbehilfe, oder auch Euthanasie genannt, versteht man Handlungen, die den Tod eines Menschen gezielt herbeiführen sollen. Erforderlich dazu ist die ausdrückliche oder auch mutmaßliche Einwilligung des Kranken. In der Regel wird dabei vom Arzt eine tödliche Spritze injiziert oder eine Überdosis verabreicht. Abzugrenzen ist die aktive von der passiven Sterbehilfe. Bei der passiven werden lebenserhaltende Maßnahmen unterlassen, die Krankheit nimmt ungehindert ihren Verlauf und der Patient wird „sterben gelassen“. Bei dem assistierten Suizid verschafft der Arzt ein todbringendes Mittel, welches nicht verabreicht, sondern selbst genommen werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG UND BEGRIFFSERLÄUTERUNG
- 2 WAS GEGEN DIE AKTIVE STERBEHILFE SPRICHT
- 3 GRÜNDE FÜR EINE LEGITIMATION DER AKTIVEN STERBEHILFE
- 4 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob die aktive Sterbehilfe, also die gezielte Herbeiführung des Todes eines Menschen durch einen Arzt, ethisch vertretbar und somit legalisiert werden sollte. Sie setzt sich mit Argumenten gegen und für die Legalisierung auseinander und beleuchtet dabei insbesondere die ethischen Dimensionen.
- Die ethische Verantwortung von Ärzten im Kontext von Sterbehilfe.
- Die Autonomie des Patienten und das Recht auf Selbstbestimmung über den Tod.
- Die Rolle der Gesellschaft und die moralischen Werte in der Sterbehilfedebatte.
- Die Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe.
- Die Frage nach der Unantastbarkeit des Lebens und dem Recht auf Leben.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Begriffserläuterung
Das Kapitel führt in die Thematik der aktiven Sterbehilfe ein und erläutert den Begriff der Sterbehilfe sowie deren Unterschiede zur passiven Sterbehilfe und dem assistierten Suizid. Es stellt außerdem die aktuelle rechtliche Situation in Deutschland dar, die die aktive Sterbehilfe verbietet.
2 Was gegen die aktive Sterbehilfe spricht
Dieser Abschnitt untersucht die Argumente gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Es werden ethische Bedenken hinsichtlich der Rolle des Arztes und die Gefahr der Missbrauchs von Sterbehilfe durch Druck und soziale Zwänge aufgezeigt. Zudem wird die Bedeutung der unantastbaren Würde des Menschen und die Wichtigkeit von Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen betont.
3 Gründe für eine Legitimation der aktiven Sterbehilfe
Dieser Abschnitt präsentiert die Argumente für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Er beleuchtet die ethische Gleichwertigkeit von aktiver und passiver Sterbehilfe aus Sicht des Betroffenen und argumentiert, dass die Autonomie des Patienten und sein Recht auf Selbstbestimmung über den Tod respektiert werden sollten. Außerdem wird auf die Wichtigkeit der Motive des Arztes im Rahmen der Sterbehilfe eingegangen.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, assistierter Suizid, Euthanasie, Selbstbestimmung, Autonomie, ethische Verantwortung, Arzt, Patient, Lebensqualität, Tod, Gesellschaft, Moral, Ethik, Recht, Lebensrecht, Würde.
- Citation du texte
- Noah Dietsche (Auteur), 2020, Argumente für und gegen aktive Sterbehilfe. Eine ethische Betrachtungsweise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1160982