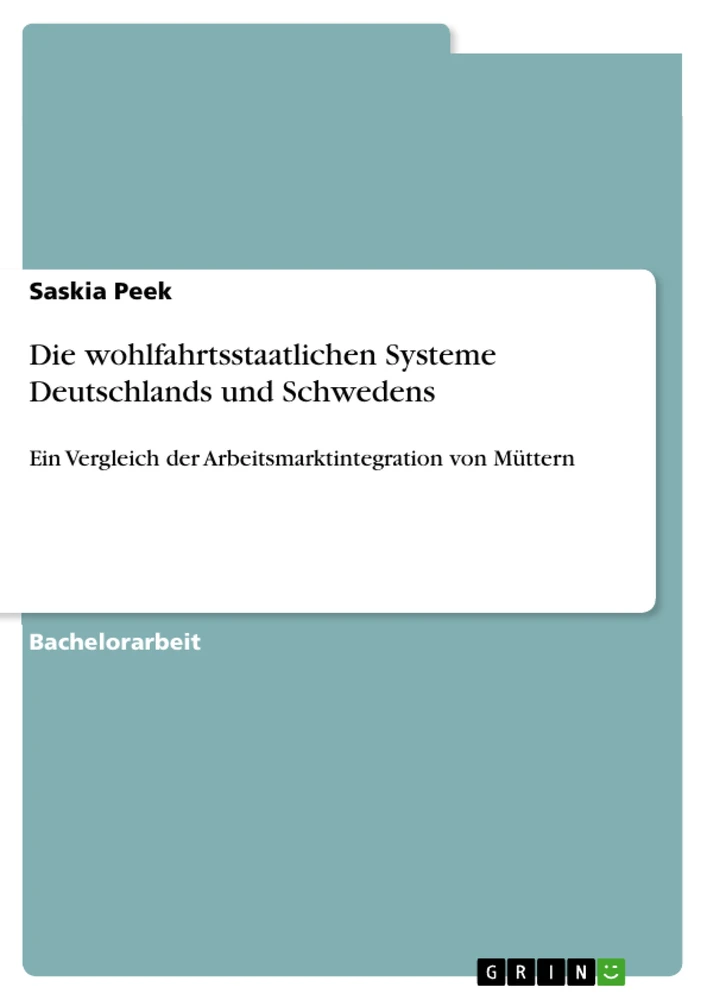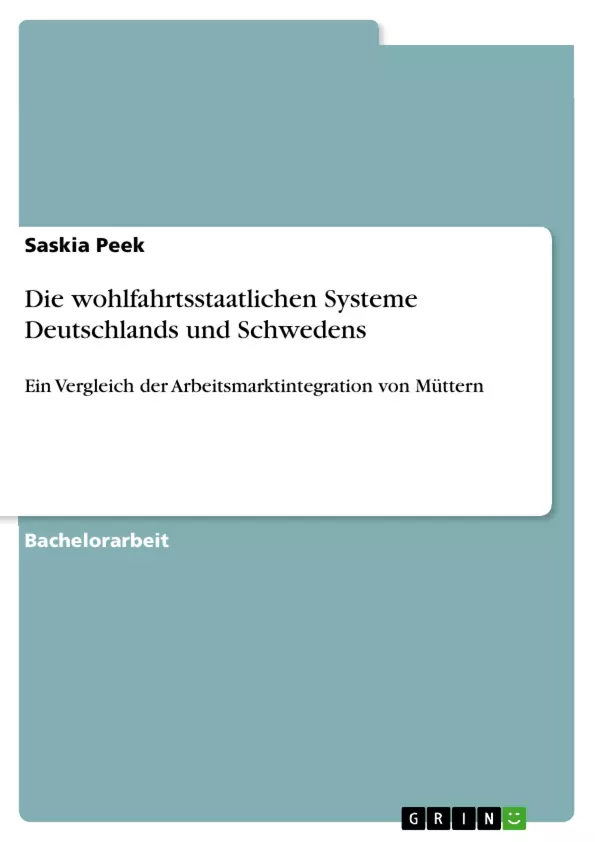Diese Bachelorarbeit verfolgt das Ziel, zu analysieren, welche Folgen die Ausgestaltung von Familienpolitik auf die Erwerbsintegration von Müttern hat. Dies soll exemplarisch am Beispiel der Länder Deutschland und Schweden nachvollzogen werden. Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist ein systematischer Vergleich, wodurch geklärt werden soll, wie die Länder auf nahezu identische Problemlagen innerhalb ihrer jeweiligen wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen reagieren. Dabei gilt es zu beachten, dass es nicht ausschließlich die Familienpolitik ist, welche maßgebend für die Erwerbsintegration von Müttern ist. Auch der Einfluss der Familienpolitik und der Arbeitsmarktpolitik sowie das Verhältnis der individuellen Geschlechterregime werden als maßgebende Faktoren berücksichtigt.
Ziel der Arbeit ist es, den kulturellen Einfluss auf die Konzipierung von Geschlechterregimen zu durchleuchten und zu analysieren, inwiefern das Geschlechterregime ein Teilaspekt für die Erwerbsintegration von Müttern am Arbeitsmarkt sein kann. Als Explanans der Forschung dient das Steuerungsinstrument Anspruch auf Teilzeit entsprechend der Dimension Zeit Leistungen. Die exemplarisch gewählten Länder Deutschland und Schweden bieten Instrumente mit sehr ähnlichen Rahmenbedingungen an, um Familien die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienleben zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Stand der Forschung
- Methodischer Zugang
- Aufbau
- Konzeptioneller Rahmen und theoretische Einbettung
- Wohlfahrtsstaatliche Grundmodelle
- Feministisch-kritische Perspektive
- Deutschland
- Deutschland: ein konservativ-korporatistisches Modell
- Die ökonomische Funktionalität der Familie
- Tatsächliche Effekte der Teilzeit
- Schweden
- Schweden: Ein sozialdemokratisches Modell
- Die Trendwende der 1970er Jahre
- Emanzipation als Sicherheit
- Analyse der staatlichen Systeme Deutschlands und Schwedens
- Vergleiche der sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen
- Anreize und Restriktionen
- Einfluss der Kultur auf das Wohlfahrtsstaatsmodell
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen der Familienpolitik auf die Erwerbsintegration von Müttern zu untersuchen, indem ein Vergleich zwischen Deutschland und Schweden durchgeführt wird. Der Fokus liegt dabei auf einem systematischen Vergleich der beiden Länder, um herauszufinden, wie sie auf ähnliche Problemlagen im Kontext ihrer jeweiligen wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen reagieren. Die Arbeit geht jedoch über die reine Familienpolitik hinaus und berücksichtigt auch die Arbeitsmarktpolitik, das Verhältnis der individuellen Geschlechterregime und den kulturellen Einfluss auf die Konzipierung von Geschlechterregimen.
- Der Einfluss der Familienpolitik auf die Erwerbsintegration von Müttern in Deutschland und Schweden
- Der Vergleich der wohlfahrtsstaatlichen Modelle Deutschlands und Schwedens im Kontext der Arbeitsmarktintegration von Müttern
- Die Rolle des Geschlechterregimes und des kulturellen Einflusses auf die Erwerbsintegration von Müttern
- Die Analyse von Anreizen und Restriktionen für Mütter im Arbeitsmarkt in Deutschland und Schweden
- Die Bedeutung der Familienpolitik für die Überwindung sozialer Ungleichheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Erwerbsintegration von Müttern in Deutschland und Schweden ein. Sie beleuchtet den Wandel der Rolle der Frau in beiden Gesellschaften und die Herausforderungen, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt begegnen. Die Forschungsfrage der Arbeit wird formuliert und der methodische Zugang sowie der Aufbau der Arbeit werden vorgestellt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem konzeptionellen Rahmen und der theoretischen Einbettung der Arbeit. Es werden die wohlfahrtsstaatlichen Grundmodelle sowie die feministisch-kritische Perspektive auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft behandelt. Die Kapitel 3 und 4 beleuchten Deutschland und Schweden im Detail. Es werden die jeweiligen wohlfahrtsstaatlichen Modelle, die Familienpolitik sowie die Auswirkungen auf die Erwerbsintegration von Müttern analysiert. Dabei werden auch die kulturellen Einflüsse auf die Geschlechterregime betrachtet.
Das fünfte Kapitel vergleicht die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, die Anreize und Restriktionen sowie den kulturellen Einfluss auf das Wohlfahrtsstaatsmodell in Deutschland und Schweden. Es wird untersucht, inwiefern die jeweiligen Rahmenbedingungen die Erwerbsintegration von Müttern beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Erwerbsintegration von Müttern, den wohlfahrtsstaatlichen Modellen in Deutschland und Schweden, der Familienpolitik, dem Geschlechterregime, der kulturellen Einflüsse auf die Geschlechterrollen und der Bedeutung von Anreizen und Restriktionen im Arbeitsmarkt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Bachelorarbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen der Familienpolitik auf die Erwerbsintegration von Müttern am Beispiel von Deutschland und Schweden systematisch zu vergleichen.
Welche Wohlfahrtsstaat-Modelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das konservativ-korporatistische Modell Deutschlands mit dem sozialdemokratischen Modell Schwedens.
Welche Faktoren beeinflussen die Erwerbsintegration von Müttern laut der Studie?
Neben der Familienpolitik werden auch die Arbeitsmarktpolitik, individuelle Geschlechterregime und kulturelle Einflüsse als maßgebende Faktoren berücksichtigt.
Was dient als Explanans der Forschung?
Als Steuerungsinstrument dient der Anspruch auf Teilzeit entsprechend der Dimension der Zeit-Leistungen.
Welche Rolle spielt die Kultur in den Modellen?
Die Arbeit analysiert, wie kulturelle Einflüsse die Konzipierung von Geschlechterregimen prägen und dadurch die Integration von Müttern am Arbeitsmarkt beeinflussen.
- Citation du texte
- Saskia Peek (Auteur), 2021, Die wohlfahrtsstaatlichen Systeme Deutschlands und Schwedens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1162245