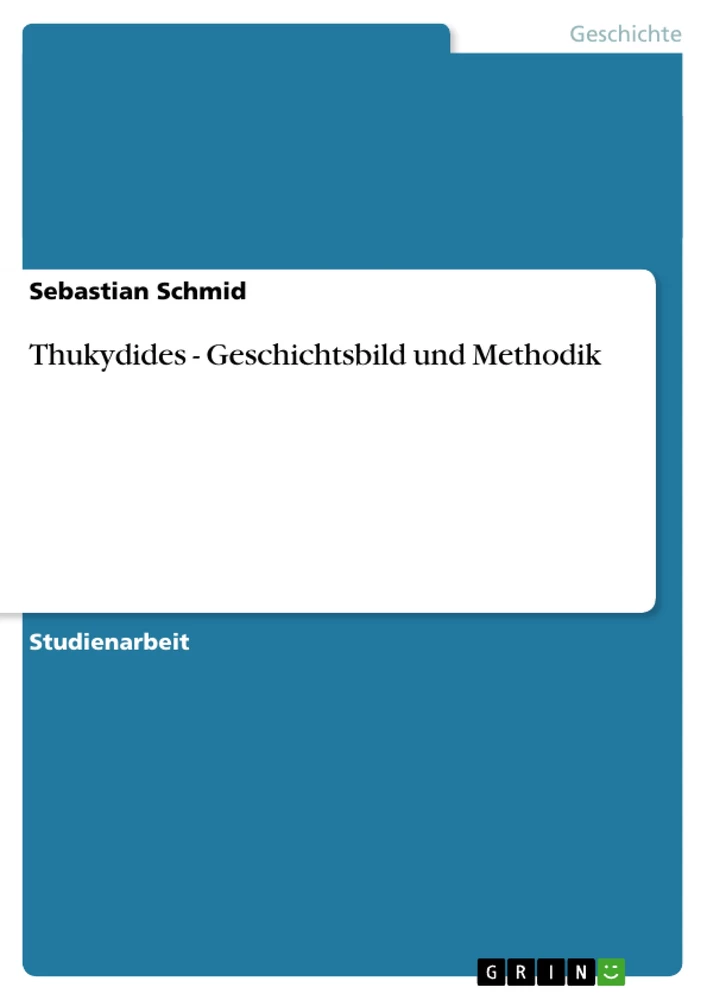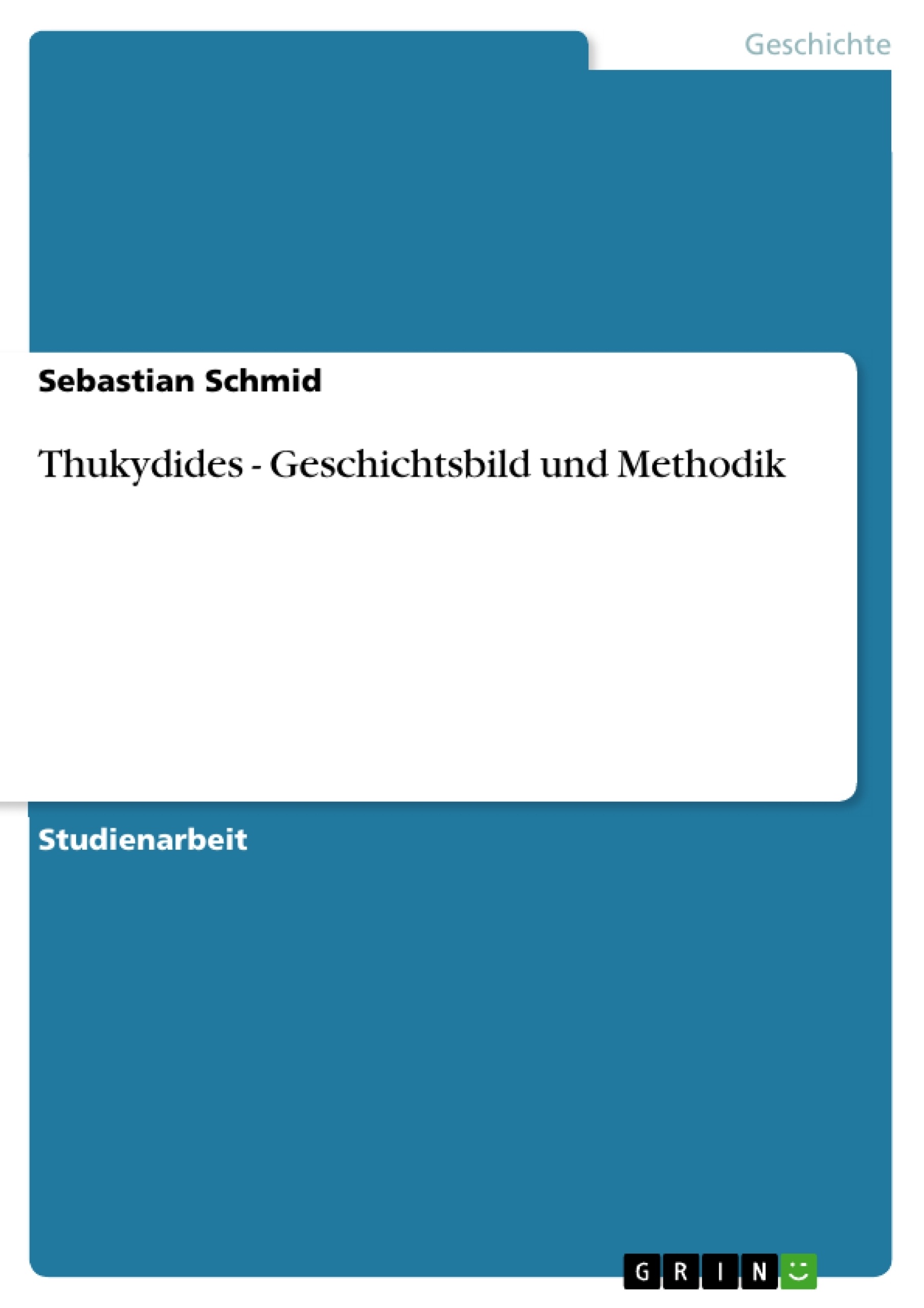Das Geschichtswerk des Thukydides gilt heute als Beginn der Geschichtsschreibung und der antike Historiker als Initiator der modernen Geschichtswissenschaft. Bezeichnet man Herodot als Vater der Geschichtsschreibung, so kann man seinen Nachfolger Thukydides als den Vater der realistischen, wissenschaftlichen und politischen Geschichte bezeichnen. Ohne Herodot ist die Leistung des zweiten großen Historikers des antiken Griechenlands zwar undenkbar, jedoch begründet dieser einen neuen Anfang im Vergleich zu seinem berühmten Vorgänger. Bogner bezeichnet Thukydides als den eigentlichen Beginn der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung und als „Gipfel der historischen Kunst der Griechen (wenn nicht der historischen Kunst überhaupt)“. Sein unvollendetes Werk über den Peloponnesischen Krieg ist zwar kein Geschichtswerk als Ganzes, aber sein Nachfolger Xenophon knüpft in seiner Hellenika direkt daran an.
Jedoch kamen in der Geschichtsforschung Zweifel an seiner Wissenschaftlichkeit auf. Thukydides selbst bietet viele Anhaltspunkte für diese Zweifel, da er viele Dinge einfach ausläßt oder übergeht. Dabei darf nicht übersehen werden, daß Thukydides ausdrücklich die Kriegs- und Machtgeschichte zu seinem Thema gemacht hat.
Die Reihe von Vorwürfen seitens der Geschichtsforschung in bezug auf seine Wissenschaftlichkeit betreffen größtenteils sein Geschichtsverständnis und seine Methodik. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit soll sein Geschichts- und Menschenbild näher beleuchtet werden. Interessant ist hier auch die Frage nach möglichen Einflüssen auf sein Geschichtsverständnis. Der zweite Teil widmet sich der thukydideischen Methodik und der Frage nach seiner Wissenschaftlichkeit. Im dritten und letzten Abschnitt werden die Ergebnisse noch einmal zusammengefaßt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Geschichtsbild des Thukydides
- Die Methodik des Thukydides
- Zusammenfassung und Ergebnisse
- Literaturangabe
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Geschichtsbild und der Methodik des antiken griechischen Historikers Thukydides. Ziel ist es, sein Verständnis von Geschichte und seine Arbeitsweise zu beleuchten, um seine Einordnung in den Kontext der Geschichtsschreibung zu verstehen.
- Das Geschichtsbild des Thukydides und seine möglichen Einflüsse
- Die Methodik von Thukydides und ihre wissenschaftliche Fundierung
- Die Frage nach der Wissenschaftlichkeit von Thukydides’ Werk
- Die Rolle des Peloponnesischen Krieges in Thukydides’ Geschichtsverständnis
- Die Bedeutung von Thukydides’ Werk für die Entwicklung der Geschichtsschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das Geschichtswerk des Thukydides wird als Beginn der Geschichtsschreibung und als Initiator der modernen Geschichtswissenschaft bezeichnet. Thukydides wird als der Vater der realistischen, wissenschaftlichen und politischen Geschichte angesehen, der einen neuen Anfang im Vergleich zu seinem Vorgänger Herodot begründete.
Das Geschichtsbild des Thukydides
Dieses Kapitel befasst sich mit der Biographie von Thukydides und untersucht, ob sich in seinem Lebenslauf Hinweise auf Ereignisse finden lassen, die sein Geschichtsbild geprägt haben könnten. Thukydides stammte aus einer politisch ambitionierten Aristokratenfamilie Athens und war zu Beginn des Peloponnesischen Krieges noch verhältnismäßig jung. Er war Stratege und besaß einen gewissen materiellen Reichtum, der ihm eine gewisse Unabhängigkeit bescherte.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Thukydides als Vater der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung?
Thukydides begründete einen realistischen und politischen Ansatz, der sich auf Fakten und Kausalzusammenhänge konzentriert, anstatt mythische Erklärungen heranzuziehen.
Wie unterscheidet sich Thukydides von Herodot?
Während Herodot oft als erzählender „Vater der Geschichtsschreibung“ gilt, verfolgte Thukydides eine strengere, methodisch fundierte Analyse von Macht und Krieg.
Was war das Hauptthema des Thukydides?
Sein zentrales, wenn auch unvollendetes Werk befasst sich mit dem Peloponnesischen Krieg zwischen Athen und Sparta.
Welche Zweifel gibt es an seiner Wissenschaftlichkeit?
Einige Forscher kritisieren, dass Thukydides bestimmte Ereignisse bewusst ausließ oder überging, was Fragen nach seiner Objektivität und Vollständigkeit aufwirft.
Wie beeinflusste seine Herkunft sein Geschichtsbild?
Als Mitglied einer aristokratischen Familie und ehemaliger Stratege verfügte er über politischen Einblick und finanzielle Unabhängigkeit, was seine realistische Sicht auf Machtpolitik prägte.
- Citation du texte
- Sebastian Schmid (Auteur), 2001, Thukydides - Geschichtsbild und Methodik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11631