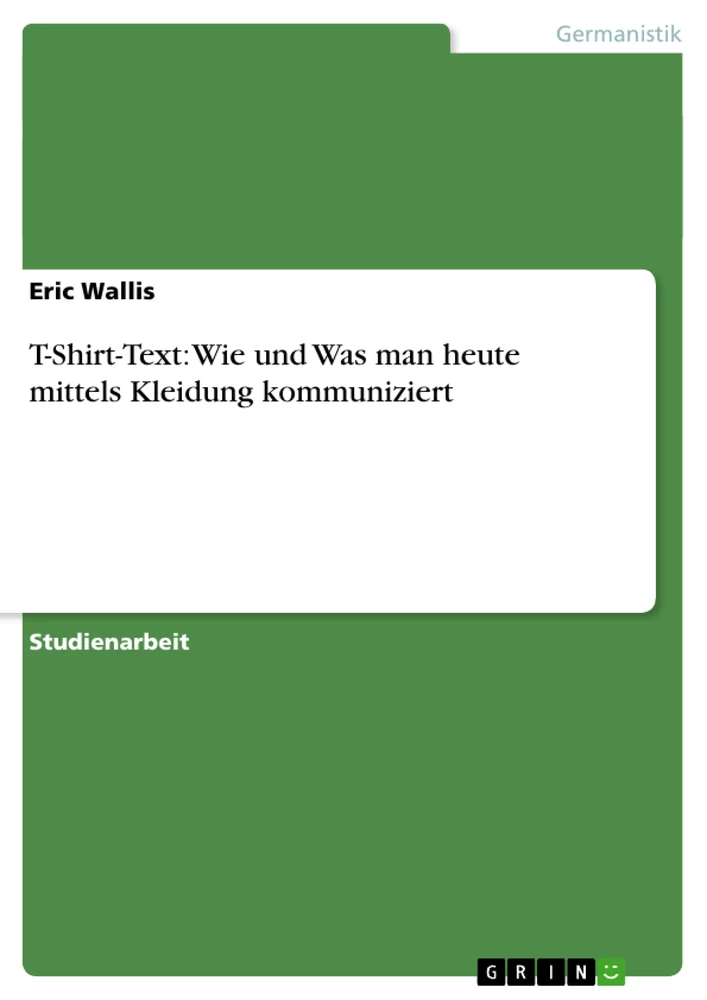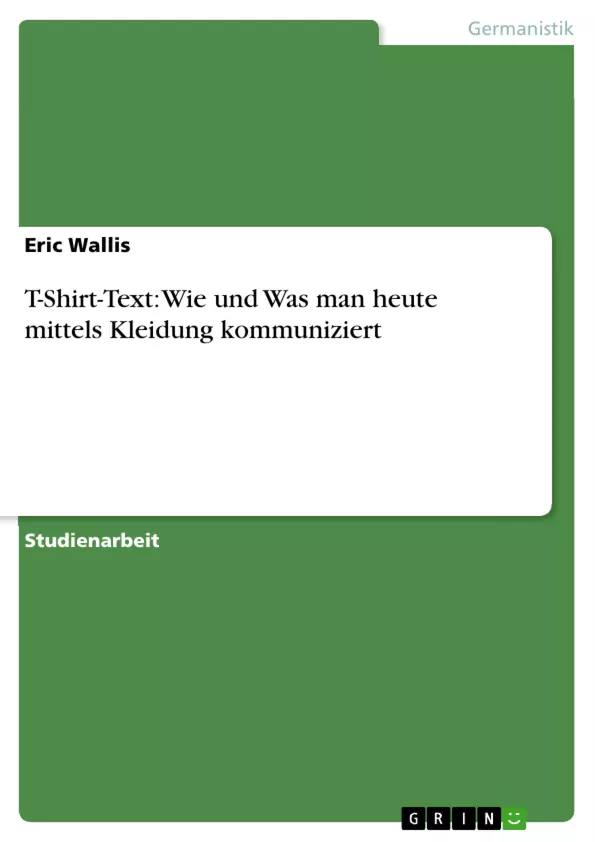Das Phänomen, dass sich der Autor der vorliegenden Arbeit zur Aufgabe gemacht hat, zu untersuchen heißt: Text-auf-T-Shirt. Marketingexperten haben zumindest für einen Teil dieses Phänomens den kürzeren und einprägsameren Begriff Funshirt gefunden. Gemeint sind damit T-Shirts mit irgendwie lustigen Aussagen, um die es in der vorliegenden Arbeit im Wesentlichen gehen soll.
Dabei beschränkt sich das Phänomen nicht auf die Deutsche oder die Europäische Gesellschaft, sondern kursiert weltweit. Kluge Geschäftleute müssen also einer wirtschaftsanalytischen Betrachtung folgend einen Bedarf erkannt und beliefert haben, den es immer noch zu beliefern gilt, denn die große öffentliche Verbreitung betexteter T-Shirts ist so unbestreit- wie wahrnehmbar. Anlass genug, das T-Shirt auch zum Gegenstand einer linguistischen Untersuchung zu machen, was mit der vorliegenden Arbeit geleistet werden soll.
Zuerst soll dabei die allgemeine aber unvermeidliche Frage beantwortet werden, warum der Mensch ein Kleidungsstück auswählt, um Text, dessen Aussagekraft erfahrungsgemäß weit über die Vermittlung ästhetischer Informationen hinausgeht, darauf zu applizieren. Wie kommt man dazu oder besser: Was verleitet dazu? Was bietet das T-Shirt, das andere Kleidungstücke nicht haben? Daraus ergeben sich weitere Fragen: Was will der Mensch mit seinem T-Shirt aussagen? Was ist das überhaupt; ein Mensch mit einem Text auf dem T-Shirt? Wen will er erreichen (wenn er jemanden erreichen will)? Was ist das für eine Art von Text auf dem T-Shirt, handelt es sich dabei um eine Textsorte? Gibt es gemeinsame Merkmale aller dieser Texte?
Nachdem sie nun gestellt worden sind, so soll es im Folgenden dazu kommen auf all diese Fragen entsprechende Antworten zu finden. Schon jetzt sei auf den dieser Arbeit anhängenden, stichprobenartig gewonnenen Korpus hingewiesen, der einerseits einen Überblick über die Variabilität des Gegenstandes Funshirt geben soll, anderseits dient er der Merkmalsanalyse, und wird damit auch Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Die allgemeine Ortung des Phänomens
- 2.1 Zielsetzung.
- 2.2 Die Beziehung von Platz und Masse oder: Warum man sprachliche Zeichen auf T-Shirts unterbringen kann
- 2.3 Oberfläche als Spielwiese und damit verbundene Zeichenhaftigkeit
- 3. Warum Text eine einführende Betrachtung.
- 4. Auf den Spuren einer Textsorte
- 4.1. Einführung
- 4.2 T-Shirt als Medium
- 4.3 kommunikativ-pragmatisches Textmodell – Suche nach dem Zweck.
- 4.3 Transporteure des Mitzuverstehenden - propositionale Aspekte und der Unterschied zwischen Meinen und Verstehen.
- 4.4 sprachliche Merkmale als Spediteure des Mitzuverstehenden
- 4.4.1 Hyperbel
- 4.4.2 Ellipse.
- 4.4.1.1 Transporteure der Übertreibung - graphostilistische Mittel
- 4.4.3 Polysemie
- 4.4.5 Intertextualität.
- 4.5 Der situative Aspekt als Übermittler des Mitzuverstehenden
- 4.5.1 Der Zweck der Funshirt-Kommunikation
- 4.5.2 systemtheoretische Annäherung.
- 4.6 Die Textsorte
- 5. Auf Lustig sein folgt Lachen - Perlokutive Betrachtung.
- 5.1 Auf Lachen folgt ...? - eine weitere perlokutive Betrachtung.
- 6. Zusammenfassung und Schluss.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Phänomen "Text-auf-T-Shirt", insbesondere den Einsatz von lustigen Aussagen auf T-Shirts, auch bekannt als "Funshirts". Die Arbeit beleuchtet die Gründe für die Verbreitung dieses Phänomens und analysiert die sprachlichen und kommunikativen Aspekte der Funshirt-Kommunikation.
- Die Rolle des T-Shirts als Medium für Textkommunikation
- Die sprachlichen Merkmale von Funshirt-Texten
- Die kommunikative Funktion von Funshirts
- Die Textsorte "Funshirt"
- Die perlokutive Wirkung von Funshirt-Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Phänomen "Text-auf-T-Shirt" vor und formuliert die Forschungsfragen der Arbeit. Kapitel 2 analysiert die allgemeine Ortung des Phänomens, indem es die Rolle von "Platz" und "Masse" sowie die Bedeutung der Oberfläche als Spielwiese für Zeichenhaftigkeit beleuchtet. Kapitel 3 bietet eine einführende Betrachtung des Textes und seiner Funktionen. Kapitel 4 befasst sich mit der Textsorte "Funshirt" und untersucht die sprachlichen und kommunikativen Merkmale sowie den situativen Aspekt der Funshirt-Kommunikation. Kapitel 5 analysiert die perlokutive Wirkung von Funshirt-Texten, also die beabsichtigte Wirkung auf den Empfänger. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und Schlussfolgerung.
Schlüsselwörter
Funshirt, Textkommunikation, Kleidungsstück, Sprache, Kommunikation, Textsorte, Perlokution, Hyperbel, Ellipse, Polysemie, Intertextualität, situativer Aspekt, Systemtheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Funshirt“?
Funshirts sind T-Shirts mit lustigen oder provokanten Aussagen, die über die rein ästhetische Information hinaus sprachliche Zeichen und Botschaften vermitteln.
Warum eignet sich das T-Shirt besonders als Textmedium?
Das T-Shirt bietet eine gut sichtbare Oberfläche („Spielwiese“), die als Medium für die Massenkommunikation im öffentlichen Raum fungiert.
Welche sprachlichen Mittel werden auf Funshirts genutzt?
Häufig zum Einsatz kommen Hyperbeln (Übertreibungen), Ellipsen (Satzverkürzungen), Polysemie (Mehrdeutigkeit) und Intertextualität.
Was ist der Zweck der Funshirt-Kommunikation?
Der Zweck liegt oft in der Selbstdarstellung, der Erzeugung von Humor oder der Abgrenzung zu bestimmten Gruppen durch „Mitzuverstehendes“.
Gibt es eine eigene Textsorte für T-Shirt-Sprüche?
Die linguistische Untersuchung analysiert, ob die spezifischen Merkmale dieser Texte ausreichen, um sie als eigenständige Textsorte zu definieren.
- Arbeit zitieren
- Eric Wallis (Autor:in), 2007, T-Shirt-Text: Wie und Was man heute mittels Kleidung kommuniziert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116415