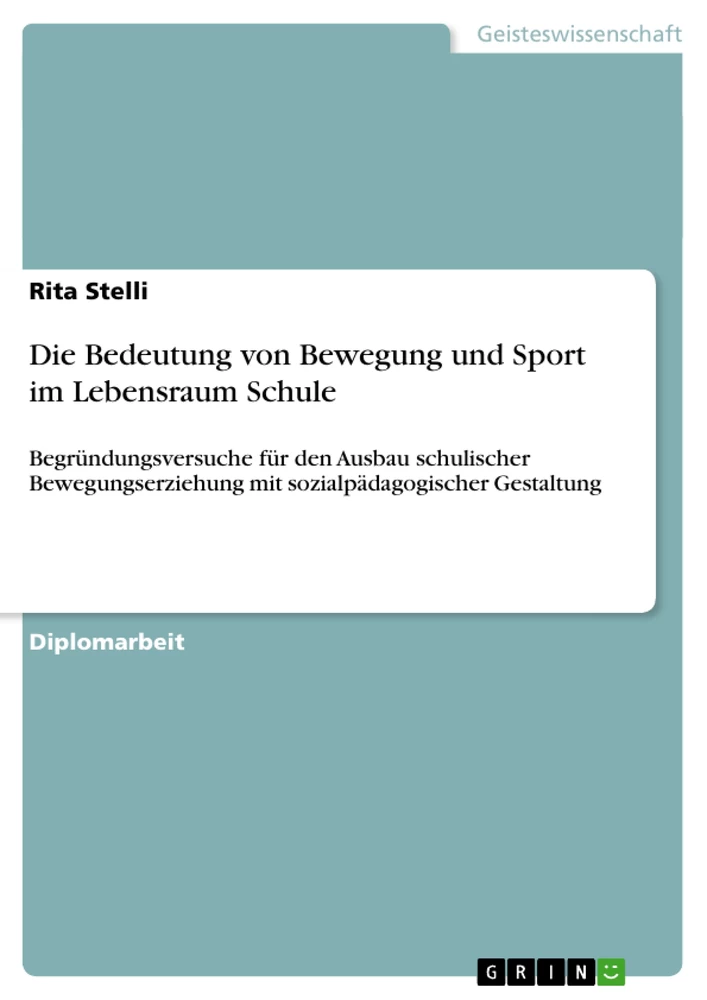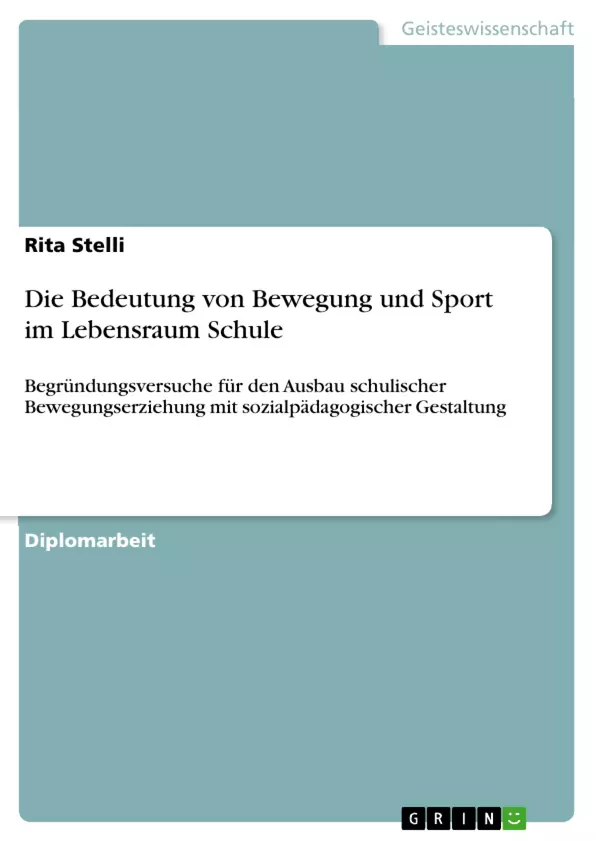Diese Arbeit soll dazu dienen, zunächst aus der Sicht der Sportpädagogik und auf der Grundlage von Erkenntnissen der Körper- und Bewegungsanthropologie sowie entwicklungspsychologischen Betrachtungen aufzuzeigen, was Bewegung, Spiel und Sport für die kindliche Entwicklung bedeuten können. Da die körperbezogenen Entwicklungen von Kindern und Jugendlichen, nicht isoliert verlaufen, sondern mit anderen Entwicklungsbereichen verbunden sind und sich wechselseitig beeinflussen, werden entsprechende Beziehungen hergestellt. Gefragt wird immer wieder nach den Zusammenhängen von sportlicher Aktivität und Aspekten der personalen, sozialen, motorischen und kognitiven Entwicklung und nach möglichen Effekten auf diesen Ebenen.
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, welche kindlichen Ressourcen durch Bewegung hervorgerufen und gestärkt werden können und inwieweit diese mit sozialpädagogischen Handlungsansätzen korrespondieren und im Kontext schulischer Bildung ergänzt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1.1 Persönliche Motivation
- 1.2 Zielsetzung und Fragestellung der Arbeit
- 1.3 Abgrenzung der verwendeten Begriffe
- II. Merkmale modernisierter Kindheit
- 2.1 Die veränderten Lebensbedingungen des Aufwachsens von Kindern
- 2.2 Merkmale der Bewegungswelt heutiger Kinder
- 2.2.1 Lebensräume moderner Kindheit
- 2.2.2 Bewegungsarme Kindheit?
- 2.3 Das Modell der Salutogenese
- III. Die Bedeutung von Bewegung, Spiel und Sport für die kindliche Entwicklung
- 3.1 Zur Funktion von Bewegungserfahrungen für die kindliche Entwicklung
- 3.2 Wirkungen von Bewegung auf die kognitive Entwicklung des Kindes
- 3.2.1 Welche Effekte von Bewegungsförderung gibt es in Bildungseinrichtungen auf die Lernleistung?
- 3.3 Entwicklung des Selbst - Bewegungs- und Körpererfahrungen prägen das Selbstkonzept
- 3.3.1 Erfahrung durch Bewegung
- 3.3.2 Sportliche Aktivität und Selbstkonzept
- 3.3.3 Identitätsbildende Prozesse im Sport
- 3.3.4 Der Leistungsbegriff im Sport
- 3.4 Wirkungen von Bewegung auf das soziale Handeln der Kinder
- 3.4.1 Sozialerziehung – ein Auftrag der Schule?
- IV. Erfahrungsraum GanztagsSchule
- 4.1 Der Trend der Ganztagsschulen
- 4.2 Mehrwert der Schule
- 4.2.1 Bewegungsbezogene Gesichter der Schule
- 4.2.2 Wie lassen sich moderne Konzepte der Bewegungsförderung in der Schule umsetzen?
- 4.3 Erkenntnisse zum Thema Bewegte Grundschule
- 4.4 Modellbeispiel einer Ganztagsgrundschule
- V. Bewegte Schulen aus der Perspektive von Kindern
- 5.1 Warum wollen sich Kinder in der Schule bewegen?
- 5.2 Was stellen sich Kinder unter einer „Bewegten Schule“ vor?
- 5.2.1 Möglichkeiten von Bewegung, Spiel und Sport im Klassenzimmerunterricht aus Kindersicht
- 5.2.2 Die Rolle der Lehrkraft im Klassenzimmerunterricht
- 5.3 Kinderideen zum Sportunterricht
- 5.3.1 Möglichkeiten von Bewegung, Spiel und Sport im Sportunterricht aus der Kinderperspektive
- 5.3.2 Die Rolle der Lehrkraft im Sportunterricht
- 5.4 Der Spaßfaktor als Hauptbeweggrund in der Schule
- VI. Beweggründe der Sozialpädagogik
- 6.1 Bewegungsbezogene Sozialpädagogik
- 6.2 Reflexive Bewegungserfahrungen als Erziehungsziel
- 6.3 Perspektiven und Handlungsfelder sozialpädagogischer Arbeit in Schulen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Bewegung und Sport im Lebensraum Schule und untersucht die Begründungsversuche für den Ausbau schulischer Bewegungserziehung mit sozialpädagogischer Gestaltung. Die Arbeit analysiert die veränderten Lebensbedingungen heutiger Kinder und die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung sowie die Rolle von Bewegung, Spiel und Sport in diesem Kontext.
- Die Bedeutung von Bewegung für die kindliche Entwicklung
- Die Auswirkungen von Bewegung auf die kognitive und soziale Entwicklung
- Die Rolle der Schule als Erfahrungsraum für Bewegung und Sport
- Die Perspektive von Kindern auf Bewegung und Sport in der Schule
- Die Beweggründe der Sozialpädagogik für den Ausbau schulischer Bewegungserziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die persönliche Motivation der Autorin sowie die Zielsetzung und Fragestellung der Arbeit. Kapitel II untersucht die Merkmale modernisierter Kindheit, die veränderten Lebensbedingungen des Aufwachsens von Kindern und die Merkmale der Bewegungswelt heutiger Kinder. Kapitel III befasst sich mit der Bedeutung von Bewegung, Spiel und Sport für die kindliche Entwicklung und analysiert die Auswirkungen von Bewegung auf die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung. Kapitel IV beleuchtet den Erfahrungsraum Ganztagsschule und die Möglichkeiten der Bewegungsförderung in diesem Kontext. Kapitel V betrachtet die Perspektive von Kindern auf Bewegung und Sport in der Schule und beleuchtet ihre Wünsche und Bedürfnisse. Kapitel VI befasst sich mit den Beweggründen der Sozialpädagogik für den Ausbau schulischer Bewegungserziehung und den Handlungsfeldern sozialpädagogischer Arbeit in Schulen.
Schlüsselwörter
Bewegung, Sport, Schule, Sozialpädagogik, Kindliche Entwicklung, Ganztagsschule, Bewegungsförderung, Lebensraum, Selbstkonzept, Soziales Handeln, Pädagogische Praxis, Bewegte Schule.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat Bewegung für die kognitive Entwicklung von Kindern?
Bewegung fördert die Lernleistung und ist eng mit der kognitiven Entwicklung verknüpft, da körperliche Erfahrungen die neuronale Vernetzung unterstützen.
Was versteht man unter einer „Bewegten Schule“?
Ein Konzept, bei dem Bewegung, Spiel und Sport in den gesamten Schulalltag integriert werden, nicht nur im Sportunterricht, sondern auch im Klassenzimmer.
Wie beeinflusst Sport das Selbstkonzept von Kindern?
Durch Körper- und Bewegungserfahrungen entwickeln Kinder ein Bewusstsein für ihre eigenen Fähigkeiten, was maßgeblich zur Identitätsbildung beiträgt.
Welche Rolle spielt die Ganztagsschule für die Bewegungsförderung?
Die Ganztagsschule bietet mehr Zeit und Raum, um moderne Konzepte der Bewegungsförderung und sozialpädagogische Ansätze umzusetzen.
Was ist das Modell der Salutogenese in diesem Kontext?
Das Modell der Salutogenese betrachtet Faktoren, die zur Gesundheit beitragen. Bewegung wird hier als wichtige Ressource für das Wohlbefinden von Kindern gesehen.
- Quote paper
- Rita Stelli (Author), 2007, Die Bedeutung von Bewegung und Sport im Lebensraum Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116517