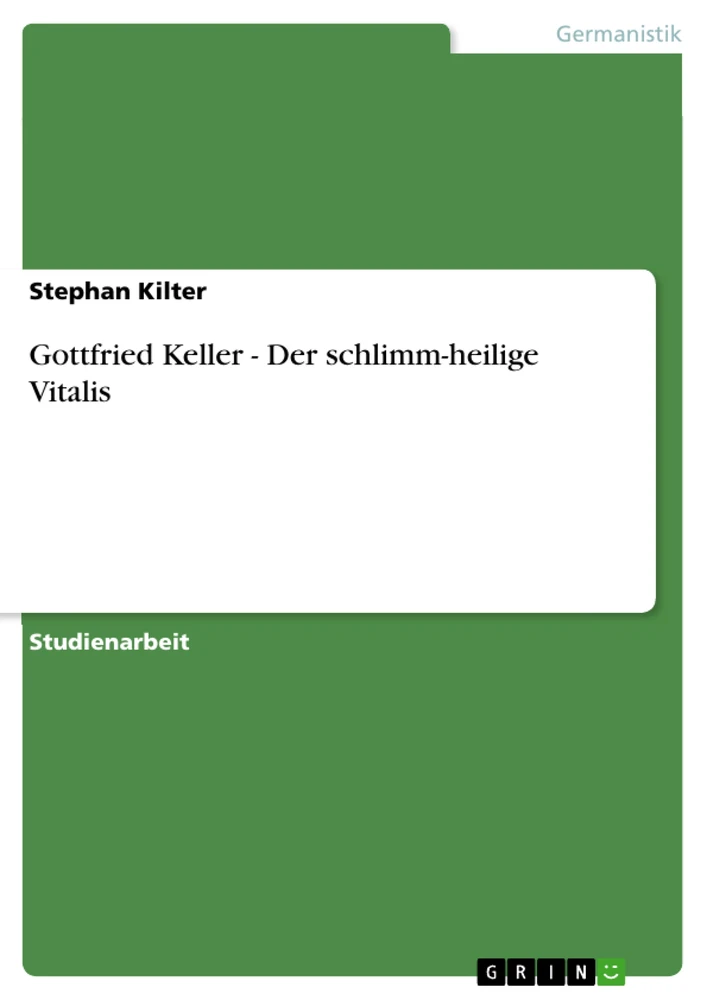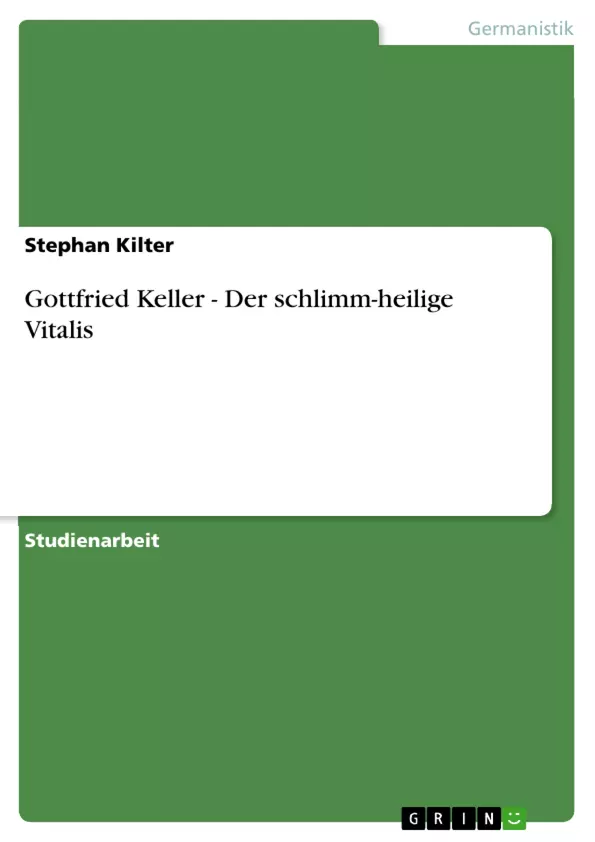An der Erzählung Gottfried Kellers Der schlimm-heilige Vitalis, Teil der Sieben Legenden, die er während seiner Berliner Zeit entwarf , aber erst viel später veröffentlichte, erscheinen viele Aspekte bemerkenswert. Mit Hilfe seines heiteren wie humorvollen, dabei aber stets hintergründig kritischen Schreibstils, vermochte er es, der traditionell-kirchlichen Legendenvorlage Ludwig Theobul Kosegartens neues Leben einzuhauchen und diese somit in die Moderne zu transferieren. Kellers Verhältnis zur Religion, sein Frauenbild, aber auch sein Bedürfnis nach Erfüllung privaten Glücks in der harmonisch-reinen Beziehung zwischen Mann und Frau, in dem er seinen eigenen, trostlosen und von der Liebe enttäuschten Berliner Alltag verarbeitete, kommen deutlich in den Sieben Legenden zum Ausdruck und finden sich teilweise auch im „schlimm-heiligen Vitalis“ wieder. Jeden dieser Fäden aufzugreifen und angemessen zur Geltung kommen zu lassen, würde den Rahmen dieser Hauptseminarsarbeit aber bei weitem überschreiten, so dass wir uns in erster Linie auf den religiösen Gehalt der Legende konzentrieren wollen. Darauf aufbauend einen genaueren Blick auf Kellers Einstellung zur Religion werfen zu können, soll denn auch den Zielpunkt dieser Arbeit darstellen.
Natürlich darf bei alledem nicht vergessen werden, in vorherigen Abschnitten zunächst eine grobe Einordnung der Erzählung in den Gesamtkontext der „Sieben Legenden“ vorzunehmen, deren Aufbau und Entstehungsgeschichte kurz zu skizzieren, daneben aber auch auf die Form, Sprache, den Stil und die symbolischen Bezüge der Vitalis-Erzählung einzugehen.
Der Auftakt zur Beschäftigung mit Kellers Einstellung gegenüber Kirche und Religion wird mit der Betrachtung des ursprünglichen, historischen Ortes der Handlung, Alexandria, nebst seiner Hauptpersonen, dem heiligen Vitalis von Gaza und dem heiligen Erzbischof Johannes von Alexandrien, erfolgen, um gleich danach mit einer Charakterisierung der Kellerschen Legendenhauptperson fortzufahren und dessen Zwiespalt zwischen kirchlicher Tugendliebe und unterdrückter Weltlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse sollen schließlich in einem Fazit zusammengefasst und daneben aufgezeigt werden, an welcher Stelle die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas darüber hinaus umfangreicher fortgesetzt werden könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kellers „Sieben Legenden“
- Entstehungsgeschichte
- Zeitgenössische Rezension
- Inhalt und Form
- Der Schlimm-heilige Vitalis
- Inhalt und Form
- Sprache, Stil und symbolische Bezüge
- Mittelalterliches Legendenvorbild:„Von St. Johannes dem Almosner“
- Der religiöse Gehalt der Vitalis-Legende
- Exkurs: Der historische Ort Alexandria
- Charakterisierung Vitalis: Von der Religiosität seines Bekehrertreibens
- Kellers Religionskritik in den Sieben Legenden
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gottfried Kellers "Sieben Legenden", mit besonderem Fokus auf die Legende des Schlimm-heiligen Vitalis. Sie befasst sich mit der Entstehungsgeschichte der Legenden, analysiert die religiöse Kritik Kellers und beleuchtet, wie er die traditionellen Legendenformen neu interpretierte.
- Die Entstehungsgeschichte und Entwicklung von Kellers "Sieben Legenden"
- Die Beziehung zwischen Inhalt und Form in den Legenden
- Die Darstellung von Religiosität und Religionskritik in der Vitalis-Legende
- Die Verbindung von traditioneller Legendenform und modernem Erzählkunst
- Die Analyse von Sprache, Stil und Symbolen in Kellers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Arbeit und die Zielsetzung. Kapitel II erörtert die Entstehungsgeschichte der "Sieben Legenden", inklusive der zeitgenössischen Rezensionen und formalen Aspekte. Kapitel III analysiert die Legende des Schlimm-heiligen Vitalis, fokussiert auf Inhalt, Form, Sprache, Stil und symbolische Bezüge. Der Vergleich mit der Vorlage von Ludwig Theobul Kosegarten unterstreicht die kreative Neuinterpretation des Themas durch Keller. Kapitel IV untersucht den religiösen Gehalt der Vitalis-Legende und beleuchtet Kellers Kritik an der Kirche und der traditionellen Glaubensvorstellungen, die sich in Sprache, Stil und Symbolen des Werkes niederschlägt. Schließlich fasst das Fazit die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Gottfried Kellers "Sieben Legenden", insbesondere der Vitalis-Legende. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Religionskritik, Tradition und Moderne, Glaube und Weltlichkeit, sowie die Analyse von Sprache, Stil und Symbolen. Weitere wichtige Aspekte sind die Entstehungsgeschichte und die Bedeutung der Vorlage für Kellers Werk.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Gottfried Kellers Erzählung „Der schlimm-heilige Vitalis“?
Die Erzählung handelt von einem Mönch, der versucht, Prostituierte zu bekehren, und dabei in einen Zwiespalt zwischen kirchlicher Tugend und weltlicher Liebe gerät.
Wie steht Gottfried Keller zur Religion in diesem Werk?
Keller nutzt einen humorvollen und kritischen Stil, um die traditionelle christliche Legende zu modernisieren und kirchliche Dogmen hintergründig zu hinterfragen.
Was sind die „Sieben Legenden“?
Es ist eine Sammlung von Erzählungen Kellers, in denen er religiöse Stoffe aufgreift und sie ins Weltliche transformiert, oft mit einem Fokus auf privates Glück.
Welche Vorlage nutzte Keller für den Vitalis?
Er orientierte sich an der Legendensammlung von Ludwig Theobul Kosegarten, hauchte ihr aber durch seinen eigenen Stil neues Leben ein.
Welche Rolle spielt der Schauplatz Alexandria?
Alexandria dient als historischer Ort der Handlung, der den Rahmen für das Aufeinandertreffen von Askese und städtischer Sündhaftigkeit bildet.
Was charakterisiert Kellers Schreibstil in den Legenden?
Sein Stil ist geprägt von Heiterkeit, Humor und einer feinen Ironie, die es erlaubt, ernste religiöse Themen menschlich und lebensnah darzustellen.
- Citar trabajo
- Stephan Kilter (Autor), 2005, Gottfried Keller - Der schlimm-heilige Vitalis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116616