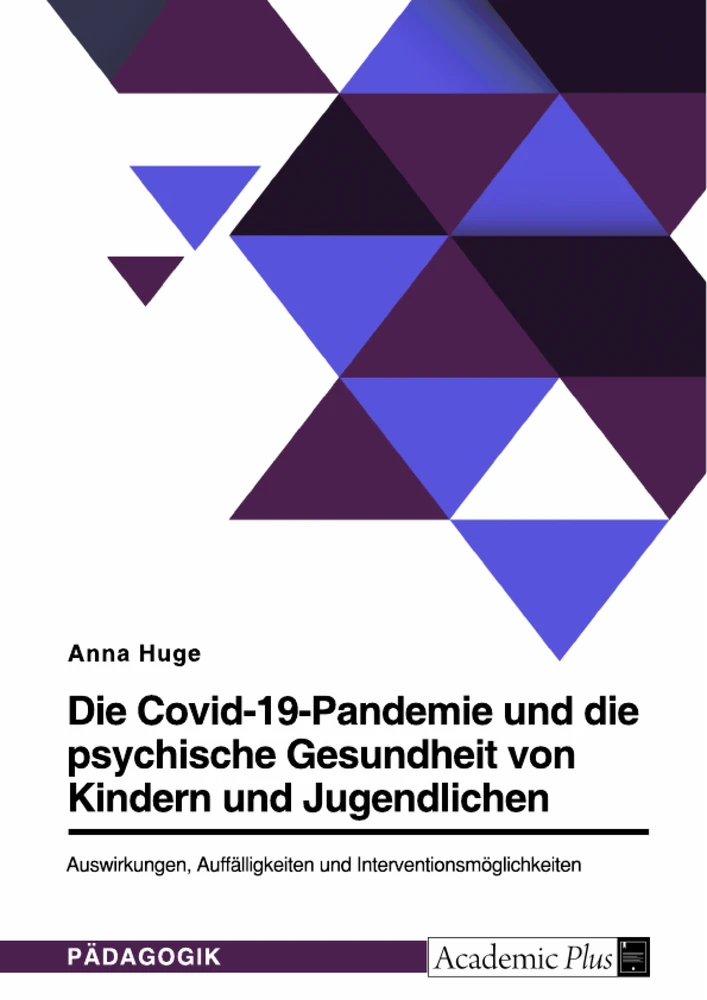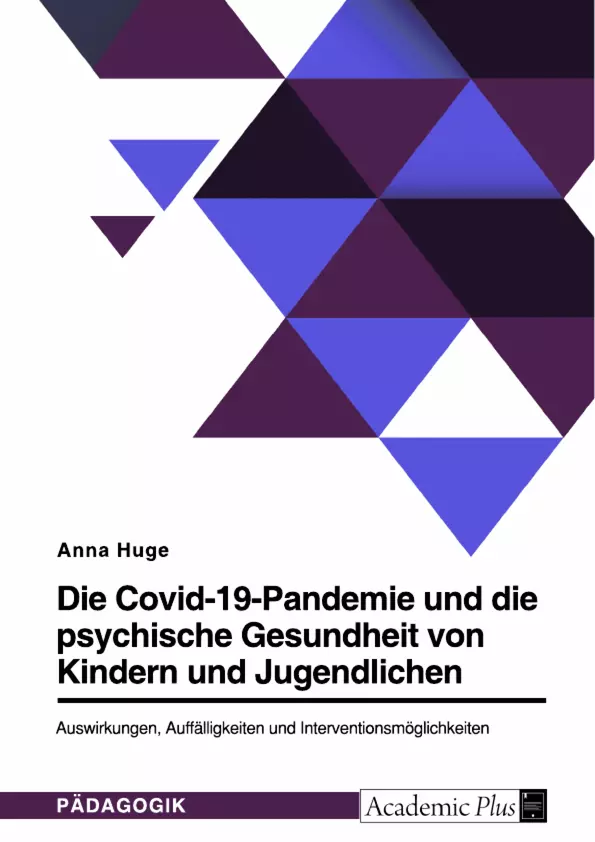Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird auf Basis präpandemischer Forschung erläutert. Dabei wird auf verschiedene veröffentlichte Studien zugegriffen. Schwerpunktmäßig auf die COPSY I und Copsy II-Studien vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Mit der COPSY-Studie erschien schon im ersten Pandemiejahr ein umfassender Überblick über den seelischen Gesundheitszustand von Schülerinnen und Schülern. Es folgten weitere Studien, die ein neues und dynamisches Forschungsfeld eröffneten. Neben all diesen neuen Erkenntnissen darf jedoch auch nicht der Blick auf die schon seit Jahren existierenden Kenntnisse namhafter Soziologen, Psychologen und Pädagogen wie beispielsweise Klaus Hurrelmann fehlen. Die Grundlagen der Sozialisation finden auch in diesem neueren Forschungsgebiet Anklang und liefern wesentliche Erkenntnisse.
Am Anfang der COVID-19-Pandemie gab es weltweit große Unsicherheiten. Was macht dieses Virus, ist es überhaupt gefährlich, welche Maßnahmen sind zur Eindämmung sinnvoll? Neben diesen fundamental wichtigen Fragen wurden global Maßnahmen wie Schulschließungen und Lockdowns beschlossen. Doch was wir immer noch nicht wissen ist, wie sich die Pandemie auf die Entwicklung und seelische Gesundheit junger Heranwachsender auswirkt, auch mit Blick auf mögliche langfristige Folgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinder und Jugendliche in Ausnahmesituationen
- Umgang mit kritischen Lebensereignissen
- Sozialisation in Isolation
- (Soziales) Lernen und Entwicklung in der Schule
- Leben und Lernen im Lockdown
- Schule während der Corona-Pandemie
- Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen im Lockdown
- Befunde zur seelischen Gesundheit
- Psychische Krankheiten in der Pandemie – Ergebnisse der COPSY-Studie
- BiB-Studie: Bestätigung von COPSY?
- Exkurs: Depressionen bei Kindern und Jugendlichen
- Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Vergleich
- Die BELLA-Studie
- Vergleich präpandemischer und pandemischer Auffälligkeiten
- Zwischenfazit: Psychische Auffälligkeiten in der Pandemie
- Umfeldbedingungen und Interventionsmöglichkeiten
- Kindeswohlgefährdung und familiäre Belastung im Lockdown
- Heterogenität in der Pandemie
- Zwischenfazit: (Schul-)VerliererInnen in der Pandemie
- Interventionsmöglichkeiten
- Diskussion & Fazit
- Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit beleuchtet die besonderen Herausforderungen, die die Pandemie für diese Altersgruppe mit sich bringt, und analysiert die Auswirkungen auf ihr soziales, emotionales und kognitives Wohlbefinden.
- Einfluss der Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Analyse der Faktoren, die zu psychischen Belastungen führen
- Untersuchung der Auswirkungen des Lockdowns auf die Entwicklung und das Lernen
- Bedeutung von Interventionen und Unterstützungsmöglichkeiten
- Diskussion der langfristigen Folgen der Pandemie für die psychische Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert den aktuellen Forschungsstand zu den Auswirkungen von Krisen und Ausnahmesituationen auf Kinder und Jugendliche. Kapitel 2 beleuchtet die Besonderheiten der Pandemie für diese Altersgruppe, insbesondere die Auswirkungen auf die Sozialisation, das Lernen und die Entwicklung. Das dritte Kapitel analysiert die Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen im Lockdown, mit einem Fokus auf die Veränderungen im Schulalltag und im Medienkonsum. Kapitel 4 präsentiert Befunde zu den psychischen Folgen der Pandemie, basierend auf relevanten Studien wie COPSY und BiB. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen werden im fünften Kapitel untersucht, wobei besonderes Augenmerk auf die Belastungen in Familien und die Heterogenität der Erfahrungen gelegt wird. Schließlich diskutieren die Ergebnisse und ziehen ein Fazit, welches die wichtigsten Erkenntnisse und Implikationen der Arbeit zusammenfasst.
Schlüsselwörter
COVID-19-Pandemie, Kinder, Jugendliche, psychische Gesundheit, Lockdown, Schule, Sozialisation, Entwicklung, Medienkonsum, psychische Belastung, Interventionen, Unterstützungsmöglichkeiten, Forschung, Studien, COPSY, BiB, BELLA.
- Citar trabajo
- Anna Huge (Autor), 2021, Die Covid-19-Pandemie und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Auswirkungen, Auffälligkeiten und Interventionsmöglichkeiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1167659