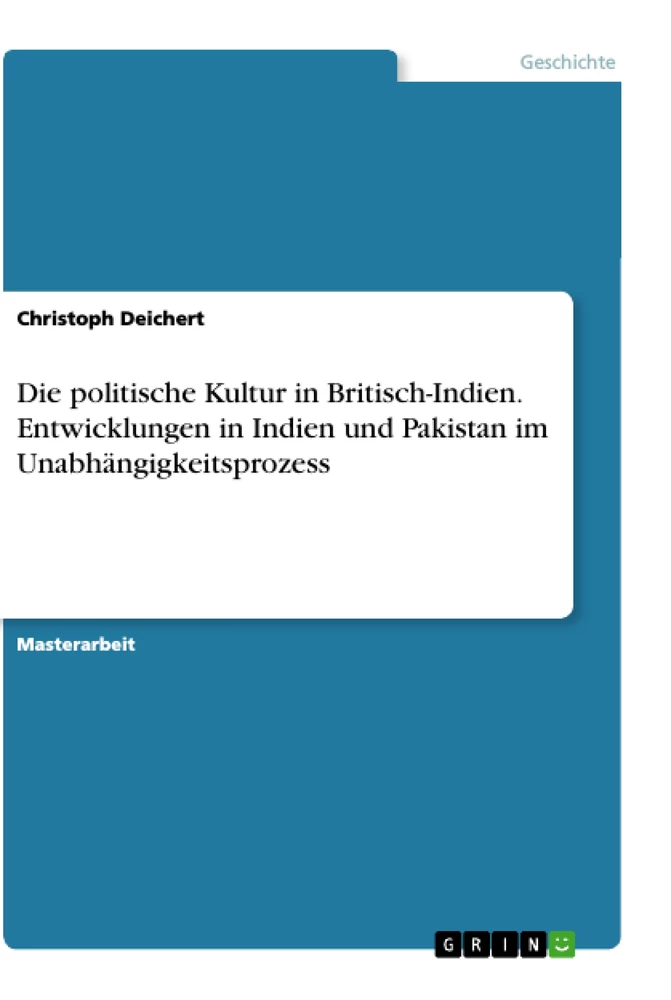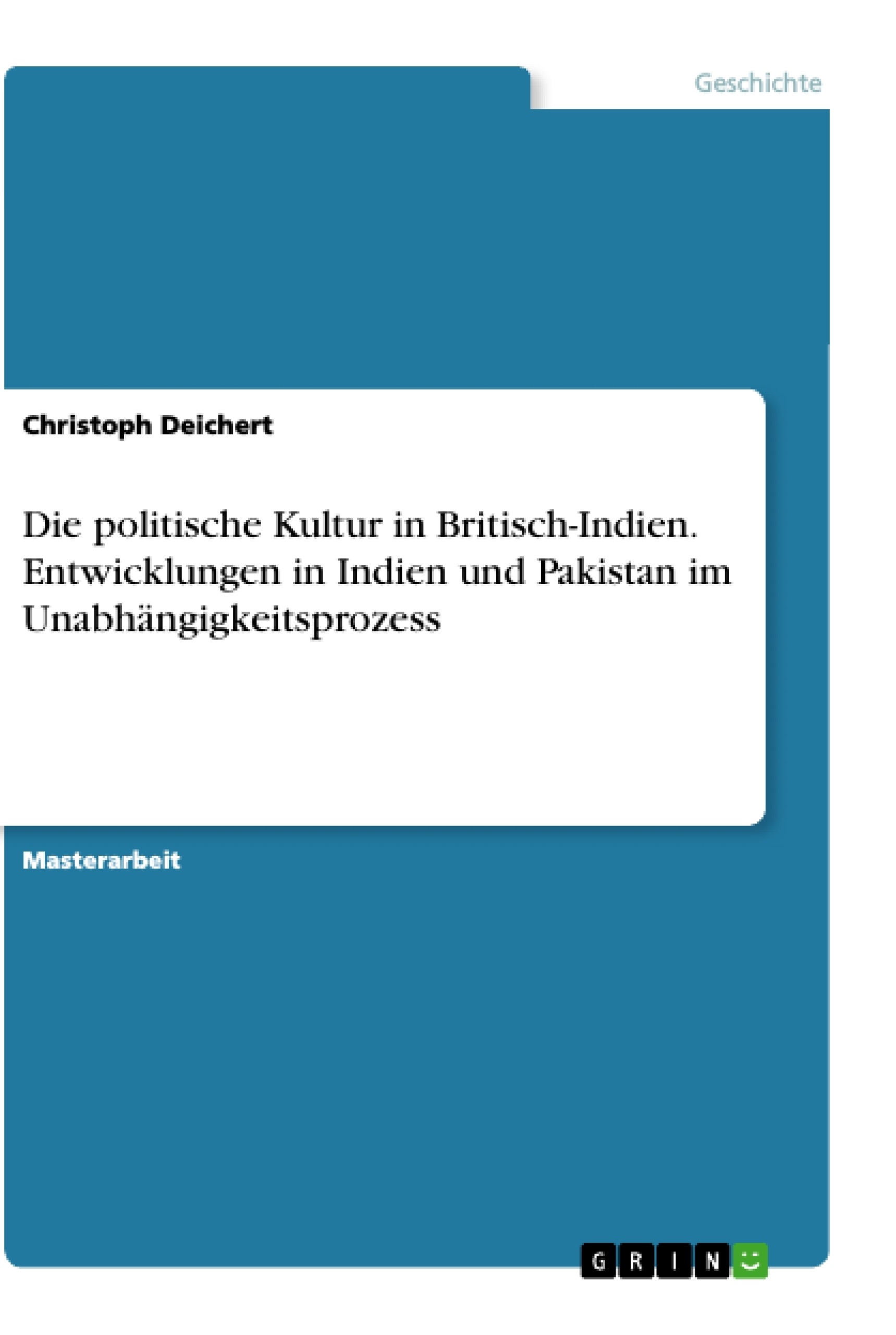Bereits mit der militärischen Revolution im 15. Jahrhundert zeichnete sich eine globale Dominanz der europäischen Mächte ab. Die Europäer stärkten ihre Befestigungen und entwickelten moderne Waffen wie Musketen und Kanonen. Weiterhin wurde durch das Militär die Logistik gestärkt und die soldatische Disziplin erhöht. Hinzukommt, dass mit dem zunehmenden Handelskapitalismus der Wunsch einherging, in aller Welt weitere Absatzmärkte und Rohstoffe zu erschließen. Als zusätzlicher Katalysator wirkte das eifernde Christentum mit seinen missionarischen Zielen.
Wobei die Kolonialisierung Indiens zunächst durch ein Privatunternehmen, die East India Company, welche 1600 gegründet wurde, herbeigeführt. Dieses Unternehmen war wie ein eigener Staat mit Waffen, Diplomaten, Soldaten eigener Währung und sogar mit einer eigenen Flagge organisiert. Ausgestattet mit dieser logistischen Infrastruktur bemächtigte man sich der Unterstützung einzelner indischer Fürsten, in dem man ihre Armeen schulte und sie andere Fürstentümer des Subkontinents erobern ließ. Im Jahr 1857 kam es mit dem Sepoy-Aufstand zu einer Meuterei solcher Truppen. In der Folge wurde dieser Aufstand von der britischen Regierung brutal niedergeschlagen und die Ostindische Handelsgesellschaft aufgelöst. Daraufhin erfolgt eine direkte Bindung an das britische Mutterland, welche ihren Höhepunkt in der Übernahme der Kaiserinnenwürde über Indien im Jahr 1876, durch Queen Victoria fand.
Erstmals vor dem Ersten Weltkrieg brachen sich in einigen Kolonien oppositionelle Erneuerungsbewegungen Bahn, weil das Ansehen der weißen Europäer schwer gelitten hatte. Zum Fanal für alle asiatischen Kolonialvölker wurde der militärische Doppelsieg der „gelben“ Japaner gegenüber den „weißen“ Russen. Japan schien sich als einzige asiatische Macht gegenüber den europäischen Mächten als ebenbürtiger Partner zu behaupten, was an einem vom Staat gesteuerten Modernisierungsprozess lag. Durch dieses Prestige schien Japan berufen, im Befreiungskampf gegen den Westen die asiatischen Völker anzuführen. Auch in Indien des Jahres 1913 wurde von dem schon damals weltbekannten Dichter und Nobelpreisträger Rabindranath Tagore der japanische Sieg als Beginn des Pan-Asiatismus gefeiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 1.2 Forschungsstand
- 1.3 Literatur- und Quellenkritik
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Dekolonialisierung
- 2.2 Politik
- 2.3 Politische Kultur
- 2.4 Kommunalismus
- 3. Britisches Kolonialsystem
- 4. Britische Herrschaft in Indien
- 5. Indische Gesellschaft
- 5.1 Kommunalismus
- 5.2 Sprache
- 5.3 Bildungswesen
- 5.4 Medien
- 5.5 Gesundheitswesen
- 5.6 Ökonomie
- 5.7 Politik
- 6. Zusammenführung der Kapitel 3 bis 5
- 7. Kurzbiografien der politischen Anführer in Britisch-Indien
- 7.1 Mohandas Karamchand Gandhi
- 7.2 Jawarharlal Nehru
- 7.3 Mohammed Ali Jinnah
- 27.4 Manbendra Nath Roy
- 7.5 Subhash Chandra Bose
- 8. Britisch-Indiens Weg in die Unabhängigkeit
- 8.1 Entwicklungen in Großbritannien
- 8.2 Entwicklungen in Britisch-Indien
- 8.3 Verfassungsrechtliche Diskussionen um Britisch-Indien
- 9. Zusammenführung der Kapitel 7 und 8
- 10. Die Teilung Britisch-Indiens
- 11. Indien nach der Unabhängigkeit
- 11.1 Staatsidee
- 11.2 Verfassung Indiens
- 11.3 Staatskonsolidierung Indiens
- 12. Pakistan nach der Unabhängigkeit
- 12.1 Staatsidee
- 12.2 Verfassung Pakistans
- 12.3 Staatskonsolidierung Pakistans
- 13. Zusammenführung der Kapitel 10 bis 12
- 14. Ausblick über die indisch-pakistanischen Beziehungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der politischen Kultur in Britisch-Indien im Kontext des Unabhängigkeitsprozesses. Sie untersucht die Auswirkungen der Dekolonialisierung auf die politische Kultur Indiens und Pakistans, indem sie den Zeitraum zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und den ersten Jahren nach der Gründung der beiden Staaten betrachtet.
- Der Einfluss des britischen Kolonialsystems auf die politische Kultur in Britisch-Indien.
- Die Herausforderungen des Unabhängigkeitsprozesses und die Rolle wichtiger politischer Anführer.
- Die Entwicklung der politischen Kultur in Indien und Pakistan nach der Unabhängigkeit.
- Die Rolle von Religion und Kommunalismus in der politischen Kultur Indiens und Pakistans.
- Die langfristigen Auswirkungen der Teilung Britisch-Indiens auf die indisch-pakistanischen Beziehungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Aufbau der Arbeit, den Forschungsstand und die Literatur- und Quellenkritik erläutert. Im zweiten Kapitel werden die zentralen Begriffe der Arbeit, wie Dekolonialisierung, Politik, politische Kultur und Kommunalismus definiert. Anschließend wird das britische Kolonialsystem und seine Auswirkungen auf Indien vorgestellt.
In den folgenden Kapiteln wird die indische Gesellschaft im Kontext des britischen Kolonialismus analysiert, wobei Themen wie Kommunalismus, Sprache, Bildung, Medien, Gesundheitswesen, Ökonomie und Politik behandelt werden.
Es folgen Kurzbiografien wichtiger politischer Anführer in Britisch-Indien, darunter Mohandas Karamchand Gandhi, Jawaharlal Nehru, Mohammed Ali Jinnah, Manbendra Nath Roy und Subhash Chandra Bose.
Die Kapitel 8 und 9 befassen sich mit dem Weg Britisch-Indiens in die Unabhängigkeit, den Entwicklungen in Großbritannien und Britisch-Indien sowie den verfassungsrechtlichen Diskussionen um Britisch-Indien.
Schließlich werden die Teilung Britisch-Indiens, die Gründung und Entwicklung von Indien und Pakistan sowie die indisch-pakistanischen Beziehungen in den folgenden Kapiteln behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen und Themen wie Dekolonialisierung, politische Kultur, Kommunalismus, Britisches Kolonialsystem, Indische Gesellschaft, Unabhängigkeitsprozess, Indien, Pakistan, Staatsidee, Verfassung, Staatskonsolidierung, indisch-pakistanische Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Was war die East India Company?
Ein britisches Privatunternehmen, das Indien zunächst wie ein eigener Staat mit eigener Armee und Flagge kolonisierte, bevor die direkte Herrschaft der Krone begann.
Welche Rolle spielte der Kommunalismus beim indischen Unabhängigkeitsprozess?
Kommunalismus beschreibt die religiös-politischen Spannungen (vor allem zwischen Hindus und Muslimen), die letztlich zur Teilung des Subkontinents führten.
Wer waren die zentralen Anführer in Britisch-Indien?
Wichtige Figuren waren Mohandas Gandhi, Jawaharlal Nehru (Indien) und Mohammed Ali Jinnah (Gründervater Pakistans).
Wie unterschieden sich die Staatsideen von Indien und Pakistan?
Indien verschrieb sich einer säkularen Staatsidee, während Pakistan als Heimatstaat für die Muslime Britisch-Indiens gegründet wurde.
Was war der Sepoy-Aufstand von 1857?
Eine Meuterei indischer Truppen gegen die East India Company, die zur Auflösung der Gesellschaft und zur direkten Bindung Indiens an das britische Mutterland führte.
- Quote paper
- Christoph Deichert (Author), 2020, Die politische Kultur in Britisch-Indien. Entwicklungen in Indien und Pakistan im Unabhängigkeitsprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169028