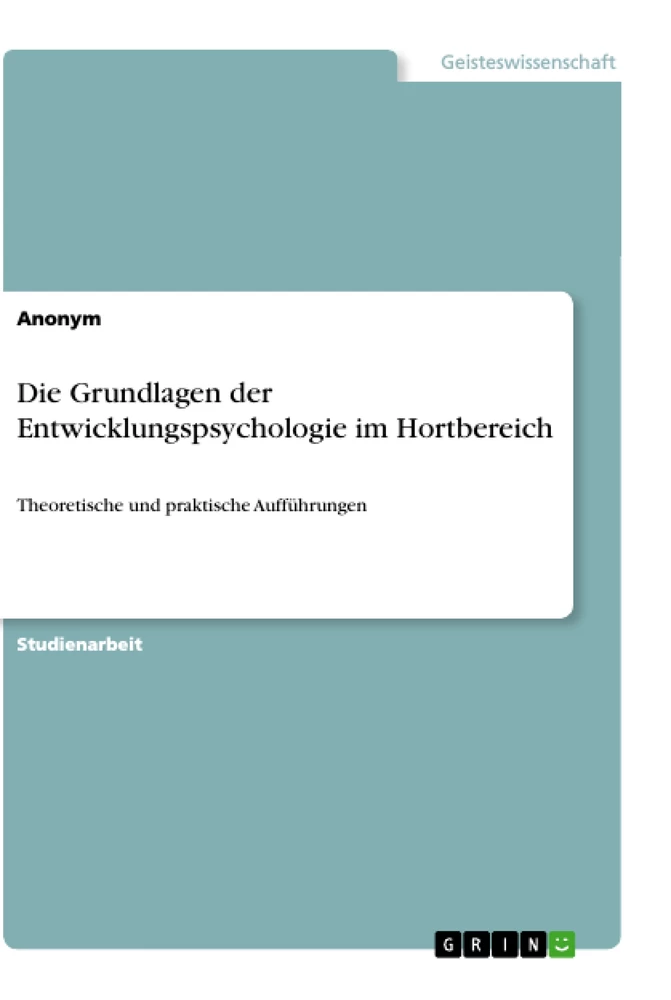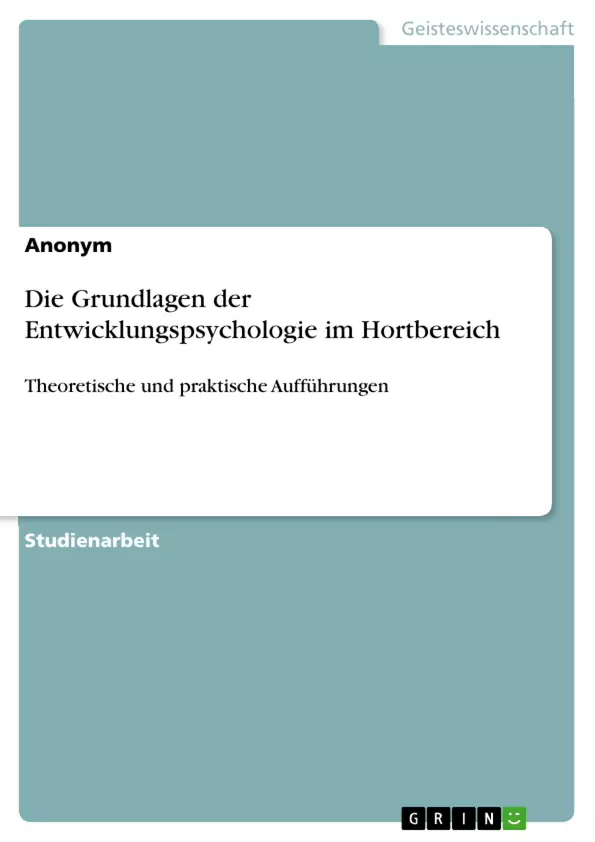In diesem Reflexionsbericht befasse ich mich mit den Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Zu Beginn führe ich den Wahrnehmungsentwicklungsprozess detailliert auf.
Im Kontext der Wahrnehmung verschriftliche ich ebenfalls die dazugehörigen Störungen, speziell das Aufmerksamkeits–Defizit-(Hyperaktivitäts-) Syndrom „AD(H)S“ unter Heranziehung eines Mehrperspektivenrasters. Diese Methode ist aus dem Bereich der sozialen Einzelfallhilfe und verdeutlicht die unterschiedlichen Sichtweisen aller beteiligten Personen in einer vergangenen Situation. Im Punkt zwei beschreibe ich die sensorische Entwicklung in der frühen Kindheit und mögliche sensorische Integrationsstörungen. Im mittleren Abschnitt des Reflexionsberichtes geht es sowohl um die emotionale und soziale Entwicklung als auch um Motivation. Zum Abschluss beschäftige ich mich zum einen mit der Bindung im Allgemeinen, mit der Bindungstheorie und den Bindungsstörungen und des Weiteren mit der Bindung im Zusammenhang mit Bildung.
Alle theoretischen Auffassungen werden mit praktischen Beispielen untermauert. Ich beobachtete zwei Kinder über einen längeren Zeitraum und fokussierte mich dabei auf die genannten Gliederungspunkte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung der Wahrnehmung
- Der Wahrnehmungsentwicklungsprozess
- Störungen in der Wahrnehmung
- AD(H)S als Wahrnehmungsstörung
- Das Mehrperspektivenraster
- Die sensorische Entwicklung in der frühen Kindheit
- Sensorische Integrationsstörungen
- Emotionale und soziale Entwicklung sowie Motivation
- Die Bindung, Bindungstheorie
- Bindungsstörungen
- Zusammenhang Bindung und Bildung
- Schlussfolgerungen für »>P.<<<
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Reflexionsbericht beschäftigt sich mit den Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung des Wahrnehmungsentwicklungsprozesses und der damit verbundenen Störungen, insbesondere dem Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivitäts-) Syndrom „AD(H)S“. Darüber hinaus werden die sensorische Entwicklung in der frühen Kindheit, die emotionale und soziale Entwicklung sowie die Motivation beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bindung, der Bindungstheorie und den Bindungsstörungen sowie dem Zusammenhang von Bindung und Bildung. Die theoretischen Ausführungen werden durch praktische Beispiele von „E.“ und „P.“ veranschaulicht.
- Wahrnehmungsentwicklung und -störungen
- Sensorische Entwicklung in der frühen Kindheit
- Emotionale und soziale Entwicklung sowie Motivation
- Die Bindung und Bindungstheorie
- Zusammenhang von Bindung und Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Reflexionsberichts ein und beschreibt die behandelten Themenbereiche. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Wahrnehmung und geht detailliert auf den Wahrnehmungsentwicklungsprozess ein. Im Kontext der Wahrnehmung werden verschiedene Störungen, insbesondere AD(H)S, sowie das Mehrperspektivenraster als Methode zur Einzelfallhilfe erläutert.
Kapitel drei beschäftigt sich mit der sensorischen Entwicklung in der frühen Kindheit und möglichen sensorischen Integrationsstörungen. Die emotionale und soziale Entwicklung sowie die Motivation werden im mittleren Abschnitt des Berichts behandelt.
Kapitel fünf befasst sich mit der Bindung, der Bindungstheorie und den Bindungsstörungen. Der letzte Teil des Berichts beleuchtet den Zusammenhang von Bindung und Bildung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Reflexionsberichts sind die Entwicklungspsychologie, die Wahrnehmung, AD(H)S, sensorische Entwicklung, emotionale und soziale Entwicklung, Motivation, Bindung, Bindungstheorie und der Zusammenhang von Bindung und Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Schwerpunkte der Entwicklungspsychologie im Hortbereich?
Zentrale Themen sind die Wahrnehmungsentwicklung, die sensorische Integration, die emotionale und soziale Entwicklung sowie die Bindungstheorie.
Wie wird AD(H)S in diesem Kontext eingeordnet?
AD(H)S wird als eine Form der Wahrnehmungsstörung betrachtet. Zur Analyse wird oft ein Mehrperspektivenraster genutzt, um die Sichtweisen aller Beteiligten (Kind, Erzieher, Eltern) einzubeziehen.
Was versteht man unter sensorischen Integrationsstörungen?
Dies sind Störungen bei der Verarbeitung von Sinnesreizen in der frühen Kindheit, die Auswirkungen auf die motorische und kognitive Entwicklung haben können.
Welche Bedeutung hat die Bindungstheorie für die Bildung?
Eine sichere Bindung gilt als Grundvoraussetzung für erfolgreiche Bildungsprozesse. Bindungsstörungen können das Lernverhalten und die soziale Integration im Hort erheblich beeinträchtigen.
Wie werden theoretische Inhalte in diesem Bericht veranschaulicht?
Die theoretischen Grundlagen werden durch praktische Beobachtungsbeispiele von Kindern (im Text „E.“ und „P.“ genannt) untermauert, um den Transfer in den pädagogischen Alltag zu zeigen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Die Grundlagen der Entwicklungspsychologie im Hortbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1172523