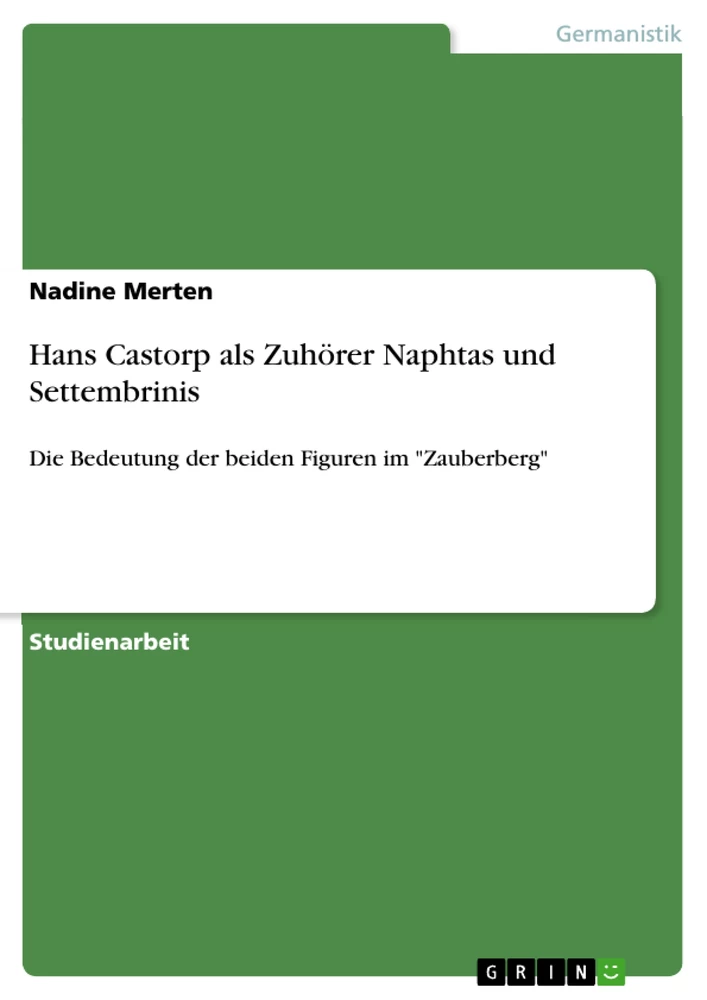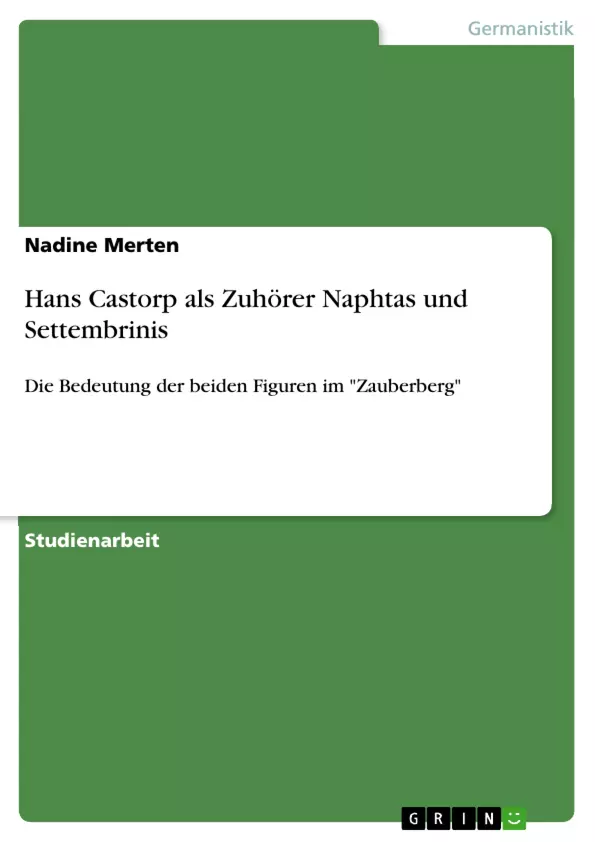In dieser Arbeit möchte ich versuchen zu zeigen, wie sich der Protagonist im „Zauberberg“, Hans Castorp, von den im Verlauf des Romans auftretenden, pädagogisch agierenden Persönlichkeiten beeinflussen lässt.
Bereits im Vorkriegsmanuskript ist die Figur des Hans Castorp so angelegt, dass sie „zwischen zwei gleichermaßen schnurrige Erzieher“ gestellt wird, nämlich „zwischen einen italienischen Literaten, Humanisten, Rhetor und Fortschrittsmann und einen etwas anrüchigen Mystiker, Reaktionär und Advokaten der Anti- Vernunft“.
Bereits hier spricht Thomas Mann von „pädagogisch-politischen Grundabsichten“, die der Geschichte zu Grunde lägen und sich dem jungen Mann im Zauberberg präsentierten. Castorps Sache sei es nun, „zwischen den Mächten der Tugend und der Verführung, zwischen der Pflicht und dem Dienst des Lebens und der Faszination der Verwesung, für die er nicht unempfänglich war“, zu wählen.
Wenn man den Roman als Zeitroman betrachten will, dann verkörpert Castorp darin den Repräsentanten des deutschen Bürgertums und die übrigen Figuren des Romans, besonders eben Settembrini und Naphta, „gruppieren sich […] um ihn als Repräsentanten jener geistig-seelischen Mächte, die sich im Untergang der bürgerlichen Epoche um die deutsche Seele streiten.“ Er stellt damit auch einen Menschen dar, der mit vielfältigen Problemen zu kämpfen hat, die alle die Sorgen des Individuums in der „zerfallenen Welt“ auf der Suche nach intellektueller, philosophischer oder kultureller Orientierung widerspiegeln.
Inhaltsverzeichnis
Hinführung
Hadesfahrt
Die Seite des Lichts: Settembrini
Settembrini und Castorp
Die Seite des Dunklen: Leo Naphta
Naphta und Castorp
Settembrini- Naphta- Castorp
Abschiede
Der Kampf der Mentoren
Hans Castorp als mittlerer Held
Hans Castorp als Zuhörer Castorps und Settembrinis
Hinführung
Ich hatte vor dem Kriege eine größere Erzählung begonnen, die im Hochgebirge, in einem Lungensanatorium spielt, - eine Geschichte mit pädagogisch- politischen Grundabsichten, worin ein junger Mensch sich mit der verführerischen Macht, dem Tode, auseinanderzusetzen hat und auf komisch- schauerliche Art durch die geistigen Gegensätze von Humanität und Romantik, Fortschritt und Reaktion, Gesundheit und Krankheit geführt wird, aber mehr orientierend und der Wissenschaft halber, als entscheidend. Der Geist des Ganzen ist humoristisch- nihilistisch, und eher schwankt die Tendenz nach der Seite der Sympathie mit dem Tode.[1]
In dieser Arbeit möchte ich versuchen zu zeigen, wie sich der Protagonist im „Zauberberg“, Hans Castorp, von den im Verlauf des Romans auftretenden, pädagogisch agierenden Persönlichkeiten beeinflussen lässt.
Bereits im Vorkriegsmanuskript ist die Figur des Hans Castorp so angelegt, dass sie „zwischen zwei gleichermaßen schnurrige Erzieher“ gestellt wird, nämlich „zwischen einen italienischen Literaten, Humanisten, Rhetor und Fortschrittsmann und einen etwas anrüchigen Mystiker, Reaktionär und Advokaten der Anti- Vernunft“.[2]
Bereits hier spricht Thomas Mann von „pädagogisch-politischen Grundabsichten“, die der Geschichte zu Grunde lägen und sich dem jungen Mann im Zauberberg präsentierten. Castorps Sache sei es nun, „zwischen den Mächten der Tugend und der Verführung, zwischen der Pflicht und dem Dienst des Lebens und der Faszination der Verwesung, für die er nicht unempfänglich war“[3], zu wählen.
Wenn man den Roman als Zeitroman[4] betrachten will, dann verkörpert Castorp darin den Repräsentanten des deutschen Bürgertums und die übrigen Figuren des Romans, besonders eben Settembrini und Naphta, „gruppieren sich […] um ihn als Repräsentanten jener geistig-seelischen Mächte, die sich im Untergang der bürgerlichen Epoche um die deutsche Seele streiten.“[5] Er stellt damit auch einen Menschen dar, der mit vielfältigen Problemen zu kämpfen hat, die alle die Sorgen des Individuums in der „zerfallenen Welt“ auf der Suche nach intellektueller, philosophischer oder kultureller Orientierung widerspiegeln.[6]
Man könnte die Stellung Hans Castorps auch so verstehen, als dass er der „zentrale und einzige Held“ in dem Roman ist und die übrigen Figuren ihn umgarnen, um seine „arme Seele“ kämpfen.[7] Dies ähnelte dann dem Muster des Bildungsromans à la „Wilhelm Meister“.[8]
Andererseits erwähnte Thomas Mann und erwähnt der Erzähler im Roman selbst immer wieder, dass die Geschichte nicht wegen der Figur Castorps erzählt werde, sondern um der Geschichte willen.[9] Hier bekommen nun die Figuren eine Art „repräsentatives Eigengewicht“ zuerkannt und auch Castorp wird dann in die Absichten des zu erzielenden Gesellschaftsromans- beziehungsweise Zeitromans eingebunden.[10]
Vielleicht ist es aber gar nicht nötig, die beiden Begriffe strikt voneinander zu trennen. Sicherlich repräsentiert Castorp das deutsche Bürgertum am Ende des bürgerlichen Zeitalters und „des deutschen Menschen in der politisch- kulturellen Mitte zwischen Ost und West“ aber er dient genauso auch als Mittel des Erzählers um die herauszustellen Ansichten der beiden Kontrahenten, der „zwei entscheidenden Pole“[11], in scharf dialektischer Weise vorzuführen.
Der Roman stellt also eine Verbindung und Steigerung beider Intentionen dar und dies ist auch nötig, was im Folgenden noch zu verdeutlichen sein wird.
Hadesfahrt
Die Eröffnung des Romans durch die Fahrt Castorps vom Flachland ins Hochgebirge stellt eine Reise vom „Bekannten ins Unbekannte“[12] dar:
Heimat und Ordnung lagen nicht nur weit zurück, sie lagen hauptsächlich klaftertief unter ihm, und noch immer stieg er darüber hinaus. Schwebend zwischen ihnen und dem Unbekannten fragte er sich, wie es ihm dort oben ergehen werde.[13]
Ordnung, Arbeit, Organisation werden zurückgelassen und neben der geordneten Arbeitswelt werden auch die geordneten Familienverhältnisse verlassen. In dieser Welt ist Castorp nun, nach Abschluss seines Studiums, aufgefordert, „seinen Mann zu stehen.“. Die Reise führt ihn weg von dieser Welt ins „Ungeheuerliche und Unordentliche“. Schon auf der Reise selbst wurde diese Wendung deutlich gemacht: So passiert der Zug tiefe Spalten und Abgründe und stößt dabei dunklen, schwarzen Rauch aus. Je höher der Zug und somit Hans Castorp über die Waldgrenze gelangt, desto mehr verliert er dann auch an Orientierung, er kann sich dessen nicht erwehren und ist völlig ratlos, als er dazu noch eine Station früher aussteigen soll, als es vorgesehen war. Diese Reise stellt für ihn eine Reise zu einem Ort „ der Ausschweifung und der Auflösung“ dar. „ Liebe und Tod werden als dämonische Mächte erfahren. Sie brechen den Intellekt, die Moral und den Arbeitswillen und führen zu Schlaffheit, Stumpfsinn und Lähmung.“[14]
Die Seite des Lichts: Settembrini
Settembrini ist nun derjenige, der im Roman ganz klar die Wertewelt eben des Flachlandes vertritt, aus dem Castorp seine Reise antrat. So betont er denn auch immer Castorps erlernten Beruf (indem er ihn beispielsweise gern und häufig „Ingegnere“ nennt) und will ihn auch schnellstmöglich zu einer Rückkehr in die Welt der Arbeit bewegen.[15]
Geistesgeschichtlich betrachtet vertritt Settembrini das europäische Denken „ von der Antike über die Renaissance bis hin zur Aufklärung.“[16]
Dabei Settembrini bestreitet seine Revolution mehr mit Worten als mit Taten und erinnert immer wieder an den Zivilisationsliteraten aus den „Betrachtungen“.[17]
Zunächst soll hier kurz die Figur Settembrinis umrissen werden. Beachtlich ist vorab, dass wir, im Gegensatz zur Beschreibung Leo Naphtas im Roman, nichts über den Werdegang Settembrinis, also über Kindheit, Herkunft, frühere Erlebnisse oder ähnliches erfahren. Settembrini wird uns mehr mit „Blick auf seine Vorfahren“ näher gebracht.[18] Hierbei nimmt er stets Bezug auf seinen Vater und mehr noch auf seinen Großvater, indem er deren Handlungen und Ideen schildert. Schon dort lässt sich ein Abfall vom Handeln zum Reden erkennen:
Settembrini sprach von seinem Großvater, der zu Mailand Advokat, hauptsächlich aber ein großer Patriot gewesen und etwas wie einen politischen Agitator, Redner und Zeitschriften- Mitarbeiter vorgestellt hatte, - auch er ein Oppositionsmann, gleich dem Enkel, doch hatte er das Ding in größerem, kühnerem Stile betrieben. Denn während Lodovico, wie er selber mit Bitterkeit bemerkte, sich darauf angewiesen fand, das Leben und Treiben im Internationalen Sanatorium Berghof zu hecheln, höhnische Kritik daran zu üben und im Namen einer schönen und tatfrohen Menschlichkeit Verwahrung dagegen einzulegen, hatte jener den Regierungen zu schaffen gemacht, gegen Österreich und die Heilige Allianz konspiriert.[19]
Die zentralen Punkte in der Settembrini`schen Lehre sind die Begriffe Vernunft (im Sinne der „raison“) und Arbeit. Im aufklärerischen Sinne ist aber die Candide- Formel „Il faut cultiver notre jardin“ an einem Ort wie dem Berghof sichtlich unangebracht. Und es ist keinesfalls Settembrini, der dieser Formel folgt, er erinnert vielmehr an den geschwätzigen Pangloss des Voltaire- Romans. Man redet also um des Redens Willen und um sich den später endlos scheinenden Diskussionen und Streitereien mit dem auftauchenden Konkurrenten Naphta hinzugeben.[20]
Weiterhin charakteristisch für den Italiener ist sein unermüdlicher Fortschrittsglaube: Als Schüler der Lumières ist Settembrini davon überzeugt, dass diese Macht den „Menschen vollends befreien und ihn auf den Wegen des Fortschritts und der Zivilisation einem immer helleren, milderen und reineren Lichte entgegengleiten lässt“.[21]
Diesem angesprochenen Licht sieht Settembrini im Sanatorium das Dunkle entgegenstehen, das er mit den „Waffen der Vernunft“ zu bekämpfen sucht und vor dem er Castorp mit all seiner Kraft bewahren will. Dunkel ist für ihn alles Zweideutige, alles Lasterhafte, dass nicht zur Tatkraft des Menschen, sondern zu dessen Stillstand aufruft, beispielsweise die Musik. Natürlich steht Settembrini auch der Verehrung der Krankheit entgegen und betrachtet den Kranken eher als etwas Beschämendes oder Bedrückendes. Das Sanatorium ist demnach eine Art dunkles Schattenreich, Hades genannt, die beiden darin agierenden Ärzte beispielsweise vergleicht er mit den Höllenrichtern Rhadamanth und Minos[22], Krokowskis Forschungen werden als „pfäffisches Unwesen“[23] betitelt.[24]
Settembrini und Castorp
Die erste Begegnung zwischen Settembrini und Castorp ereignet sich unmittelbar nach einer Unterhaltung Castorps mit seinem Vetter Joachim Ziemßen nach dem ersten Frühstück, welches der neu eingetroffene Patient im Sanatorium einnimmt. Die beiden reden über die laut Joachim so „unverzeihliche Schlappheit“[25] eines manchen Schwerkranken und die völlig übertriebenen Gefühlsausbrüche, die das Thema Sterben bei einigen auslöse. Daraufhin ist Hans Castorp sehr entsetzt über die Redeweise seines Vetters, so sei doch ein Sterbender in gewissem Sinne „ehrwürdig“ und „heilig“[26]. Als hierauf Joachim in schallendes Gelächter ausbricht, erscheint plötzlich Settembrini und Joachim verstummt und weist Castorp zurecht, er solle still sein.
In diesem Moment erkennt Settembrini sofort, dass er es hier mit einem anderen Charakter als dem Joachim Ziemßens zu tun hat, mit einer Person nämlich, die seiner „ernüchternden pädagogischen Führung“[27] bedarf:
„ Er lächelte, wie er da stand und die Vettern, namentlich aber Hans Castorp, betrachtete, und diese feine, etwas spöttische Vertiefung und Kräuselung seines einen Mundwinkels unter dem vollen Schnurrbart, dort, wo er sich in schöner Rundung aufwärts bog, war von eigentümlicher Wirkung, es hielt gewissermaßen zur Geistesklarheit und Wachsamkeit an und ernüchterte den trunkenen Hans Castorp im Augenblick, so dass er sich schämte.“[28]
Schon hier also, bei der ersten Begegnung, schafft es Settembrini, den jungen Castorp zu ernüchtern, dessen Trunkenheitsatmosphäre zu durchbrechen und dies bleibt seine wichtigste Funktion im Roman.[29]
Bei Settembrinis Auftreten fühlt sich Castorp zugleich an große und bedeutende antike Erzieher erinnert, wie etwa Sokrates oder Cato, ebenso verbindet er mit dem so daherkommenden Settembrini jedoch auch „gewisse ausländische Musikanten, die zur Weihnachtszeit in den heimischen Höfen aufspielten und mit emporgerichteten Samtaugen ihren Schlapphut hinhielten, damit man ihnen Zehnpfennigstücke aus den Fenstern hineinwürfe.“[30]
[...]
[1] Wegener, Herbert (Hg.): Letters to Paul Amann 1915-1952. Middletown: Wesleyan University Press 1960, S. 29. Zitiert nach: Wysling, Hans: Der Zauberberg, S. 398.
[2] De Mendelssohn, Peter: Mann, Thomas: Tagebücher 1918-1921, S. 398.
[3] Ebd.
[4] Zeitroman ist hier definiert als Romantypus, „in dem die Einmaligkeit der Gegenwart als Stoff oder Gehalt wesentlich zum Ausdruck gebracht wird.“ Dieser Typus wird „traditionell als charakteristisch für das 19. Jahrhundert gesehen.“ Vgl. dazu: Emmel, Hildegard: „Roman“, S. 506ff.
[5] Neumann, Michael: Thomas Mann. Romane, S.68.
[6] Classen, Albrecht: der Kampf um das Mittelalter im Werk Thomas Manns: Der Zauberberg: Die menschliche Misere im Kreuzfeuer geistesgeschichtlicher Strömungen, S. 33.
[7] Neumann, Michael: Thomas Mann. Romane, S. 70.
[8] Wysling, Hans: Der Zauberberg, S.400.
[9] Thomas, Mann: Der Zauberberg, S.9.
[10] Neumann, Michael: Thomas Mann. Romane, S.71.
[11] Neumann, Michael: Thomas Mann. Romane, S.33.
[12] Koopmann, Helmut: Der klassisch-moderne Roman in Deutschland, S.38.
[13] Mann, Thomas: Der Zauberberg, S. 13.
[14] Wysling, Hans: Der Zauberberg, S.400ff.
[15] Ebd., S.403.
[16] Ebd.
[17] Neumann, Michael: Thomas Mann. Romane, S. 68.
[18] Wisskirchen, Hans: „Ich glaube an den Fortschritt, gewiß.“ Quellenkritische Untersuchungen zu Thomas Manns Settembrini- Figur. , S. 86.
[19] Mann, Thomas: Der Zauberberg, S. 212f.
[20] Schoepf, Joachim: Die pädagogischen Konzepte in Thomas Manns Zauberberg und ihre Wirkung auf die Hauptfigur Hans Castorp, S.26.
[21] Mann, Thomas: Der Zauberberg, S.139.
[22] Kurzke, Hermann: Thomas Mann. Epoche- Werk- Wirkung, S. 105.
[23] Mann, Thomas: Der Zauberberg, S.136.
[24] Schoepf, Joachim: Die pädagogischen Konzepte in Thomas Manns Zauberberg und ihre Wirkung auf die Hauptfigur Hans Castorp, S.28.
[25] Mann, Thomas: Der Zauberberg. S.80.
[26] Mann, Thomas: Der Zauberberg, S.81.
[27] Schoepf, Joachim: Die pädagogischen Konzepte in Thomas Manns Zauberberg und ihre Wirkung auf die Hauptfigur Hans Castorp, S.17.
[28] Mann, Thomas: Der Zauberberg, S. 82.
[29] Kurzke, Hermann: Thomas Mann. Epoche- Werk- Wirkung. München: Beck 1997, S. 83.
[30] Mann, Thomas: Der Zauberberg, S.82,
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle nimmt Hans Castorp im „Zauberberg“ ein?
Er fungiert als der „mittlere Held“ und Repräsentant des deutschen Bürgertums, der zwischen gegensätzlichen geistigen Mächten und Erzieherfiguren steht.
Wofür steht die Figur Settembrini?
Settembrini vertritt die „Seite des Lichts“: Humanismus, Aufklärung, Fortschritt, Vernunft und die Arbeitswelt des Flachlandes.
Wofür steht die Figur Leo Naphta?
Naphta verkörpert die „Seite des Dunklen“: Mystik, Reaktion, Anti-Vernunft und eine Faszination für Krankheit und Tod.
Was symbolisiert Castorps Fahrt ins Hochgebirge?
Die Reise wird als „Hadesfahrt“ beschrieben, ein Übergang von der Ordnung des Flachlandes in die „ungeheuerliche“ Welt des Sanatoriums, geprägt von Auflösung und Tod.
Ist „Der Zauberberg“ ein Bildungsroman?
Ja, die Arbeit zeigt Parallelen zum Bildungsroman auf, da Castorp durch die „pädagogisch-politischen“ Einflüsse seiner Mentoren eine geistige Entwicklung durchläuft.
- Arbeit zitieren
- Nadine Merten (Autor:in), 2005, Hans Castorp als Zuhörer Naphtas und Settembrinis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117814