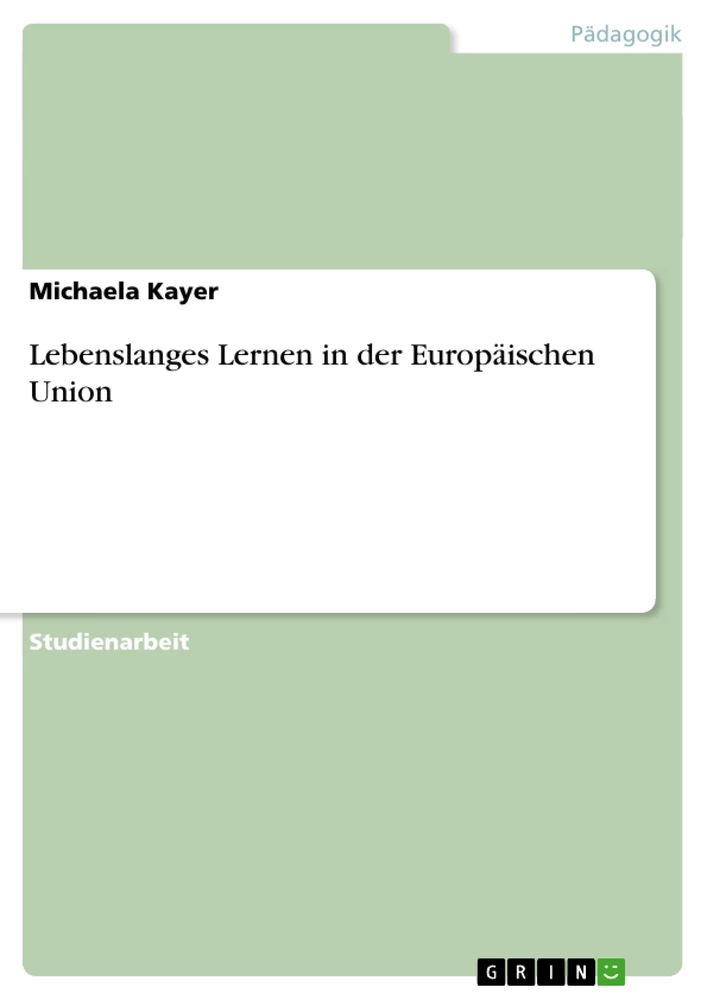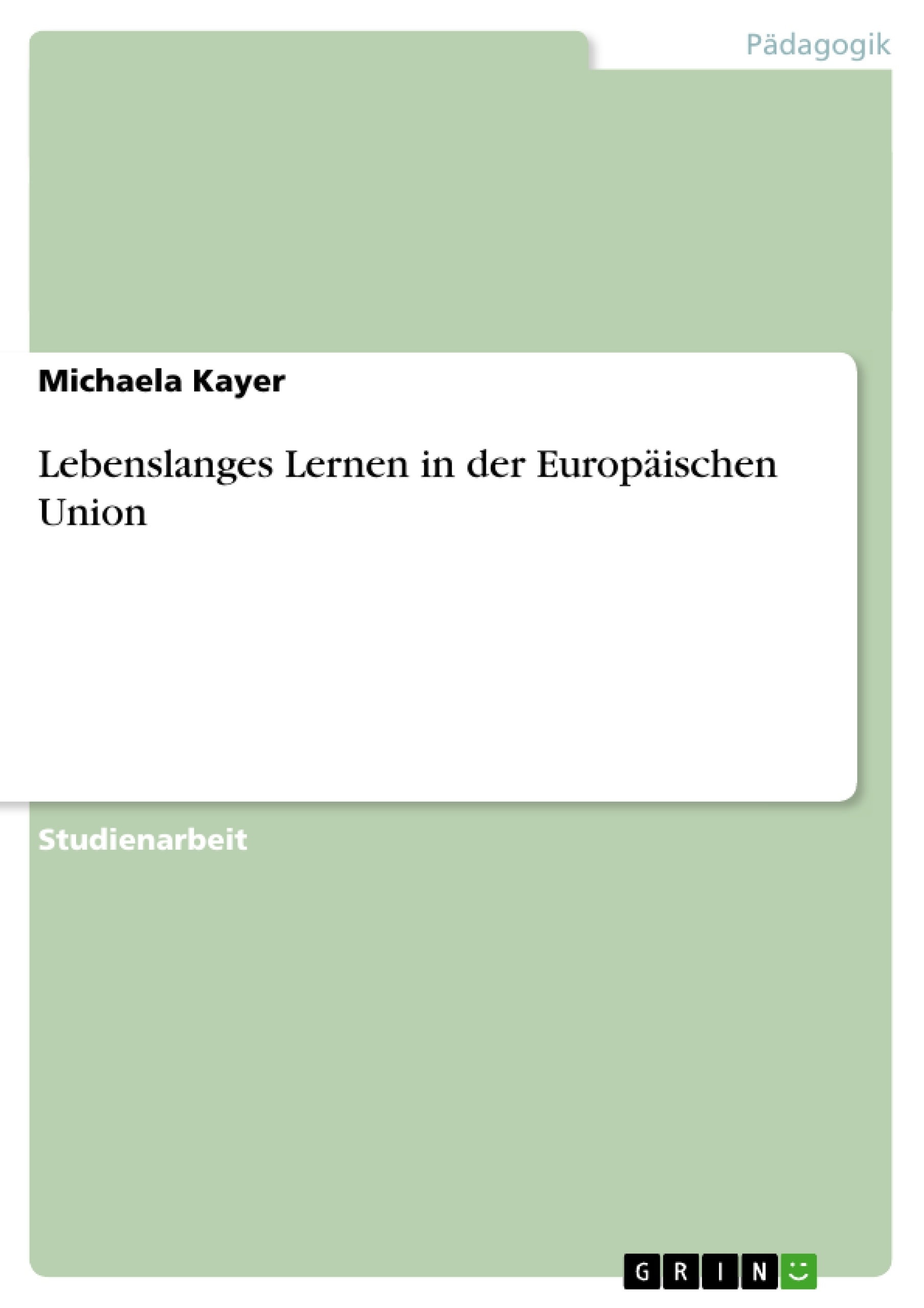Lebenslanges Lernen ist heute ein wichtiger und viel diskutierter Bildungspolitischer Schwerpunkt.
Gerade zur heutigen Zeit, wo hohe Flexibilität und mehrmaliges Umschulen nichts
Außergewöhnliches sind und noch dazu von dem sich ständig ändernden Arbeitsmarkt erzwungen
werden, ist es nötig die Bildungslandschaft zu verbessern. Aus diesem Grund ernannte die
Europäische Union das Jahr 1996 zum Jahr des Lebenslangen Lernens. Freilich gab es
Lebenslanges Lernen schon immer, doch der heutige schnelle wirtschaftliche und technische
Wandel macht Schlüsselqualifikationen, sowie technische, soziale und kommunikative
Kompetenzen immer wichtiger. Der technische Fortschritt macht uns zu einer Lerngesellschaft, in
der man nur durch Selbstlernen erfolgreich bestehen kann (vgl: http://www.bmbf.de/de/411.php).
Für die EU dient das Konzept des Lebenslangen Lernens als Bewältigungsstrategie um dem
sozialen und technischen Wandel gerecht zu werden.
Unterschiedliche Menschen lernen auch unterschiedlich. Nicht alle können und wollen sich ständig
weiterbilden. Doch unser Bildungssystem sollte für jeden/jede immer zugänglich sein. Da der
Mensch als Individuum im Mittelpunkt steht, muss auf die verschiedenen Lernprozesse jeden Alters
eingegangen werden. Trotzdem steht oft nur die Beschäftigungsfähigkeit im Vordergrund. Um
dieser einseitigen Bildung entgegen zu wirken arbeitete die EU an einer ganzheitlichen Sichtweise,
die gegen Benachteiligungen und Ausgrenzungen wirken soll. Damit sollen gleiche Chancen für
alle Menschen in Europa entstehen, um dem sozialen und wirtschaftlichen Wandel zu folgen und
aktiv an der Gestaltung Europas mitwirken zu können. Um das Ziel der aktiven Staatsbürgerschaft
und der allgemeinen Beschäftigungsfähigkeit zu erreichen entstand nach dem Jahr des
Lebenslangen Lernens das EU Memorandum für lebenslanges Lernen, an dem alle Mitgliedstaaten
beteiligt wurden. Fertiggestellt und veröffentlicht wurde das Memorandum im Jahr 2000, aus dem
ich die wichtigsten Grundbotschaften in weiteren Verlauf meiner Arbeit vorstellen möchte.
Wie entstand eigentlich der Begriff lebenslanges Lernen, der heute so wichtig für unsere berufliche
Zukunft ist? 1970 wurde die Bildungsdiskussion von drei großen Organisationen aufgenommen:
dem Europarat, der UNESCO und der OECD.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Memorandum über lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission
- Botschaft 1: Neue Basisqualifikation für Alle
- Botschaft 2: Höhere Investitionen in die Humanressourcen
- Botschaft 3: Innovationen bei Lehren und Lernen
- Botschaft 4: Bewertung des Lernens
- Botschaft 5: Umdenken in Berufsberatung und Berufsorientierung
- Botschaft 6: Das Lernen den Lernenden auch räumlich näherbringen
- Programm „Lebenslanges Lernen\" 2007-2013
- Comenius
- Erasmus
- Leonardo da Vinci
- Jean Monnet
- Grundtvig
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Konzept des lebenslangen Lernens in der Europäischen Union, mit dem Fokus auf dessen Bedeutung im Kontext des wirtschaftlichen und sozialen Wandels. Sie analysiert die wichtigsten Botschaften des EU-Memorandums zum lebenslangen Lernen und beleuchtet die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Bildungsperspektive, die allen Menschen gleiche Chancen bietet.
- Das EU-Memorandum zum lebenslangen Lernen und seine Kernbotschaften
- Die Bedeutung von Basisqualifikationen für die Teilhabe an der Wissensgesellschaft
- Investitionen in Humanressourcen und deren ökonomische Auswirkungen
- Lebenslanges Lernen als Bewältigungsstrategie für den sozialen und technischen Wandel
- Zugänglichkeit und Individualisierung von Bildungsprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des lebenslangen Lernens ein und betont dessen wachsende Bedeutung angesichts der hohen Flexibilität und des sich ständig verändernden Arbeitsmarktes. Sie verweist auf die Ernennung des Jahres 1996 zum Jahr des lebenslangen Lernens durch die Europäische Union und erklärt, wie der schnelle wirtschaftliche und technologische Wandel Schlüsselqualifikationen immer wichtiger macht. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, das Bildungssystem zu verbessern und allen Menschen Zugang zu Bildung zu ermöglichen, um dem sozialen und technischen Wandel gerecht zu werden und eine aktive Staatsbürgerschaft zu fördern. Die Entstehung des Begriffs "lebenslanges Lernen" wird ebenfalls kurz beleuchtet, mit Verweis auf die Rolle des Europarats, der UNESCO und der OECD.
Definition: Dieses Kapitel widmet sich der Definition von "lebenslangem Lernen". Es zeigt die Schwierigkeiten auf, eine einheitliche Definition in der Literatur zu finden, und wählt eine Definition von der Homepage www.erwachsenenbildung.at als Grundlage. Die ausgewählte Definition betont das Lernen während des gesamten Lebens zur Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen, wobei die persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen und beschäftigungsbezogenen Perspektiven berücksichtigt werden. Der Unterschied zur österreichischen Sichtweise wird kurz erläutert, wobei die Befähigung von Menschen über ihre gesamte Lebensspanne zur Aufnahme von Bildungsprozessen im Vordergrund steht.
Memorandum über lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit den sechs Grundbotschaften des Memorandums über lebenslanges Lernen. Es verwendet den Hintergrundbericht von Schneeberger/Schlögl (2001) als Quelle und führt in die sechs Botschaften ein, welche die Grundlage für die weitere Analyse bilden. Der Fokus liegt hier auf der Einführung und der Einordnung der Bedeutung des Memorandums.
Botschaft 1: Neue Basisqualifikation für Alle: Diese Zusammenfassung beschreibt die erste Botschaft des Memorandums, nämlich den ständigen Zugang zum Lernen für alle EU-Bürger. Sie hebt die fünf Basisqualifikationen hervor (IT-Fertigkeiten, Fremdsprachen, Technologiekultur, Unternehmergeist und Sozialkompetenzen), die notwendig sind, um den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Die Bedeutung des Pflichtschulabschlusses als Grundlage für lebenslanges Lernen und die Notwendigkeit einer Entlastung der Lehrpläne werden diskutiert. Das Beispiel der österreichischen eLearning-Initiative wird als Beispiel für die Niveauanhebung im IT-Bereich genannt.
Botschaft 2: Höhere Investitionen in die Humanressourcen: Hier wird die zweite Botschaft des Memorandums behandelt, die sich auf die Notwendigkeit höherer Pro-Kopf-Investitionen in die Weiterbildung, insbesondere für Personen über 35 Jahre, konzentriert. Der demografische Wandel und die Bedeutung älterer Arbeitnehmer werden hervorgehoben. Der Rückgang der Investitionen in den Bildungsbereich in Österreich wird kritisiert und der positive ökonomische Effekt von Bildungsinvestitionen wird betont.
Schlüsselwörter
Lebenslanges Lernen, Europäische Union, Memorandum, Basisqualifikationen, Humanressourcen, Wissensgesellschaft, Bildungsinvestitionen, sozialer Wandel, technischer Wandel, Beschäftigungsfähigkeit, Kompetenzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Lebenslanges Lernen in der Europäischen Union
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Konzept des lebenslangen Lernens in der Europäischen Union. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des EU-Memorandums zum lebenslangen Lernen und seiner sechs Kernbotschaften, sowie der Bedeutung von lebenslangem Lernen im Kontext des wirtschaftlichen und sozialen Wandels.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Definition von lebenslangem Lernen, Memorandum über lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission (mit detaillierter Betrachtung der sechs Botschaften), und eine abschließende Reflexion. Zusätzlich werden Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter aufgeführt.
Was sind die Kernbotschaften des EU-Memorandums zum lebenslangen Lernen?
Das Memorandum umfasst sechs Kernbotschaften: 1. Neue Basisqualifikationen für alle; 2. Höhere Investitionen in die Humanressourcen; 3. Innovationen bei Lehren und Lernen; 4. Bewertung des Lernens; 5. Umdenken in Berufsberatung und Berufsorientierung; 6. Das Lernen den Lernenden auch räumlich näherbringen. Das Dokument analysiert diese Botschaften im Detail.
Welche Bedeutung haben Basisqualifikationen im Kontext des lebenslangen Lernens?
Das Dokument hebt die Bedeutung von fünf Basisqualifikationen hervor: IT-Fertigkeiten, Fremdsprachen, Technologiekultur, Unternehmergeist und Sozialkompetenzen. Diese Qualifikationen werden als notwendig erachtet, um den Anforderungen des sich verändernden Arbeitsmarktes gerecht zu werden und die Teilhabe an der Wissensgesellschaft zu ermöglichen.
Wie wird die Bedeutung von Investitionen in Humanressourcen dargestellt?
Das Dokument betont die Notwendigkeit höherer Investitionen in die Weiterbildung, insbesondere für Personen über 35 Jahre, im Kontext des demografischen Wandels. Es wird der positive ökonomische Effekt von Bildungsinvestitionen hervorgehoben und ein Mangel an solchen Investitionen kritisiert.
Welche Rolle spielt lebenslanges Lernen im Umgang mit sozialem und technischem Wandel?
Das Dokument positioniert lebenslanges Lernen als zentrale Bewältigungsstrategie für den sozialen und technischen Wandel. Durch verbesserte Bildung und den Zugang zu lebenslangem Lernen sollen Bürger befähigt werden, sich an die sich verändernden Anforderungen anzupassen und aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen.
Wie wird der Begriff „Lebenslanges Lernen“ definiert?
Das Dokument beleuchtet die Schwierigkeit, eine einheitliche Definition zu finden und verwendet eine Definition von www.erwachsenenbildung.at als Grundlage. Diese Definition betont das Lernen während des gesamten Lebens zur Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen in persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen und beschäftigungsbezogenen Perspektiven.
Welche Programme werden im Zusammenhang mit lebenslangem Lernen erwähnt?
Das Dokument erwähnt die Programme des Programms „Lebenslanges Lernen“ 2007-2013: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Jean Monnet und Grundtvig.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Lebenslanges Lernen, Europäische Union, Memorandum, Basisqualifikationen, Humanressourcen, Wissensgesellschaft, Bildungsinvestitionen, sozialer Wandel, technischer Wandel, Beschäftigungsfähigkeit und Kompetenzen.
- Arbeit zitieren
- Michaela Kayer (Autor:in), 2008, Lebenslanges Lernen in der Europäischen Union, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117855