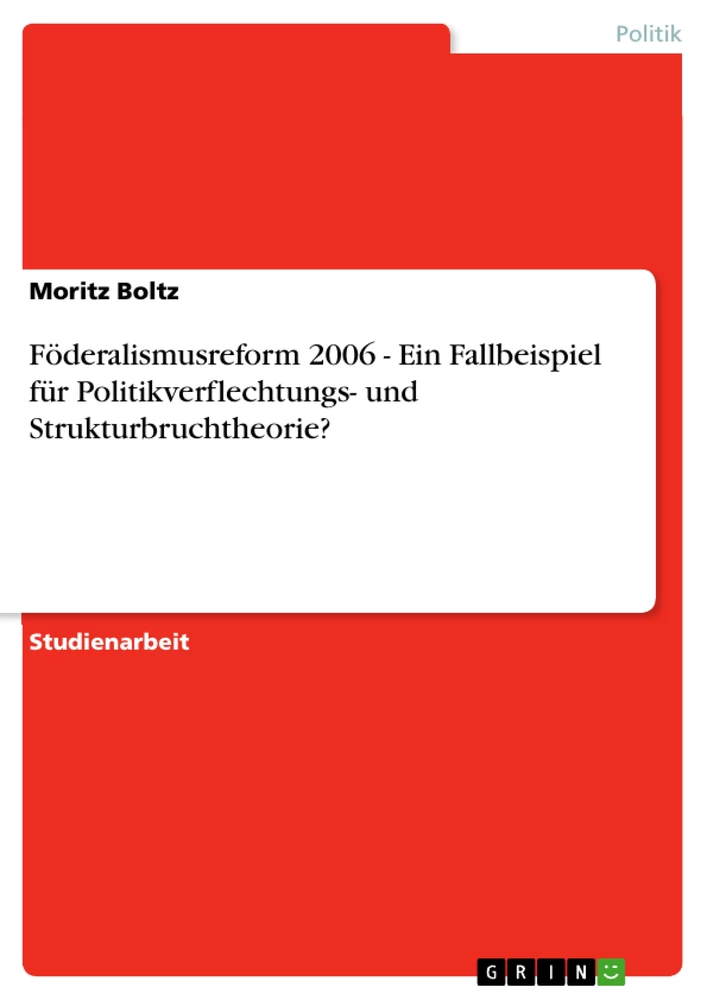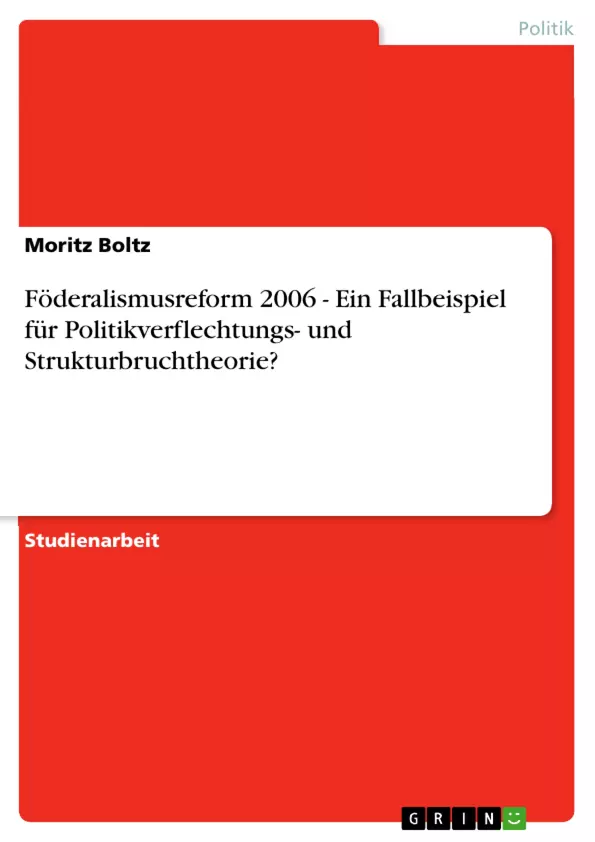„Die am 1. September 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform soll dem Bundesstaatsprinzip wieder Gestaltungskraft geben.“ So heißt es im Blickpunkt Bundestag zur deutschen Föderalismusreform. Die vorgegebenen Ziele sind klar: Mehr Transparenz, eine bessere Kompetenzzuordnung, Entflechtung der Vernetzung zwischen Bund und Ländern und schließlich auch die Stärkung der Länder insbesondere der Länderparlamente. Doch hat die Reform der großen Koalition wirklich entscheidende Ergebnisse geliefert? Kam es wirklich zur viel zitierten Weichenstellung in Richtung Politikentflechtung? Viele Politikwissenschaftler wie z.B. Fritz W. Scharpf oder Roland Sturm sind skeptisch und verweisen auf die dürftigen Erfolge der Reform. So wurde unter anderem der wichtige Aspekt der Finanzverteilung von vorneherein ausgeklammert und in eine Föderalismusreform II vertagt. In vielerlei Hinsicht ist die Reform zu einem Minimalkonsens zusammengeschrumpft, in dem man sich lediglich auf einen sehr engen Neuregelungskatalog einigen konnte. Die Tatsache, dass so wenig erreicht wurde, wirft natürlich die Frage nach Gründen für die mäßigen Erfolge auf. Erklärungen hierfür könnten zwei Theorien der Politikwissenschaft liefern: Die Politikverflechtungstheorie von Fritz W. Scharpf und die Strukturbruchtheorie von Gerhard Lehmbruch. Die folgende Arbeit prüft ausgehend von einer kurzen Vorstellung der beiden Theorien deren Anwendbarkeit am Fallbeispiel der Föderalismusreform 2006. Hierbei soll die These belegt werden, dass beide Theorien eine breite Erklärungsmöglichkeit bieten.
Inhaltsverzeichnis
- Die Föderalismusreform – mehr Gestaltungskraft für den Bundesstaat?
- Die Föderalismusreform 2006 - ein Fallbeispiel für Politikverflechtungs- und Strukturbruchtheorie?
- Die Politikverflechtungstheorie
- Die Kompetenzverflechtung
- Problemlösungs-Defizite und Akteursstrategien
- Die Politikverflechtungsfalle
- Anwendung der Politikverflechtungstheorie auf die Reform 2006
- Die Entstehung der Föderalismusreform in Hinblick auf die Politikverflechtungstheorie
- Die Ergebnisse der Föderalismusreform in Hinblick auf die Politikverflechtungstheorie
- Die Strukturbruchtheorie
- Historischer Institutionalismus und Pfadabhängigkeit
- Bundstaat und Parteienwettbewerb
- Anwendung der Strukturbruchtheorie auf die Reform 2006
- Die Entstehung der Föderalismusreform in Hinblick auf die Strukturbruchtheorie
- Die Ergebnisse der Föderalismusreform in Hinblick auf die Strukturbruchtheorie
- Fazit Was können die Theorien, was nicht?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Föderalismusreform von 2006 anhand der Politikverflechtungstheorie von Fritz W. Scharpf und der Strukturbruchtheorie von Gerhard Lehmbruch. Ziel ist es, die Anwendbarkeit beider Theorien auf das Fallbeispiel der Reform zu beleuchten und ihre Erklärungskraft zu bewerten.
- Kompetenzverflechtung und Entscheidungsautonomie im deutschen Bundesstaat
- Problemlösungs-Defizite und Akteursstrategien in verflechteten Systemen
- Die Politikverflechtungsfalle und ihre Auswirkungen auf Reformen
- Historischer Institutionalismus und Pfadabhängigkeit im Kontext der Föderalismusreform
- Bundstaat und Parteienwettbewerb als Einflussfaktoren auf die Reform
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Föderalismusreform - mehr Gestaltungskraft für den Bundesstaat? Dieses Kapitel stellt die Föderalismusreform von 2006 vor und beleuchtet die Ziele und Erwartungen an die Reform. Es wird die Kritik an den Ergebnissen der Reform diskutiert und die Relevanz der Politikverflechtungstheorie und der Strukturbruchtheorie für die Analyse der Reform hervorgehoben.
- Kapitel 2: Die Föderalismusreform 2006 – ein Fallbeispiel für Politikverflechtungs- und Strukturbruchtheorie? Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Politikverflechtungstheorie und der Strukturbruchtheorie. Es werden die zentralen Konzepte der Theorien erläutert und ihre Anwendung auf den deutschen Föderalismus diskutiert.
- Kapitel 3: Fazit Was können die Theorien, was nicht? Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Erklärungskraft der beiden Theorien im Hinblick auf die Föderalismusreform 2006. Es werden die Stärken und Schwächen der Theorien aufgezeigt und mögliche Schlussfolgerungen für die Zukunft des deutschen Föderalismus gezogen.
Schlüsselwörter
Föderalismusreform, Politikverflechtungstheorie, Strukturbruchtheorie, Kompetenzverflechtung, Entscheidungsautonomie, Problemlösungs-Defizite, Akteursstrategien, Politikverflechtungsfalle, Historischer Institutionalismus, Pfadabhängigkeit, Bundstaat, Parteienwettbewerb.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Föderalismusreform 2006?
Das Ziel war die Stärkung des Bundesstaatsprinzips durch mehr Transparenz, eine bessere Kompetenzzuordnung zwischen Bund und Ländern sowie die Entflechtung der gegenseitigen Abhängigkeiten.
Was besagt die "Politikverflechtungstheorie" von Fritz W. Scharpf?
Sie beschreibt die "Politikverflechtungsfalle", in der notwendige Reformen blockiert werden, weil Bund und Länder sich gegenseitig blockieren und Entscheidungen nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner möglich sind.
Wie erklärt die Strukturbruchtheorie den Erfolg oder Misserfolg von Reformen?
Gerhard Lehmbruchs Theorie fokussiert auf den Gegensatz zwischen dem konsensorientierten Bundesstaat und dem kompetitiven Parteienwettbewerb, was oft zu strukturellen Blockaden führt.
Warum gilt die Föderalismusreform 2006 oft als "Minimalkonsens"?
Wichtige Aspekte wie die Finanzverteilung wurden ausgeklammert, und man einigte sich lediglich auf einen engen Katalog an Neuregelungen, was die grundlegenden Probleme der Verflechtung kaum löste.
Was bedeutet "Pfadabhängigkeit" im Kontext dieser Reform?
Pfadabhängigkeit bedeutet, dass einmal getroffene institutionelle Entscheidungen den zukünftigen Handlungsspielraum so stark einschränken, dass radikale Abweichungen vom bisherigen System extrem schwierig sind.
- Quote paper
- Moritz Boltz (Author), 2008, Föderalismusreform 2006 - Ein Fallbeispiel für Politikverflechtungs- und Strukturbruchtheorie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118008