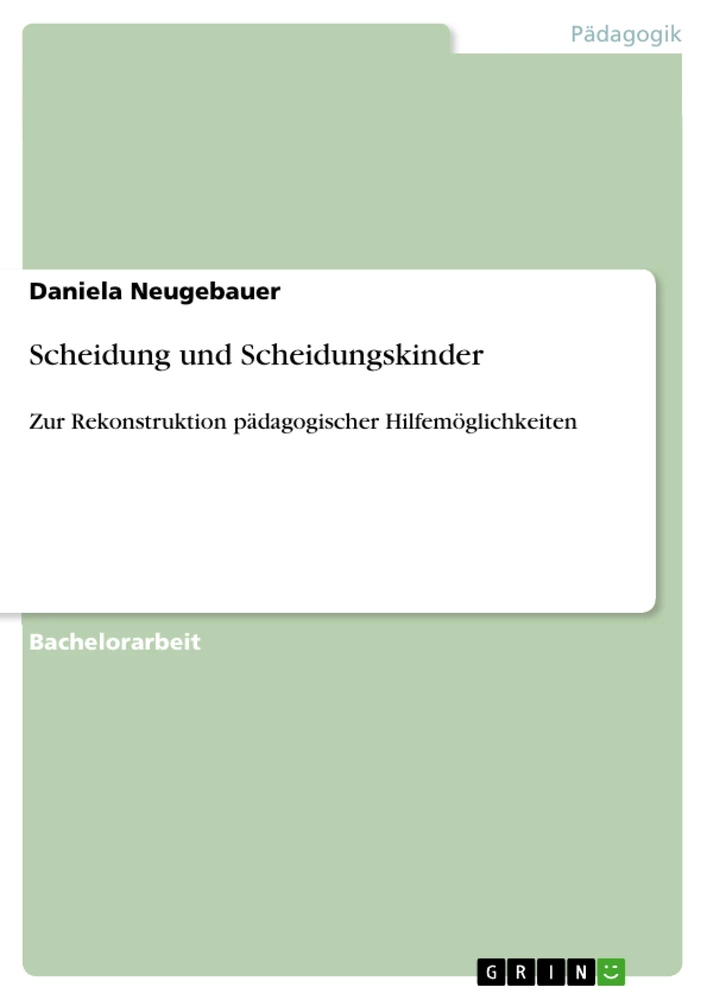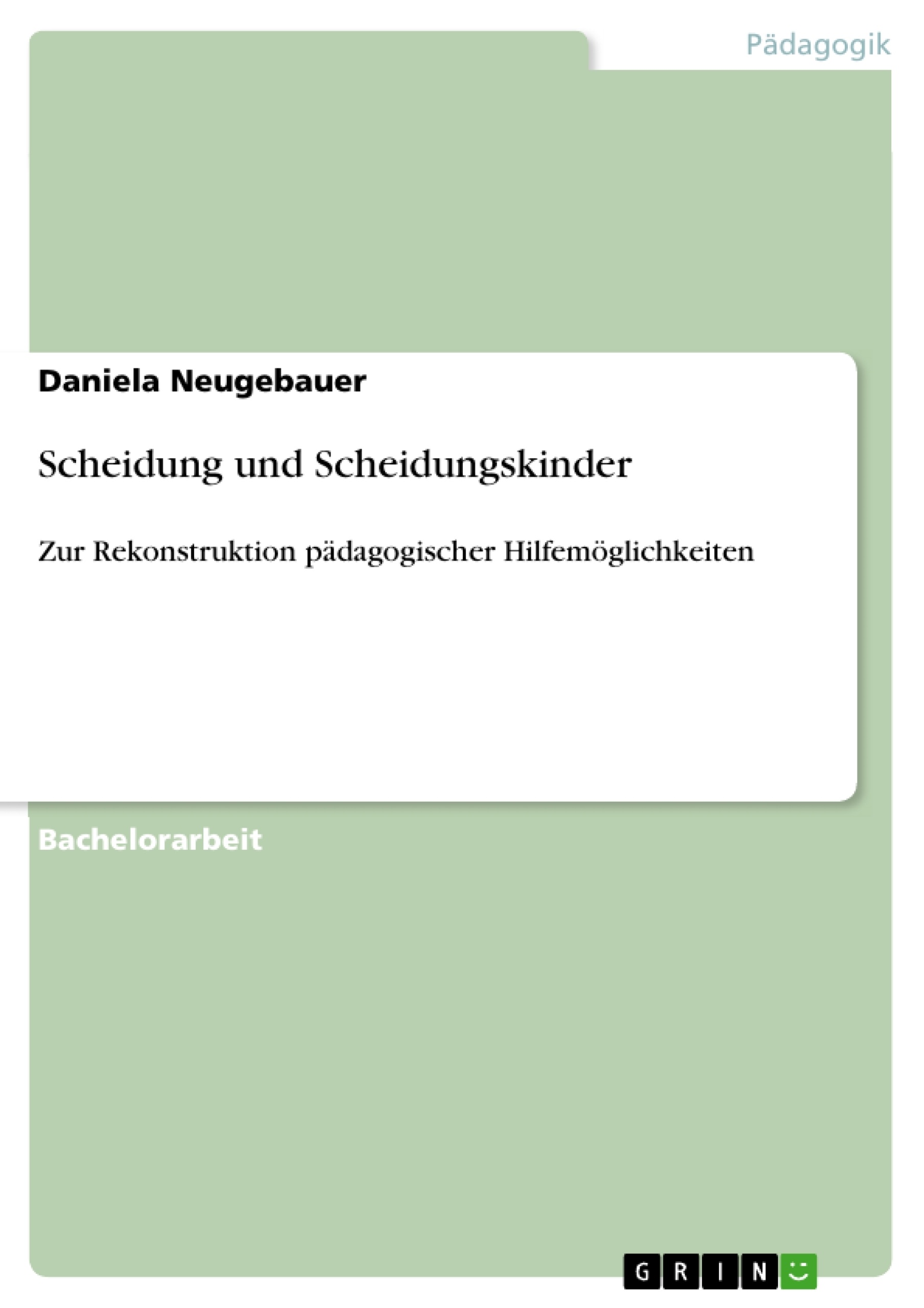Nach meiner Einleitung werde ich mit einem kurzen theoretischen Hintergrund einführen, in dem ich zuerst die Begriffe Familie, Ehe und Scheidung definiere. Danach zeige ich anhand von zwei Abbildungen des Statistischen Bundesamtes die Scheidungsstatistiken in Deutschland der letzten Jahre auf. In dem nächsten Kapitel möchte ich die drei Phasen einer Scheidung aufzeigen und dabei zuerst die Ursachen einer Scheidung darstellen. Nach Wilhelm Buschs Zitat hat bei einer Scheidung meistens einer mehr zu leiden, das sind überwiegend die Kinder. Daher werde ich die Auswirkungen auf die Kinder vor, während und nach der Scheidung veranschaulichen. Dabei stellt sich die Frage, mit welchen Gefühlen und Belastungen Kinder und Jugendliche in so einer Situation konfrontiert werden und ob diese alters- und geschlechtsspezifisch sind.
Im Anschluss daran werde ich mit Hilfe von zwei Studien von E. Mavis Hetherington und Judith Wallerstein und dem Psychoanalytiker Helmuth Figdor die möglichen Langzeitfolgen von Scheidungskindern aufzeigen. Zudem stellt sich die Frage, wie diesen Auswirkungen und auch möglichen Langzeitfolgen entgegengewirkt werden können und welche Hilfestellungen Eltern und auch den Kindern gegeben werden kann, um die Scheidung besser bewältigen zu können. Dazu möchte ich in meinem letzten Kapitel mögliche Hilfestellungen aufzeigen. Danach komme ich zu den Gruppeninterventionsprogrammen und zur Mediation. Am Ende gebe ich noch kurz einen Einblick über die Hilfe des Jugendamtes.
Scheidung ist ein viel diskutiertes und aktuelles Thema in unserer Gesellschaft. Die Zahl der Ehescheidungen ist in der Tendenz steigend. 2012 wurden in Deutschland nach dem Statistischen Bundesamt 387.243 Ehen geschlossen. Die Anzahl der Scheidungen im Jahr 2012 liegt bei 179.147. Das sind ganze 46 % der geschlossenen Ehen in dem Jahr. Mit der Anzahl der Scheidungen steigt auch die Zahl der betroffenen Kinder. Unter den geschiedenen Ehen 2012 waren 88.863 minderjährige Kinder von einer Scheidung betroffen. Meine Arbeit möchte ich diesen betroffenen Kindern widmen, denn mit der Entwicklung der Scheidungsrate haben sich auch die Hilfemöglichkeiten für die Familien und deren Kinder entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Definitionen
- Familie
- Ehe
- Scheidung
- Scheidungsrate in Deutschland
- Definitionen
- Trennungsablauf
- Ambivalenzphase
- Ursachen einer Scheidung
- Auswirkungen auf die Kinder
- Die Scheidungsphase
- Reaktion der Eheleute
- Auswirkungen auf die Kinder
- Nachscheidungsphase
- Veränderung des Familienalltags
- Auswirkungen auf die Kinder
- Ambivalenzphase
- Langzeitfolgen - Das Scheidungskind als Erwachsener
- Hilfemöglichkeiten
- Unprofessionelle Hilfemöglichkeiten
- Familiäre Umfeld als Risiko- und Schutzfaktor
- Soziale Institutionen wie Kindergarten, Schule und Jugendzentrum
- Professionelle Hilfen
- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Gruppeninterventionsprogramme
- Mediation
- Jugendamt
- Unprofessionelle Hilfemöglichkeiten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Scheidung und deren Auswirkungen auf Kinder. Sie zielt darauf ab, die Auswirkungen von Scheidungen auf Kinder vor, während und nach der Scheidung aufzuzeigen und mögliche Hilfestellungen für betroffene Familien aufzuzeigen.
- Definition von Familie, Ehe und Scheidung
- Analyse der Scheidungsrate in Deutschland
- Beschreibung der drei Phasen einer Scheidung und deren Auswirkungen auf Kinder
- Untersuchung der Langzeitfolgen von Scheidungen auf Kinder
- Präsentation von Hilfemöglichkeiten für betroffene Familien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Scheidung und Scheidungskinder in der heutigen Gesellschaft dar. Sie zeigt auf, dass die Anzahl der Scheidungen in Deutschland stetig steigt und somit auch die Zahl der betroffenen Kinder. Das zweite Kapitel bietet einen theoretischen Rahmen für die Analyse der Scheidung. Hier werden die Begriffe Familie, Ehe und Scheidung definiert. Außerdem werden anhand von Statistiken des Statistischen Bundesamtes die aktuellen Scheidungsraten in Deutschland dargestellt.
Das dritte Kapitel fokussiert sich auf den Trennungsablauf und unterteilt diesen in drei Phasen: Ambivalenzphase, Scheidungsphase und Nachscheidungsphase. In jeder Phase werden die Ursachen der Scheidung und die Auswirkungen auf die Kinder im Detail betrachtet.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Langzeitfolgen, die Scheidungskinder im Erwachsenenalter erfahren können. Hierbei werden Studien von E. Mavis Hetherington, Judith Wallerstein und dem Psychoanalytiker Helmuth Figdor herangezogen.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Hilfemöglichkeiten für betroffene Familien. Zunächst werden unprofessionelle Hilfestellungen wie das familiäre Umfeld und soziale Institutionen beleuchtet. Anschließend werden professionelle Hilfen wie Trennungs- und Scheidungsberatung, Gruppeninterventionsprogramme, Mediation und Unterstützung durch das Jugendamt vorgestellt.
Schlüsselwörter
Scheidung, Scheidungskinder, Auswirkungen, Hilfemöglichkeiten, Familiäre Umfeld, Soziale Institutionen, Trennungs- und Scheidungsberatung, Gruppeninterventionsprogramme, Mediation, Jugendamt, Langzeitfolgen, Familienleben, Belastungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen, Psychologische Unterstützung.
- Arbeit zitieren
- M. A. Daniela Neugebauer (Autor:in), 2014, Scheidung und Scheidungskinder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1180617