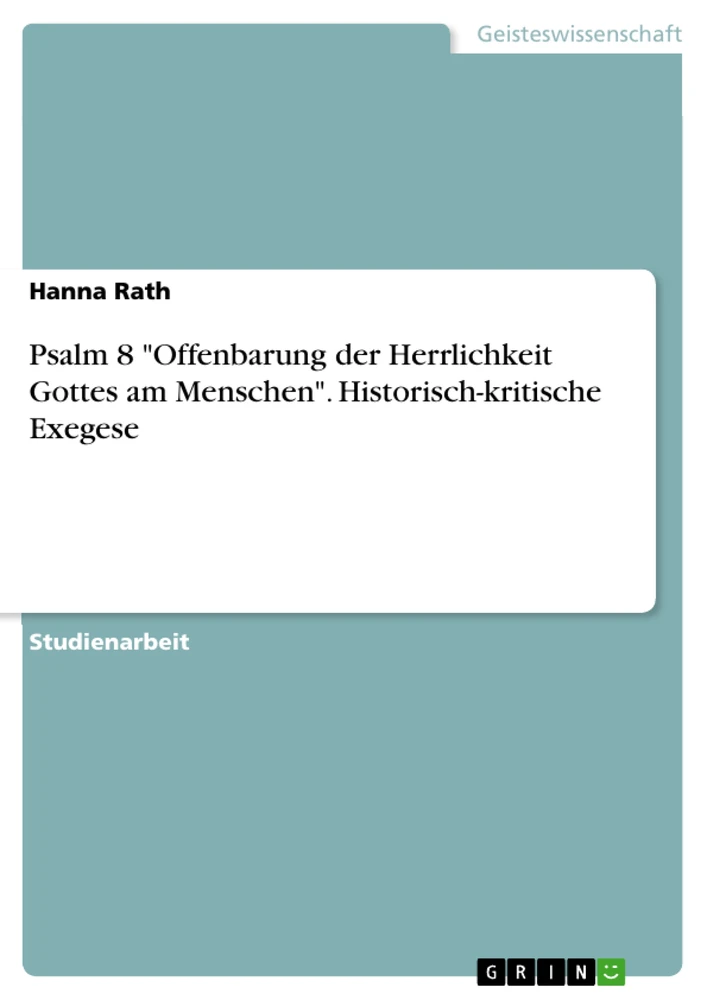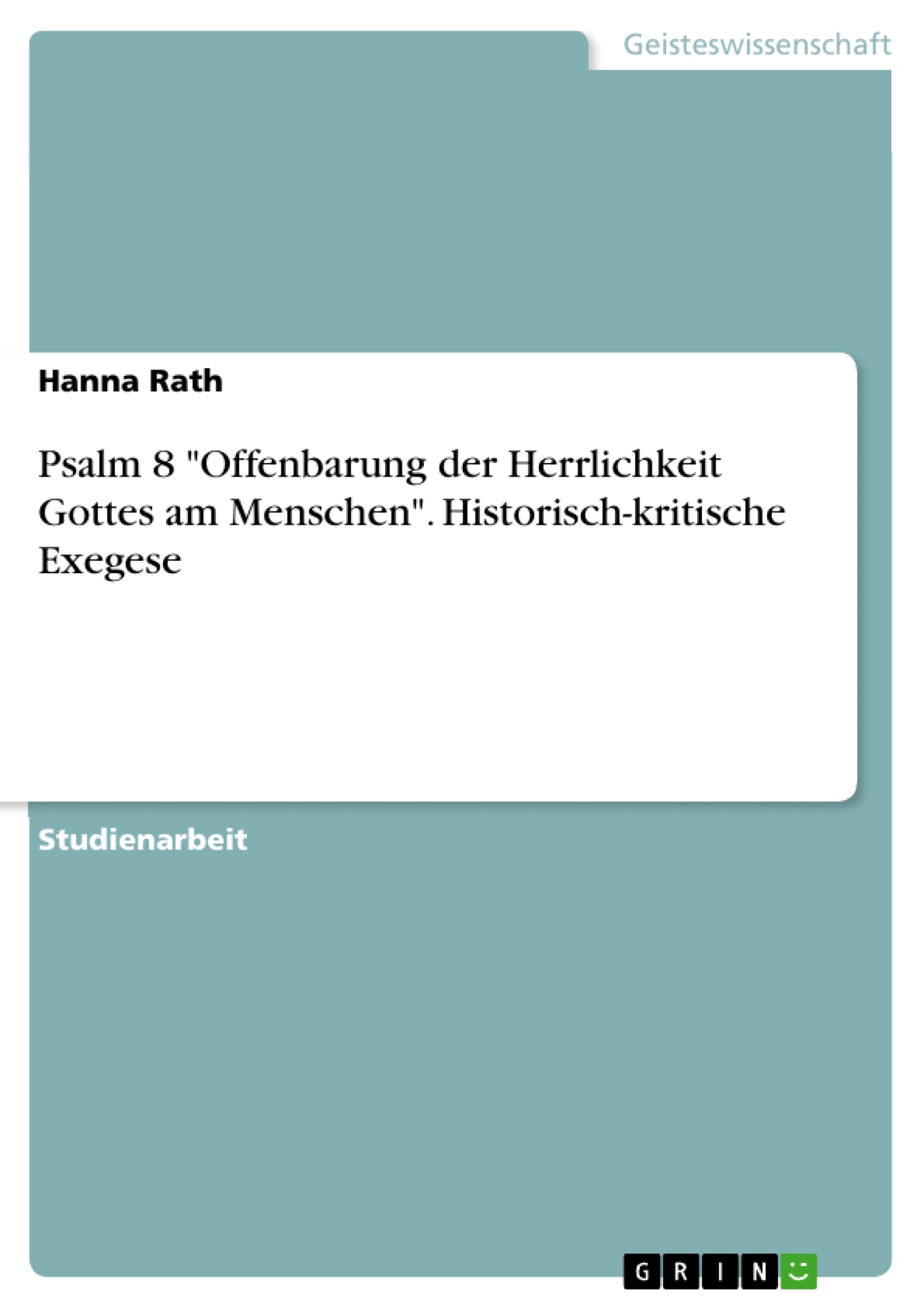Vorliegend handelt es sich um eine historisch-kritische Exegese von Psalm 8. In diesem werden zentrale anthropologische Aussagen formuliert. Schon die Überschrift „Offenbarung der Herrlichkeit Gottes am Menschen“ weckte großes Interesse bei mir. So stelle ich mir die Frage, inwiefern sich die Herrlichkeit Gottes an uns Menschen offenbart und welche Rolle wir Menschen in der Welt einnehmen? Im Folgenden soll nun die Gliederung der Arbeit vorgestellt werden. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass die einzelnen Methodenschritte an dieser Stelle nur kurz genannt werden sollen.
Zu Beginn jeden Kapitels erfolgt dann eine ausführlichere Beschreibung. Zunächst soll Psalm 8 in der deutschen Übersetzung der revidierten Lutherbibel wiedergegeben werden. Im Anschluss daran folgt die Synchrone Textanalyse, in deren Rahmen der Psalm hinsichtlich seiner Textoberfläche, Texttiefenstruktur und Im Anschluss widmet sich die Arbeit der Literarkritik und Redaktionsgeschichte, die ebenfalls die Ergebnisse der synchronen Textanalyse aufgreifen. Das Ziel besteht darin mögliche Spannungen des Textes herauszuarbeiten und das literarische Wachstum des Textes nachzuvollziehen.
Weiterhin werden zwei für das Verständnis des Psalmes relevante Aspekte traditionsgeschichtlich untersucht. Es wird dabei nach der Bedeutung des Verbes „krönen“ gefragt und versucht, die Bedeutung der Begriffe „Kinder und Säuglinge“ zu klären. Abschließend werden die gewonnen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst, zueinander in Beziehung gesetzt und versucht, Antworten auf die in der Einleitung formulierten Fragen zu geben. Ebenso sollen Aussagen zum theologischen Gehalt und historischen Ort des Psalmes getroffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Text in deutscher Übersetzung
- 3. Synchrone Textanalyse
- 3.1 Analyse der Textoberfläche
- 3.2 Analyse der Texttiefenstruktur
- 3.3 Analyse der Textpragmatik
- 4. Gattungskritik
- 5. Literarkritik und Redaktionsgeschichte
- 6. Traditionsgeschichte
- 6.1 Bedeutung des Verbs „krönen“
- 6.2 Bedeutung der Begriffe „Kinder und Säuglinge“
- 7. Abschließende Interpretation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, Psalm 8 einer historisch-kritischen Exegese zu unterziehen, um dessen anthropologische Aussagen zu verstehen. Der Fokus liegt auf der Klärung der Frage, wie sich die Herrlichkeit Gottes am Menschen offenbart und welche Rolle der Mensch in der Welt einnimmt. Die Arbeit analysiert den Psalm anhand verschiedener methodischer Ansätze, wobei die bestehenden Forschungspositionen berücksichtigt und kritisch bewertet werden.
- Anthropologische Aussagen in Psalm 8
- Offenbarung der Herrlichkeit Gottes
- Rolle des Menschen in der Schöpfung
- Analyse der literarischen Struktur und Entstehung des Psalms
- Bedeutung der Schlüsselbegriffe im Psalm
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Ziele der historisch-kritischen Exegese von Psalm 8. Sie hebt die Herausforderungen hervor, die sich durch das hohe Alter des Textes und unterschiedliche historische und kulturelle Kontexte ergeben. Besonders wird die Problematik unterschiedlicher Interpretationen innerhalb der Forschung angesprochen, wobei Schnieringers Werk als zentrale Referenz genannt wird. Die Einleitung skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit und formuliert die zentrale Forschungsfrage nach der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes am Menschen.
2. Text in deutscher Übersetzung: Dieses Kapitel präsentiert den vollständigen Text von Psalm 8 in der deutschen Übersetzung der revidierten Lutherbibel. Die Übersetzung dient als Grundlage für die nachfolgende Analyse.
3. Synchrone Textanalyse: Die synchrone Textanalyse untersucht Psalm 8 auf verschiedenen Ebenen: Die Analyse der Textoberfläche befasst sich mit der sprachlichen Gestaltung und den formalen Merkmalen. Die Analyse der Texttiefenstruktur erforscht die semantischen Beziehungen und den inneren Zusammenhang der einzelnen Verse. Die Analyse der Textpragmatik untersucht die kommunikative Funktion des Textes und dessen Wirkung auf den Rezipienten. Zusammenfassend liefert dieses Kapitel ein umfassendes Verständnis der textuellen Merkmale von Psalm 8.
4. Gattungskritik: Dieses Kapitel widmet sich der Einordnung von Psalm 8 in die Gattungen alttestamentlicher Literatur. Es untersucht die formalen und inhaltlichen Merkmale des Psalms, um seine gattungsspezifische Eigenart zu bestimmen und seinen literarischen Kontext zu klären. Die Ergebnisse liefern wertvolle Hinweise für das Verständnis des Psalms im Gesamtkontext der Psalmenliteratur.
5. Literarkritik und Redaktionsgeschichte: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und Entwicklung von Psalm 8. Anhand der Ergebnisse der synchronen Textanalyse werden mögliche Spannungen im Text herausgearbeitet. Die Literarkritik befasst sich mit der Frage nach der Einheitlichkeit des Textes und der möglichen Existenz verschiedener Schichten oder Redaktionen. Die Redaktionsgeschichte rekonstruiert das literarische Wachstum des Psalms und seine Veränderungen im Laufe der Zeit.
6. Traditionsgeschichte: Dieses Kapitel untersucht traditionsgeschichtlich zwei wichtige Aspekte des Psalms: die Bedeutung des Verbs „krönen“ und die Bedeutung der Begriffe „Kinder und Säuglinge“. Diese Analyse setzt den Psalm in den größeren Kontext seiner literarischen Tradition und beleuchtet die Entwicklung der Bedeutung dieser Schlüsselbegriffe im alttestamentlichen Kontext.
Schlüsselwörter
Psalm 8, Historisch-kritische Exegese, Anthropologie, Herrlichkeit Gottes, Schöpfung, Mensch, Synchrone Textanalyse, Gattungskritik, Literarkritik, Redaktionsgeschichte, Traditionsgeschichte, „krönen“, „Kinder und Säuglinge“, Lobpsalm.
Häufig gestellte Fragen zu: Historisch-kritische Exegese von Psalm 8
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit unterzieht Psalm 8 einer historisch-kritischen Exegese, um dessen anthropologische Aussagen zu verstehen und zu klären, wie sich die Herrlichkeit Gottes am Menschen offenbart und welche Rolle der Mensch in der Welt einnimmt. Die Arbeit analysiert den Psalm anhand verschiedener methodischer Ansätze und berücksichtigt kritisch bestehende Forschungspositionen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf anthropologische Aussagen in Psalm 8, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, die Rolle des Menschen in der Schöpfung, die Analyse der literarischen Struktur und Entstehung des Psalms sowie die Bedeutung der Schlüsselbegriffe im Psalm.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse erfolgt anhand einer synchronen Textanalyse (Textoberfläche, Texttiefenstruktur, Textpragmatik), Gattungskritik, Literarkritik, Redaktionsgeschichte und Traditionsgeschichte. Dabei wird die revidierte Lutherbibel als Grundlage für die deutsche Übersetzung verwendet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Text in deutscher Übersetzung, synchrone Textanalyse, Gattungskritik, Literarkritik und Redaktionsgeschichte, Traditionsgeschichte (inkl. Bedeutung von „krönen“ und „Kinder und Säuglinge“) und abschließende Interpretation. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselfragen werden untersucht?
Zentrale Forschungsfragen sind die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes am Menschen, die Einordnung des Psalms in die Gattungen alttestamentlicher Literatur, die Entstehung und Entwicklung des Psalms sowie die Bedeutung der Schlüsselbegriffe „krönen“ und „Kinder und Säuglinge“ im alttestamentlichen Kontext.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind Psalm 8, historisch-kritische Exegese, Anthropologie, Herrlichkeit Gottes, Schöpfung, Mensch, synchrone Textanalyse, Gattungskritik, Literarkritik, Redaktionsgeschichte, Traditionsgeschichte, „krönen“, „Kinder und Säuglinge“, und Lobpsalm.
Welche Rolle spielt Schnieringers Werk?
Schnieringers Werk wird in der Einleitung als zentrale Referenz genannt und impliziert, dass die Arbeit sich mit bestehenden Interpretationen und Forschungspositionen auseinandersetzt und diese kritisch bewertet.
Welche Übersetzung des Psalms wird verwendet?
Die Arbeit verwendet die deutsche Übersetzung der revidierten Lutherbibel von Psalm 8 als Grundlage für die Analyse.
- Arbeit zitieren
- Hanna Rath (Autor:in), 2012, Psalm 8 "Offenbarung der Herrlichkeit Gottes am Menschen". Historisch-kritische Exegese, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181233