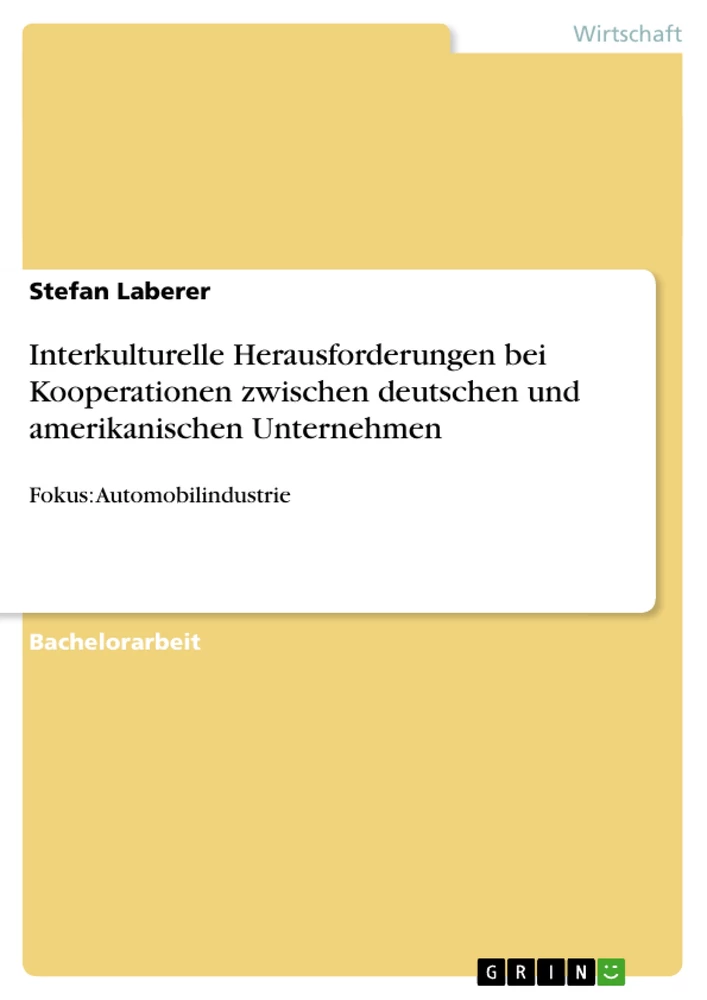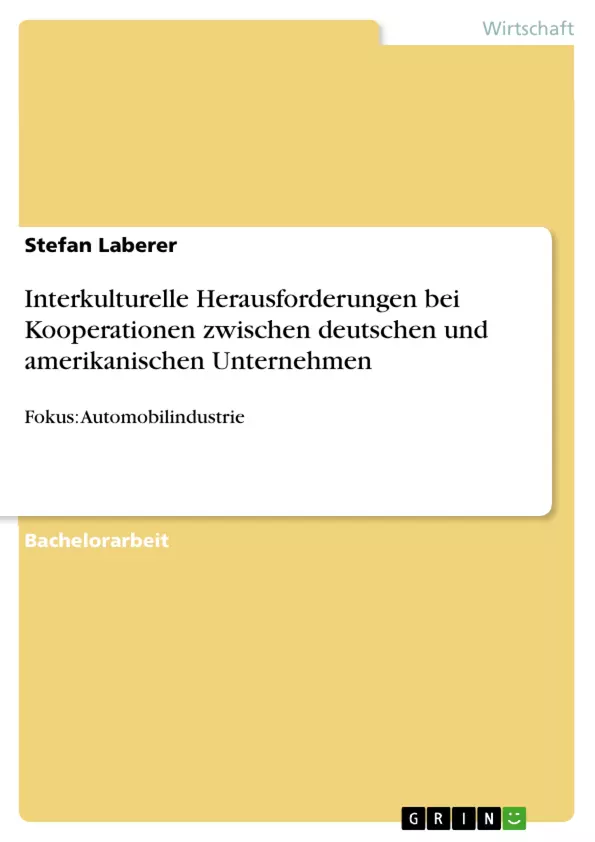Auf Grund der fortschreitenden Globalisierung und des damit verbundenen immer größer werdenden Konkurrenzkampfes in der Automobilindustrie werden Kooperationen in den rückläufigen deutschen und amerikanischen Märkten in Zukunft unausweichlich sein. Doch diese Kooperationen werden nicht nur positive Aspekte mit sich bringen, sondern man wird auch auf interkulturelle Probleme stoßen.
Kultur ist etwas, das sich nur sehr schwer greifen, verstehen oder messen lässt. Zwei die dies sehr erfolgreich durchführten sind Geert Hofstede und Edward Hall. Sie stellten damit die wichtigsten Theorien der Neuzeit auf. Die früher so oft vernachlässigte Unternehmenskultur spielt für den Erfolg von Kooperation ebenso eine wichtige Rolle. Um kulturelle Variablen der einzelnen Länder besser miteinander vergleichen zu können, kann man sie in verschiedene Kategorien einteilen. Zum einen können sich Unterschiede auf den Einzelnen beziehen, aber auf der anderen Seite gibt es auch welche, die sich auf eine ganze Gesellschaft beziehen. Sie liefern die Basis, um sich überhaupt mit anderen Kulturen auseinandersetzen zu können. Etwas mehr ins Detail gehen dann schon die Unterschiede in der Geschäftswelt. Das Beherrschen dieser ist ausschlaggebend für den Verlauf der Zusammenarbeit.
Um die so genannte „interkulturelle Kompetenz“ zu erreichen bzw. zu verbessern gibt es eine Reihe sehr guter Trainingsmöglichkeiten, welche zum Teil auf der Basis der Kulturstandards von A. Thomas beruhen. Für viele große Unternehmen ist eine derartige Schulung ihrer internationalen Mitarbeiter in den letzten Jahren selbstverständlich geworden. Das Fallbeispiel Daimler-Chrysler zeigt, wie stark sich interkulturelle Differenzen in der Praxis negativ auf eine Kooperation auswirken können.
Inhaltsverzeichnis
- Executive Summary
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einführung in die Problematik
- 1.2 Ziele der Arbeit
- 1.3 Vorgehensweise
- 2 Überblick Automobilindustrie
- 2.1 Grundlagen und Entwicklung
- 2.2 Der deutsche Automobilmarkt
- 2.3 Der amerikanische Automobilmarkt
- 2.4 Zukunftsaussichten
- 3 Kultur im Allgemeinen
- 3.1 Was ist Kultur?
- 3.2 Kulturmodelle
- 3.2.1 Hofstedes Modell
- 3.2.2 Halls Modell
- 3.3 Unternehmenskultur
- 3.4 Kulturstandards
- 3.5 Zusammenfassung
- 4 Vergleich kultureller Variablen
- 4.1 Variablen im Bezug auf den Einzelnen
- 4.1.1 Vorurteile und Stereotypen
- 4.1.2 Auffassung von Zeit und Raum
- 4.1.3 Moral und Wertvorstellung
- 4.1.4 Kommunikationsstil
- 4.1.4.1 Informationsaustausch
- 4.1.4.2 Verbale und Nonverbale Kommunikation
- 4.1.5 Religion
- 4.1.6 Soziales Verhalten und Aufbau von Vertrauen
- 4.2 Variablen im Bezug auf die Gesellschaft
- 4.2.1 Personalbeschaffung
- 4.2.2 Lohnstruktur
- 4.2.3 Rechtssystem
- 4.2.3.1 Fallbeispiel: BMW verklagt wegen Neuanstrich
- 4.2.3.2 Unterschiede
- 4.2.4 Ausbildungssystem
- 4.3 Zusammenfassung
- 4.1 Variablen im Bezug auf den Einzelnen
- 5 Kulturelle Unterschiede in der Geschäftswelt
- 5.1 Manager und Führungsstile
- 5.2 Aufgabenorientiert vs. Ergebnisorientiert
- 5.3 Motivation und Teamwork
- 5.4 Verhältnis zur Wirtschaft
- 5.5 Gleichheit der Geschlechter
- 5.6 Verhalten bei Verhandlungen
- 5.7 Zusammenfassung
- 6 Interkulturelle Kompetenz und Möglichkeiten zur Erlangung ...
- 6.1 Interkulturelle Kompetenz
- 6.2 Trainingsmöglichkeiten
- 6.2.1 Informationsorientiertes Training
- 6.2.2 Kulturorientiertes Training
- 6.2.3 Interaktionsorientiertes Training
- 6.2.4 Culture Assimilator Training
- 6.3 Beispiele für die praktische Umsetzungen
- 6.3.1 BMW
- 6.3.2 VW
- 6.4 Zusammenfassung
- 7 Fallbeispiel: DaimlerChrysler AG
- 7.1 Vor der Fusion
- 7.2 Während der Fusion
- 7.3 Nach der Fusion
- 8 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Thesis befasst sich mit den interkulturellen Herausforderungen, die bei Kooperationen zwischen deutschen und amerikanischen Unternehmen im Automobilsektor auftreten. Ziel ist es, die kulturellen Unterschiede zwischen beiden Ländern zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zu beleuchten.
- Kulturmodelle und ihre Bedeutung für interkulturelle Kommunikation
- Kulturelle Unterschiede im Bezug auf den Einzelnen und die Gesellschaft
- Kulturelle Unterschiede in der Geschäftswelt, insbesondere in Bezug auf Management- und Führungsstile
- Interkulturelle Kompetenz und Möglichkeiten zur Erlangung dieser Kompetenz
- Fallbeispiele aus der Automobilindustrie, insbesondere DaimlerChrysler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik der interkulturellen Herausforderungen bei Kooperationen in der Automobilindustrie einführt und die Ziele der Arbeit sowie die Vorgehensweise beschreibt.
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Automobilindustrie, einschließlich der Grundlagen und Entwicklung, des deutschen und amerikanischen Automobilmarktes sowie der Zukunftsaussichten.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Konzept der Kultur, analysiert verschiedene Kulturmodelle (z.B. Hofstede und Hall) und beleuchtet die Bedeutung der Unternehmenskultur.
Kapitel 4 vergleicht kulturelle Variablen im Bezug auf den Einzelnen (z.B. Vorurteile, Zeitverständnis, Kommunikationsstil) und die Gesellschaft (z.B. Personalbeschaffung, Rechtssystem).
Kapitel 5 untersucht kulturelle Unterschiede in der Geschäftswelt, einschließlich Manager- und Führungsstile, Motivation und Teamwork, Verhältnis zur Wirtschaft, Gleichheit der Geschlechter und Verhandlungsverhalten.
Kapitel 6 behandelt das Thema der interkulturellen Kompetenz und präsentiert verschiedene Trainingsmöglichkeiten, um diese Kompetenz zu erlangen.
Kapitel 7 analysiert das Fallbeispiel DaimlerChrysler AG, um die Auswirkungen kultureller Unterschiede auf eine Fusion zu zeigen.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Herausforderungen, Kooperation, Automobilindustrie, Kulturmodelle, Hofstede, Hall, Unternehmenskultur, kulturelle Variablen, interkulturelle Kompetenz, Trainingsmöglichkeiten, DaimlerChrysler, Fusion.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wichtigsten Kulturmodelle für die Wirtschaft?
Die Modelle von Geert Hofstede (Kulturdimensionen) und Edward Hall (Kontext, Zeit, Raum) sind zentral, um Unterschiede in der Zusammenarbeit zwischen Nationen wie Deutschland und den USA zu verstehen.
Wie unterscheidet sich der Kommunikationsstil zwischen Deutschen und US-Amerikanern?
Deutsche kommunizieren oft direkter und sachorientierter, während US-Amerikaner häufig einen eher indirekten, beziehungsorientierten und enthusiastischen Kommunikationsstil pflegen.
Was kann man aus der Fusion von Daimler und Chrysler lernen?
Das Fallbeispiel zeigt, dass mangelndes Verständnis für kulturelle Differenzen und gegensätzliche Unternehmenskulturen trotz wirtschaftlicher Logik zum Scheitern einer Fusion führen können.
Welche Trainingsmöglichkeiten gibt es für interkulturelle Kompetenz?
Es gibt informationsorientierte, kulturorientierte und interaktionsorientierte Trainings sowie den "Culture Assimilator", um Mitarbeiter auf Auslandseinsätze vorzubereiten.
Wie unterscheiden sich die Führungsstile in DE und USA?
In den USA ist Führung oft stärker ergebnisorientiert und hierarchisch-top-down, während in Deutschland fachliche Expertise und Konsensbildung eine größere Rolle spielen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Stefan Laberer (Author), 2008, Interkulturelle Herausforderungen bei Kooperationen zwischen deutschen und amerikanischen Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118312