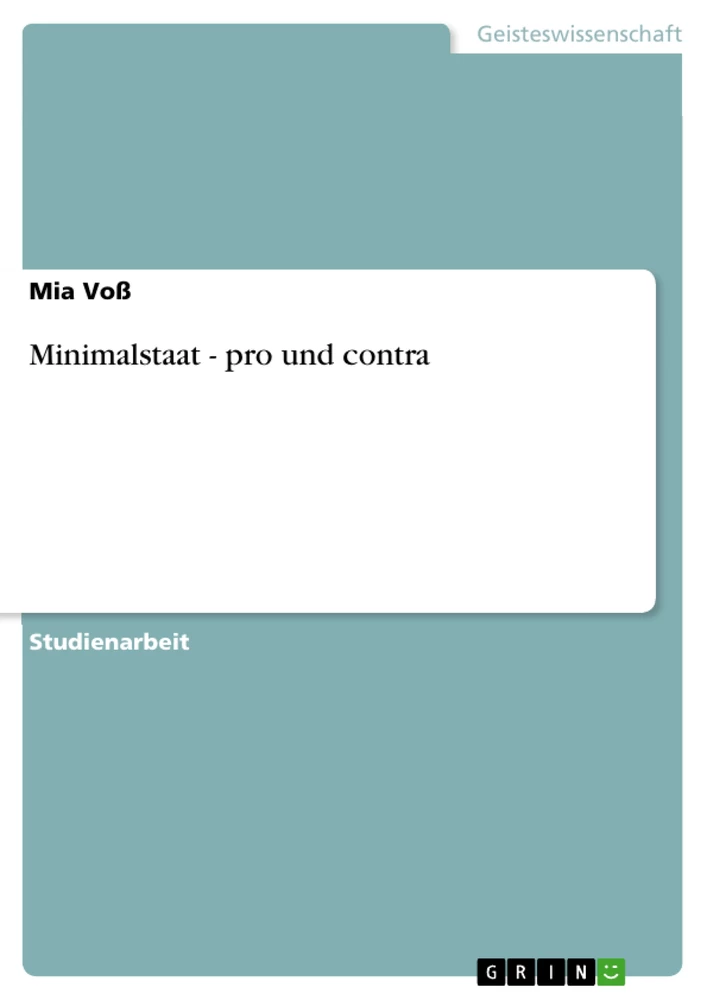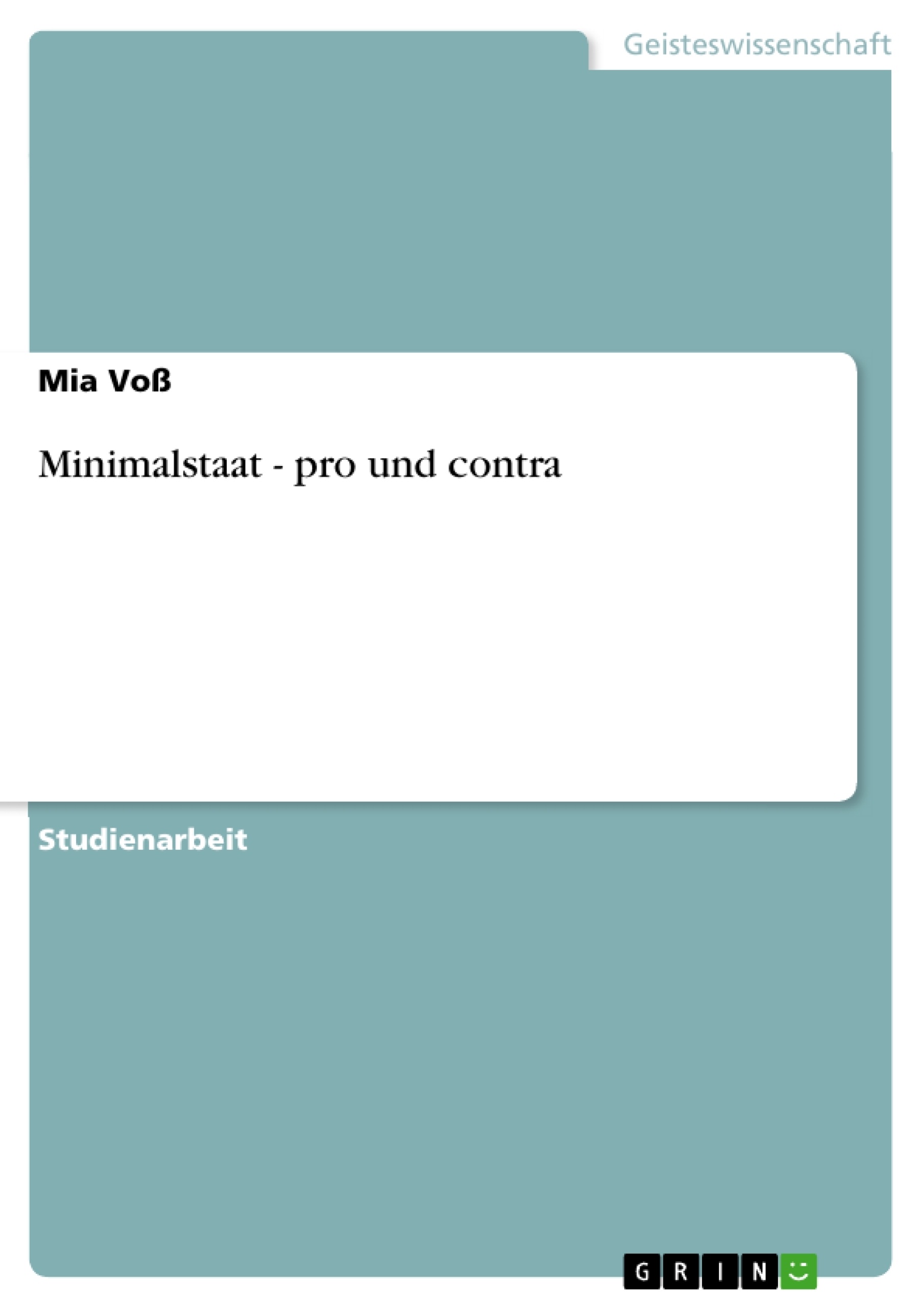Was spricht für einen Minimalstaat, was spricht dagegen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, definiere ich zu Beginn den Begriff des Minimalstaates näher. Das Für und Wider eines Minimalstaates soll zunächst an den Werten der Gerechtigkeit und der Freiheit abgewogen werden. In Bezug auf die Gerechtigkeit soll diskutiert werden, ob ein Minimalstaat oder ein Sozialstaat mehr Gerechtigkeit bringt. Ich stelle hier im Besonderen kurz die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls der von Robert Nozick gegenüber.
Gerade für die Vertreter des Libertarismus spielt die Freiheit eine große Rolle. Doch warum ist sie erstrebenswert? Zunächst wird hier zwischen positiver und negativer Freiheit unterschieden. In Bezug auf die Freiheit werden hier besonders die Überlegungen von John Stuart Mill und Friedrich A. Hayek eine Rolle spielen. An dieser Stelle wird für eine freie Gestaltung der privaten Sphäre, gegen staatlichen Zwang und damit für einen minimalen Staat argumentiert. Auf der anderen Seite wird hier das Argument untersucht, ob die positive Freiheit als aktive Form der Freiheit einen Sozialstaat verlangt. Anschließend ziehe ich dieser normativen Betrachtungsweise einige deskriptive Ansätze zur Freiheit hinzu. In Bezug auf den Freiheitsbegriff werden hier auch Eingriffe des Staates in freiwillige Kooperationen am Beispiel des Mietrechts oder auch Verhinderungen von Kooperationen thematisiert.
Dazu wird die Ungleichheit des Menschen angeführt, womit ich einerseits darauf aufmerksam machen möchte, dass wir alle unterschiedliche Vorstellungen von einem guten Leben sowie unterschiedliche Talente haben. Jedoch wird andererseits auch gezeigt, dass wir alle unterschiedlich gute Chancen haben, unsere Ziele zu erreichen. Hierbei untersuche ich, was sich daraus für unsere Überlegungen zum Minimalstaat ergibt. Abschließend wird das Phänomen der Diskriminierung in Bezug auf den Minimalstaat thematisiert, wobei ich hier besonders auf die Einsichten von Michael Oliva Córdoba zurückgreife. Es geht hier einerseits um staatliche Diskriminierung als Machtmissbrauch und andererseits auch um affirmativ action als Eingreifen des Staates in die private Sphäre, mit dem Ziel des Ausgleichs diskriminierenden Verhaltens.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition: Minimalstaat
- Gerechtigkeit: Minimalstaat vs. Sozialstaat
- Die Freiheit des Individuums
- Kooperation
- Ungleichheit
- Staatliche Diskriminierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Konzept des Minimalstaates auseinander und analysiert dessen Vor- und Nachteile. Im Fokus stehen dabei die Werte der Gerechtigkeit und der Freiheit, wobei insbesondere die Frage untersucht wird, ob ein Minimalstaat oder ein Sozialstaat die gerechtere Gesellschaft ermöglicht. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle der Freiheit des Individuums und die potenziellen Auswirkungen des Minimalstaates auf die soziale Ungleichheit. Des Weiteren werden staatliche Eingriffe in die private Sphäre und das Phänomen der Diskriminierung im Kontext des Minimalstaates beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung des Minimalstaates
- Vergleich der Gerechtigkeitskonzepte von Minimalstaat und Sozialstaat
- Analyse der Freiheit des Individuums im Kontext des Minimalstaates
- Bedeutung sozialer Ungleichheit und die Frage nach staatlichen Interventionen
- Staatliche Diskriminierung und die Rolle des Minimalstaates
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Minimalstaates ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Argumenten für und gegen ein solches Staatsmodell. Dabei werden die Werte der Gerechtigkeit und der Freiheit als zentrale Bezugspunkte eingeführt und die wichtigsten Themenbereiche der Arbeit skizziert.
2. Definition: Minimalstaat
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Minimalstaates und beleuchtet die libertäre Perspektive auf die Rolle des Staates. Dabei wird auf die Bedeutung von „Limited Government“ und „Small Government“ im libertären Diskurs eingegangen und die Argumente für eine begrenzte staatliche Einmischung in das Leben der Bürger erläutert.
3. Gerechtigkeit: Minimalstaat vs. Sozialstaat
Das dritte Kapitel widmet sich dem Vergleich des Minimalstaates mit dem Sozialstaat im Hinblick auf das Prinzip der Gerechtigkeit. Die Arbeit setzt sich mit den Argumenten für und gegen ein staatliches Sozialsystem auseinander und beleuchtet die Kritik am Libertarismus, der zu einer massiven sozialen Ungleichheit führen könnte. Hierbei werden auch die Positionen von John Rawls und Robert Nozick zur Gerechtigkeitsfrage im Kontext des Minimalstaates diskutiert.
4. Die Freiheit des Individuums
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Freiheit des Individuums im Kontext des Minimalstaates. Es werden verschiedene Ansätze zur Freiheit, insbesondere die Unterscheidung zwischen positiver und negativer Freiheit, erörtert. Die Arbeit untersucht die Argumente für einen minimalen Staat, der die private Sphäre schützt und staatliche Eingriffe auf ein Minimum reduziert. Gleichzeitig werden auch die Auswirkungen des Minimalstaates auf die soziale Ungleichheit und die Rolle der positiven Freiheit in diesem Kontext beleuchtet.
5. Staatliche Diskriminierung
Das fünfte Kapitel thematisiert die Problematik der Diskriminierung im Kontext des Minimalstaates. Es geht dabei um staatliche Diskriminierung als Machtmissbrauch und die Frage, ob der Staat in die private Sphäre eingreifen darf, um diskriminierendes Verhalten zu kompensieren. Die Arbeit bezieht sich dabei auf die Einsichten von Michael Oliva Córdoba und analysiert die Vor- und Nachteile von Maßnahmen wie „affirmative action“.
Schlüsselwörter
Minimalstaat, Libertarismus, Gerechtigkeit, Freiheit, Sozialstaat, Ungleichheit, Diskriminierung, staatliche Interventionen, positive Freiheit, negative Freiheit, „Limited Government“, „Small Government“
- Arbeit zitieren
- Mia Voß (Autor:in), 2021, Minimalstaat - pro und contra, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1185134