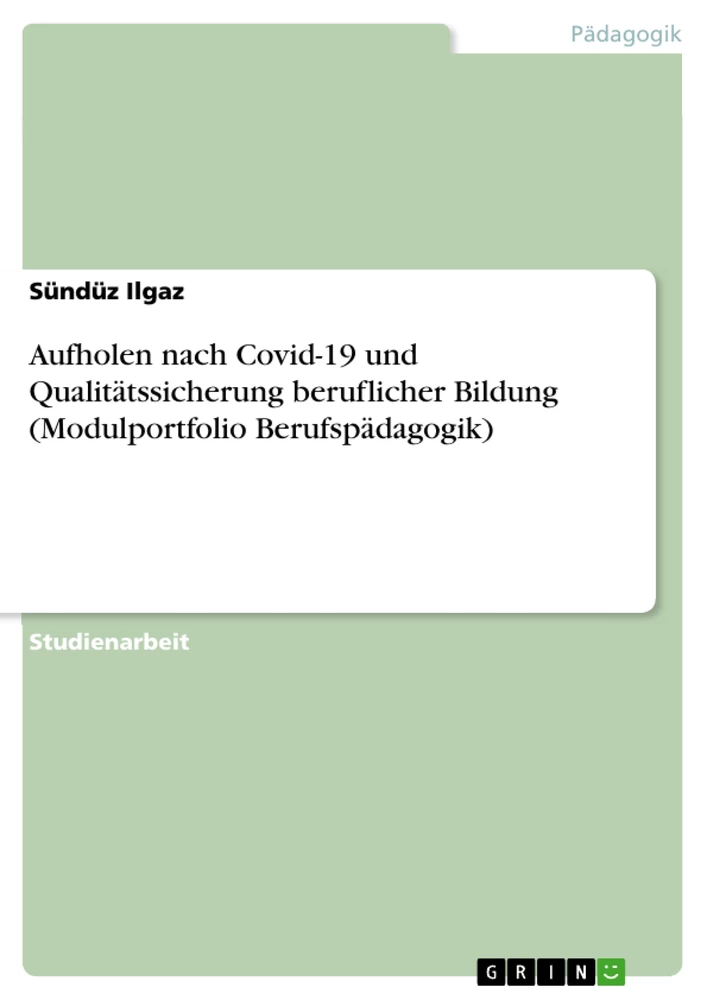Diese Arbeit stellt ein Modulportfolio des Mastermoduls "vertiefende Aspekte der Berufspädagogik im Kontext von Evaluation, Steuerung und Bildungsforschung" im Master of Education dar. Die behandelten Lehrveranstaltungen behandeln folgende Themen:
1: "Struktur, Evaluation und Entwicklung des deutschen Schulsystems"
2: "Struktur, Evaluation und Entwicklung von Institutionen der beruflichen Bildung im internationalen bzw. europäischen Vergleich"
3: "Nachhaltigkeit im Unterricht?!- Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung"
Inhaltsverzeichnis
- MC 1 - DIE SITUATION DES DEUTSCHEN SCHULSYSTEMS VOR DEM HINTERGRUND DES VON DER LANDESREGIERUNG KONZIPIERTEN PROGRAMMS „AUFHOLEN NACH CORONA“
- EINLEITUNG
- ANALYSE UND BEWERTUNG DES AKTIONSPROGRAMMS
- ANALYSE UND BEWERTUNG AUS DER BILDUNGSSOZIOLOGISCHEN PERSPEKTIVE
- ANALYSE UND BEWERTUNG AUS DER SCHULTHEORETISCHEN PERSPEKTIVE
- REFLEXION
- PRAXISBEZUG UND TRANSFER
- MC 2 „QUALITÄTSSICHERUNG BERUFLICHER BILDUNG“
- EINLEITUNG
- WELCHE FAKTOREN BEEINFLUSSEN DIE QUALITÄT BETRIEBLICHER AUSBILDUNG?
- SCHLUSSBETRACHTUNG
- REFLEXION
- MC 3: „KONZEPTION EINER LERNSITUATION IM HINBLICK AUF DIE BBNE AM BEISPIEL DER AUSBILDUNG „AUTOMOBILKAUFMANN/FRAU“
- EINLEITUNG
- KONZEPTION EINER LERNSITUATION AM BEISPIEL DES AUSBILDUNGSBERUFS AUTOMOBILKAUFMANN/-FRAU
- GESTALTUNG DER LERNSITUATION ALS SZENARIO
- ERLÄUTERUNG DER LERNSITUATION ANHAND DES MODELLS DER VOLLSTÄNDIGEN HANDLUNG
- ANALYSE DER KONZIPIERTEN LERNSITUATION IM HINBLICK AUF DIE DIDAKTISCHEN PRINZIPIEN
- FAZIT
- REFLEXION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Berufspädagogik im Kontext von Evaluation, Steuerung und Bildungsforschung. Es analysiert das deutsche Schulsystem im Lichte des Programms „Aufholen nach Corona“ und untersucht die Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung. Darüber hinaus wird die Konzeption einer Lernsituation im Hinblick auf die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) am Beispiel des Ausbildungsberufs „Automobilkaufmann/frau“ vorgestellt.
- Die Auswirkungen des Programms „Aufholen nach Corona“ auf das deutsche Schulsystem
- Faktoren, die die Qualität betrieblicher Ausbildung beeinflussen
- Konzeption einer Lernsituation im Hinblick auf die BNE
- Analyse der Lernsituation anhand des Modells der vollständigen Handlung
- Didaktische Prinzipien in der Konzeption von Lernsituationen
Zusammenfassung der Kapitel
MC 1 - DIE SITUATION DES DEUTSCHEN SCHULSYSTEMS VOR DEM HINTERGRUND DES VON DER LANDESREGIERUNG KONZIPIERTEN PROGRAMMS „AUFHOLEN NACH CORONA“
Dieses Kapitel analysiert das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ aus bildungssoziologischer und schultheoretischer Perspektive. Es werden die Stärken und Schwächen des Programms sowie dessen Auswirkungen auf das deutsche Schulsystem untersucht. Die Reflexion fokussiert auf die praktische Umsetzung des Programms und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben.
MC 2 „QUALITÄTSSICHERUNG BERUFLICHER BILDUNG“
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Faktoren, die die Qualität betrieblicher Ausbildung beeinflussen, beleuchtet. Die Schlussbetrachtung fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und die Reflexion befasst sich mit den eigenen Erfahrungen und Eindrücken.
MC 3: „KONZEPTION EINER LERNSITUATION IM HINBLICK AUF DIE BBNE AM BEISPIEL DER AUSBILDUNG „AUTOMOBILKAUFMANN/FRAU“
Dieses Kapitel beschreibt die Konzeption einer Lernsituation im Ausbildungsberuf „Automobilkaufmann/frau“ mit dem Fokus auf die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Die Gestaltung der Lernsituation als Szenario und die Erläuterung anhand des Modells der vollständigen Handlung werden vorgestellt. Die Analyse der Lernsituation im Hinblick auf die didaktischen Prinzipien rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Dieses Portfolio beschäftigt sich mit den Themen Bildungssystem, Evaluation, Qualitätssicherung, berufliche Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Lernsituation, vollständige Handlung, didaktische Prinzipien.
- Quote paper
- Sündüz Ilgaz (Author), 2021, Aufholen nach Covid-19 und Qualitätssicherung beruflicher Bildung (Modulportfolio Berufspädagogik), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188842