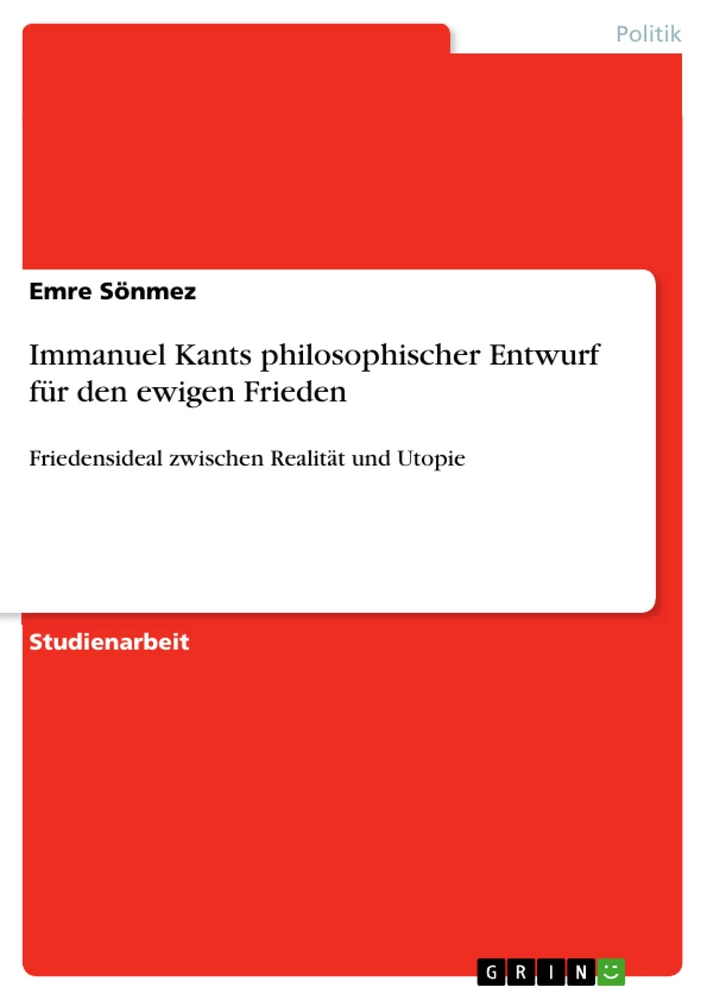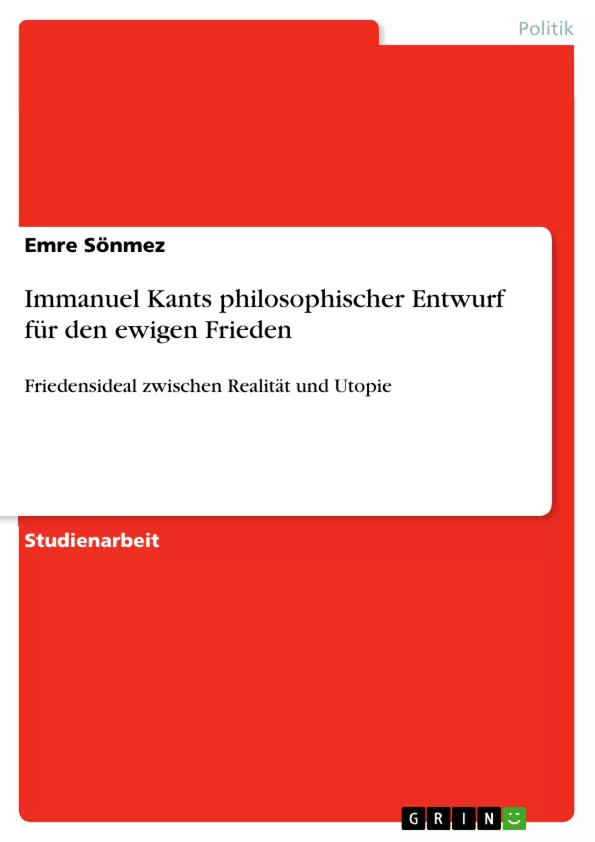In dieser Arbeit soll zunächst Kants philosophische Auseinandersetzung mit dem Frieden in seiner Friedensschrift untersucht werden. Dabei werden der von Kant angestrebte Typus der Friedenstheorie, die Beziehungsstruktur und der Zweck seiner Abhandlung näher beleuchtet. Im zweiten Teil der Arbeit werden Praxisbezüge hergestellt, wozu das internationale Recht näher betrachtet wird, um den Grad der Umsetzung nachzuvollziehen. Im Anschluss wird die Theorie-Praxis-Debatte beleuchtet, um den Inhalt der Verwirklichung beziehungsweise das Utopische in der Friedenstheorie zu identifizieren. Zuletzt folgt ein Fazit über das Spannungsverhältnis des utopischen Ansatzes mit den realistischen Verwirklichungschancen.
Immanuel Kant wird im Westen als ein überragender Denker geehrt. Seinen Ruhm als politischer Autor bestritt er durch seine philosophische Abhandlung „Zum ewigen Frieden“. Historiker streiten über den Anlass seines Textes. Ausgangpunkt könnte der Frieden von Basel zwischen Preußen und Frankreich von 1795 sein. Der genaue Anlass ist jedoch nicht bekannt. Es ist allerdings festzustellen, dass seine Abhandlung von historischem und sozialgeschichtlichem Wissen inspiriert, von Erfahrungen geprägt und konzeptionell sehr differenziert ist. Während zu seiner Zeit der Begriff und die Idee des Friedens lediglich ein Wunschdenken, aber kein greifbares Objekt der Philosophie war, bildet Kants Abhandlung eine Ausnahme dar. Die beiden Worte "ewig" und "Frieden" in der Überschrift seiner Abhandlung hätten Kant als Kenner der politischen Wirklichkeit und seinen Rang als politischer Denker schmälern können, aber beide Befürchtungen treffen nicht zu.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Friedentheorie nach Kant
- Leges strictae
- Leges latae
- Die Verwirklichung der Theorie
- Theorie-Praxis-Debatte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Immanuel Kants philosophisches Konzept des ewigen Friedens, das in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ dargelegt wird. Sie untersucht die Struktur und die Inhalte der von Kant entwickelten Friedenstheorie und beleuchtet deren Relevanz für die heutige Zeit.
- Die Struktur und die Inhalte der Friedenstheorie nach Kant
- Die Relevanz von Kants Friedenstheorie für das internationale Recht und die Praxis
- Die Spannungsverhältnisse zwischen dem utopischen Ideal des ewigen Friedens und den realen Verwirklichungschancen
- Die Bedeutung von Kants Gedanken für die Entwicklung der heutigen Friedensforschung
- Die Frage nach der Möglichkeit und Notwendigkeit eines globalen Friedens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt Immanuel Kants „Zum ewigen Frieden“ als Ausgangspunkt der Analyse vor.
Der Abschnitt „Friedentheorie nach Kant“ beschäftigt sich mit den Grundprinzipien von Kants Friedenstheorie. Er beleuchtet die von Kant aufgestellten Regeln, die zum Erhalt des Friedens beitragen sollen, und analysiert die Leges strictae und Leges latae.
Schlüsselwörter
Immanuel Kant, philosophischer Entwurf, ewiger Frieden, Friedenstheorie, internationales Recht, Theorie-Praxis-Debatte, Utopie, Realismus, Friedensforschung, globales Friedensideal.
Häufig gestellte Fragen zu Kants „Zum ewigen Frieden“
Was sind die „Präliminarartikel“ in Kants Friedensschrift?
Es sind sechs Bedingungen (Leges strictae), die sofort erfüllt sein müssen, um einen dauerhaften Frieden überhaupt erst zu ermöglichen, wie z. B. das Verbot der Einmischung in die Verfassung anderer Staaten.
Was besagt der „Definitivartikel“ über die Staatsform?
Kant fordert, dass die bürgerliche Verfassung in jedem Staat republikanisch sein muss, da Bürger, die selbst über Krieg entscheiden, vorsichtiger sind als autokratische Herrscher.
Was versteht Kant unter einem „Völkerbund“?
Er schlägt einen föderalen Bund freier Staaten vor (keinen Weltstaat), der den Frieden sichert und das Völkerrecht auf gegenseitigem Respekt begründet.
Ist Kants Entwurf eine Utopie?
Obwohl oft als utopisch bezeichnet, sah Kant seinen Entwurf als reale politische Notwendigkeit und als Fernziel, auf das die Menschheit hinarbeiten muss.
Welchen Einfluss hat die Schrift auf das heutige Völkerrecht?
Kants Gedanken waren wegweisend für die Gründung des Völkerbundes und später der Vereinten Nationen (UN) sowie für das moderne Verständnis von Menschenrechten.
- Quote paper
- Emre Sönmez (Author), 2021, Immanuel Kants philosophischer Entwurf für den ewigen Frieden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1189416