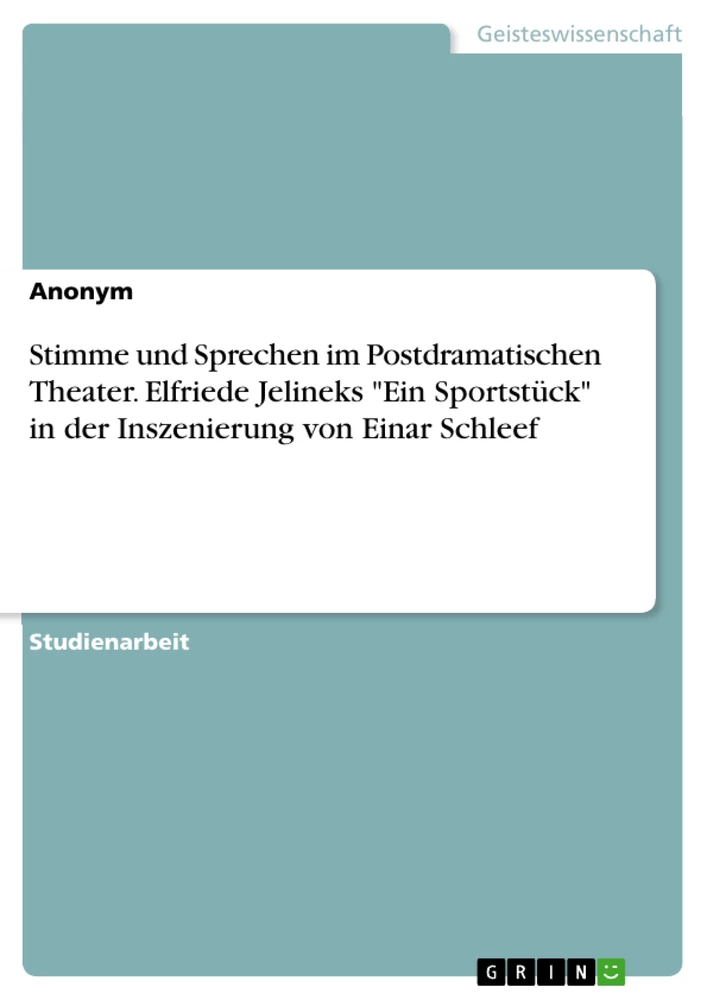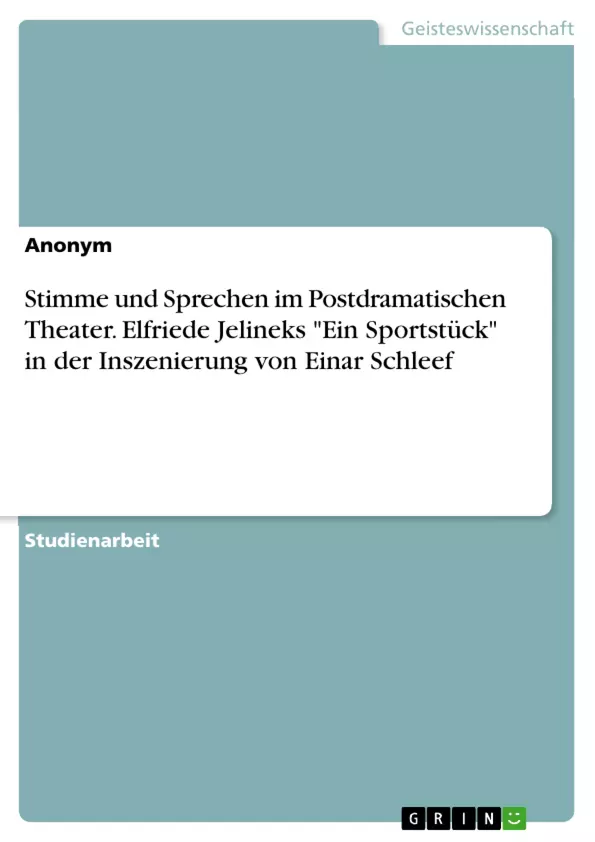Die Analyse der Stimmlichkeit gewann in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung. Neue Technologie und das Aufkommen neuer Theaterformen, wie das Performancetheater sind Gründe dafür. Der Stimme kommt eine stärkere Eigenwirklichkeit zu und wird in besonderer Weise ausgestellt und erfahrbar gemacht.
Die Arbeit untersucht, welche Möglichkeiten der besonderen Stimmerfahrung es im Theater gibt und auf welche konkrete Art und Weise sie angewandt werden. Wie hat sich der Umgang mit der Stimme im Theater der 1990er Jahre gegenüber dem dramatischen Theater verändert? Was sind die spezifischen Mittel, mit denen Stimmlichkeit ausgestellt wird?
Dafür befasst sich die Arbeit zunächst mit Jenny Schrödls Untersuchungen zur Stimmlichkeit im postdramatischen Theater und bezieht die Erkenntnisse im zweiten Teil auf Elfriede Jelineks "Ein Sportstück" (1998) in der Inszenierung von Einar Schleef. Die Uraufführung fand in jener Inszenierung 1998 am Wiener Burgtheater statt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stimme und Sprechen auf der Bühne im Dramatischen und Postdramatischen Theater
- Analysebeispiel: Ein Sportstück von Elfriede Jelinek in der Inszenierung von Einar Schleef am Wiener Burgtheater 1998
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Veränderung des Umgangs mit Stimme und Sprechen im Theater der 1990er Jahre, insbesondere im Vergleich zwischen dramatischem und postdramatischem Theater. Der Fokus liegt auf der Analyse der Möglichkeiten besonderer Stimmerfahrung und deren Anwendung im postdramatischen Theater.
- Vergleich von Stimme und Sprechen im dramatischen und postdramatischen Theater
- Analyse der Materialität der Stimme im postdramatischen Theater
- Die Rolle des Textes im postdramatischen Theater
- Strategien zur Ausstellung von Stimmlichkeit
- Analyse von Elfriede Jelineks "Ein Sportstück" als Beispiel für postdramatisches Theater
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der veränderten Bedeutung von Stimmlichkeit im Theater ein, begründet die Relevanz der Untersuchung und skizziert den methodischen Ansatz. Die Arbeit konzentriert sich auf den Vergleich des Umgangs mit der Stimme im dramatischen und postdramatischen Theater, wobei Jelineks "Ein Sportstück" als Fallbeispiel dient. Die Autorin kündigt an, die Erkenntnisse von Jenny Schrödl zur Stimmlichkeit im postdramatischen Theater zu verwenden und diese auf die Analyse des gewählten Stücks anzuwenden.
Stimme und Sprechen auf der Bühne im Dramatischen und Postdramatischen Theater: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel der Rolle der Stimme im Theater. Im traditionellen, dramatischen Theater diente die Stimme primär der Vermittlung des Textes, wobei Klarheit und Verständlichkeit im Vordergrund standen. Goethes Schauspielerregeln werden als Beispiel für diesen traditionellen Ansatz herangezogen. Im Gegensatz dazu steht das postdramatische Theater, in dem die Stimme als autonomes Phänomen betrachtet wird. Ihre Materialität, ihr Klang und Rhythmus gewinnen an Bedeutung, während der Text an Bedeutung verliert. Die Autorin diskutiert die Folgen dieser Verschiebung und die neuen Formen des Theatertextes, die sich daraus ergeben haben, wobei sie Autoren wie Jelinek, Müller und Handke erwähnt.
Analysebeispiel: Ein Sportstück von Elfriede Jelinek in der Inszenierung von Einar Schleef am Wiener Burgtheater 1998: Dieses Kapitel (dessen Inhalt aufgrund der Kürze des vorliegenden Textes nicht vollständig rekonstruierbar ist) wird voraussichtlich eine detaillierte Analyse von Jelineks "Ein Sportstück" in Schleefs Inszenierung bieten. Dabei wird sich die Autorin wahrscheinlich auf die in Kapitel 2 dargestellten theoretischen Überlegungen stützen und die konkreten Strategien untersuchen, mit denen Stimmlichkeit in dieser Inszenierung ausgestellt wird.
Schlüsselwörter
Stimme, Sprechen, Theater, Postdramatisches Theater, Dramatisches Theater, Stimmlichkeit, Elfriede Jelinek, Ein Sportstück, Einar Schleef, Materialität, Text, Aufführung, Körperstimme.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Stimme und Sprechen im postdramatischen Theater am Beispiel von Elfriede Jelineks "Ein Sportstück"
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Wandel des Umgangs mit Stimme und Sprechen im Theater der 1990er Jahre, insbesondere den Vergleich zwischen dramatischem und postdramatischem Theater. Der Fokus liegt auf der Analyse der Möglichkeiten besonderer Stimmerfahrung und deren Anwendung im postdramatischen Theater, am Beispiel von Elfriede Jelineks "Ein Sportstück" in der Inszenierung von Einar Schleef.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich von Stimme und Sprechen im dramatischen und postdramatischen Theater, die Analyse der Materialität der Stimme im postdramatischen Theater, die Rolle des Textes im postdramatischen Theater, Strategien zur Ausstellung von Stimmlichkeit und eine detaillierte Analyse von Elfriede Jelineks "Ein Sportstück" als Beispiel für postdramatisches Theater.
Wie wird die Thematik untersucht?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, der das traditionelle, dramatische Theater mit dem postdramatischen Theater kontrastiert. Dabei wird die Bedeutung der Stimme und des Sprechens in beiden Theaterformen untersucht. Die Analyse von Jelineks "Ein Sportstück" dient als Fallbeispiel, um die theoretischen Überlegungen zu illustrieren. Die Erkenntnisse von Jenny Schrödl zur Stimmlichkeit im postdramatischen Theater fließen in die Analyse mit ein.
Welche Autoren und Werke werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt Elfriede Jelinek ("Ein Sportstück"), sowie Autoren wie Heiner Müller und Peter Handke im Kontext des postdramatischen Theaters. Goethes Schauspielerregeln werden als Beispiel für den traditionellen, dramatischen Ansatz herangezogen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich von Stimme und Sprechen im dramatischen und postdramatischen Theater, ein Kapitel mit der Analyse von Jelineks "Ein Sportstück" und ein Fazit.
Was ist das zentrale Argument der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass im postdramatischen Theater die Stimme als autonomes Phänomen betrachtet wird, ihre Materialität, ihr Klang und Rhythmus an Bedeutung gewinnen, während der Text an Bedeutung verliert. Dies führt zu neuen Formen des Theatertextes und neuen Strategien der Stimmlichkeit auf der Bühne.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stimme, Sprechen, Theater, Postdramatisches Theater, Dramatisches Theater, Stimmlichkeit, Elfriede Jelinek, Ein Sportstück, Einar Schleef, Materialität, Text, Aufführung, Körperstimme.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Stimme und Sprechen im Postdramatischen Theater. Elfriede Jelineks "Ein Sportstück" in der Inszenierung von Einar Schleef, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191122