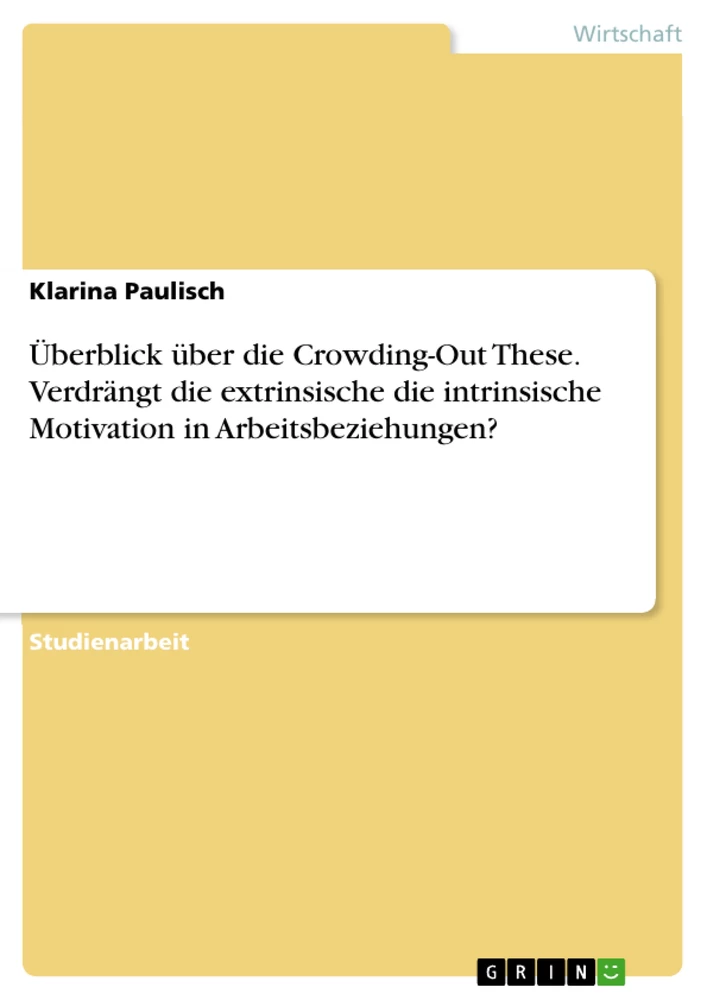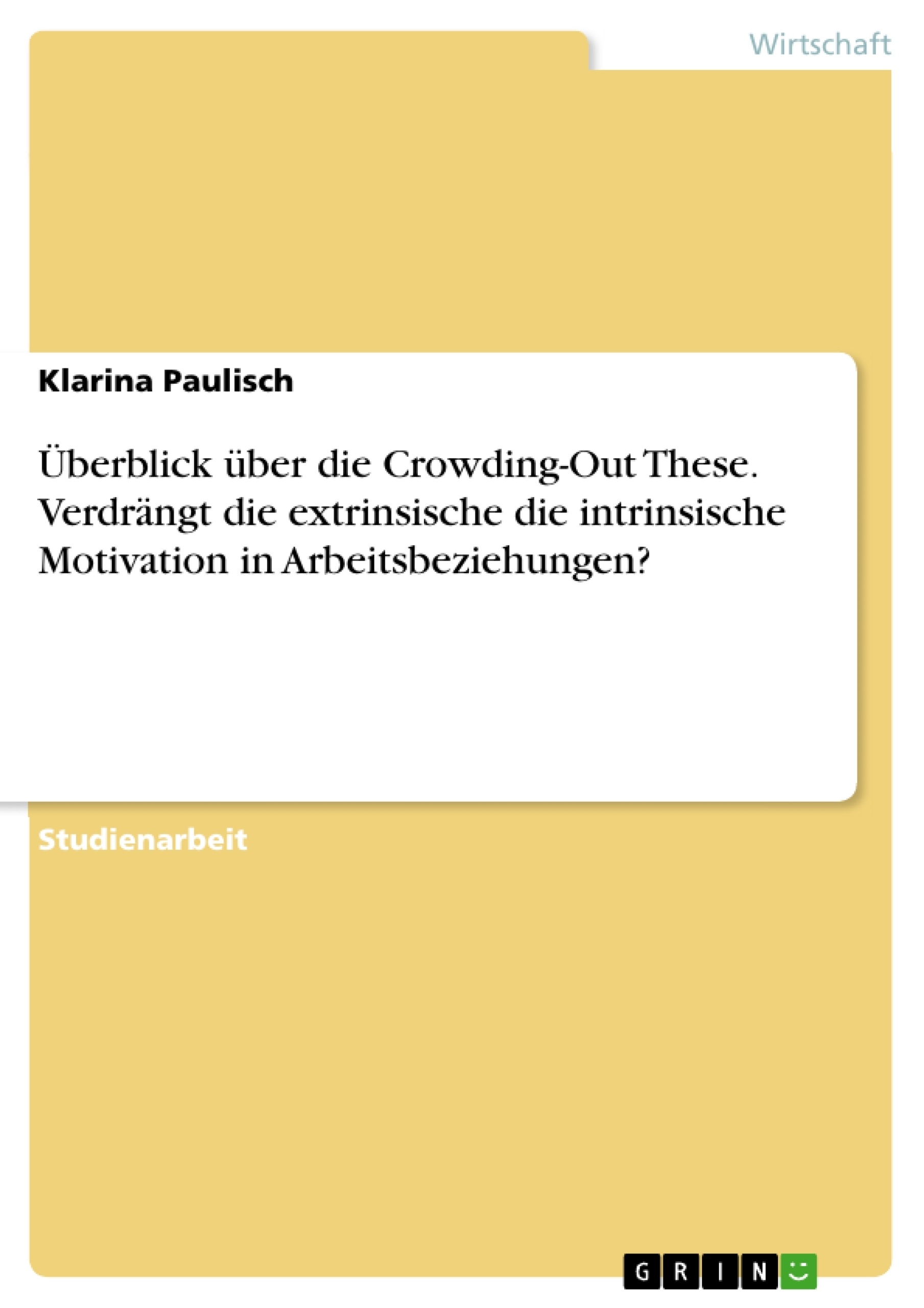Die Seminararbeit beschäftigt sich mit der extrinsischen die intrinsischen Motivation in Arbeitsbeziehungen. Dazu werden das mikroökomisch fundierte Modell von Bénabou & Tirole umrissen, die intrinsische und extrinsische Motivation voneinander abgegrenzt sowie das Auftreten des Verdrängungseffektes anhand verschiedener Theorien dargelegt. Anschließend wird die intrinsische Motivation in das Modell von Bénabou & Tirole integriert und die Rolle der intrinsischen Motivation in bestimmten Arbeitsbeziehungen empirisch dargelegt.
In wissensbasierten Ökonomien sind Aufgaben durch eine steigende Wissensintensität, Komplexität, Volatilität und Teamorientierung1 gekennzeichnet. Dies verleiht der Ressource Mensch sowie dem Personalmanagement eine zunehmend strategische Rolle, weil effiziente Anreizsysteme, die Agenten motivieren, zum Wohle des Unternehmens zu handeln, geschaffen werden müssen. Ein zentrales Anreizsystem ist das Vergütungssystem, welches den Erfolg eines Unternehmens sicherstellen soll.
In der Praxis zeigen Lohnumfragen, dass 80% der befragten Unternehmen den Fixlohn mit einem Bonus ergänzen. Dies ist auf die Prinzipal-Agenten-Theorie, die vor allem monetäre, individuelle und ex-ante Anreize verbunden mit einer klar definierten Zielgröße als optimalen Performanceanreiz konstatiert, zurückzuführen. Demgegenüber stehen Beobachtungen von Psychologen, Soziologen und zunehmend Ökonomen, die den rein positiven Effekt von monetären Anreizen auf die Performance (Preiseffekt) bezweifeln und einen negativen Einfluss tangibler Anreize auf die intrinsische Motivation konstatieren.
Demnach verdrängen monetäre Anreize die intrinsische Motivation und folglich sinkt die Performance. Auch in der Praxis zeigt sich dahingehend Bewegung, denn Großkonzerne, wie Bosch, Daimler oder die Deutsche Bahn schafften ihre ehemals variablen Vergütungssysteme ab. Eine Verschiebung von einfachen und klar Zielgrößen definierten Aufgaben hin zu wissensintensiven, komplexen und volatilen Teamaufgaben, verleiht nicht nur der Ressource Mensch eine besondere Bedeutung, sondern erschwert zudem eine klare Zieldefinition, erhöht den Einfluss der intrinsischen Motivation in Arbeitsbeziehungen und bringt somit die negativen Seiten leistungsvariabler Vergütung und damit den Verdrängungseffekt besonders zum Tragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische & begriffliche Grundlagen
- Das Modell von Bénabou & Tirole
- Intrinsische & Extrinsische Motivation
- Erklärungen für das Auftreten des Verdrängungseffektes
- Integration der intrinsischen Motivation in das Modell von Bénabou & Tirole
- Empirischer Nachweis
- Rolle der intrinsischen Motivation bei Arbeitsbeziehungen
- Empirische Befunde des Verdrängungseffektes
- Ergebnisse
- Ergebnisse des Modells
- Ergebnisse empirische Befunde
- Diskussion
- Praktische Implikationen für Arbeitsbeziehungen
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Crowding-out-These, die besagt, dass extrinsische Motivation die intrinsische Motivation in Arbeitsbeziehungen verdrängen kann. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des Verdrängungseffektes aufzuzeigen, das Modell von Bénabou & Tirole zu erweitern und die Relevanz des Effektes anhand empirischer Befunde zu beleuchten.
- Das Modell von Bénabou & Tirole als Basis für die Analyse des Verdrängungseffektes
- Die Rolle der intrinsischen und extrinsischen Motivation in Arbeitsbeziehungen
- Empirische Evidenz für den Verdrängungseffekt
- Integration der intrinsischen Motivation in das Modell von Bénabou & Tirole
- Praktische Implikationen für das Motivationsmanagement in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Seminararbeit führt in das Thema der Crowding-out-These ein und erläutert die Bedeutung der Motivation in wissensbasierten Ökonomien. Sie stellt die Relevanz des Themas für das Personalmanagement und die Bedeutung der intrinsischen Motivation für die Arbeitsleistung heraus.
- Theoretische & begriffliche Grundlagen: Dieses Kapitel stellt das Modell von Bénabou & Tirole vor, das die Prinzipal-Agenten-Theorie mit verhaltenspsychologischen Erkenntnissen verbindet. Es werden die Konzepte der intrinsischen und extrinsischen Motivation definiert und die verschiedenen Theorien zur Erklärung des Verdrängungseffektes erläutert.
- Integration der intrinsischen Motivation in das Modell von Bénabou & Tirole: In diesem Kapitel wird die intrinsische Motivation in das Modell von Bénabou & Tirole integriert, um die theoretischen Grundlagen des Verdrängungseffektes zu erweitern.
- Empirischer Nachweis: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der intrinsischen Motivation in Arbeitsbeziehungen und präsentiert empirische Befunde zum Verdrängungseffekt.
- Ergebnisse: Das Kapitel fasst die Ergebnisse der theoretischen und empirischen Analyse zusammen und diskutiert die Limitationen des Modells.
- Praktische Implikationen für Arbeitsbeziehungen: Das Kapitel stellt praktische Implikationen für das Motivationsmanagement in Unternehmen vor, die aus der Analyse des Verdrängungseffektes abgeleitet werden können.
Schlüsselwörter
Crowding-out-These, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Verdrängungseffekt, Modell von Bénabou & Tirole, Prinzipal-Agenten-Theorie, Motivationsmanagement, Arbeitsbeziehungen, empirische Befunde.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Crowding-Out-These?
Die These besagt, dass äußere Anreize (extrinsische Motivation, z. B. Geld) die innere Freude an einer Aufgabe (intrinsische Motivation) verdrängen können, was langfristig die Leistung senkt.
Warum sind Boni in wissensbasierten Berufen problematisch?
In komplexen, kreativen Teamaufgaben ist die Leistung schwer messbar. Monetäre Anreize können hier den Fokus von der Qualität der Arbeit auf das Erreichen simpler Zielgrößen lenken und die intrinsische Motivation zerstören.
Was ist das Modell von Bénabou & Tirole?
Es ist ein ökonomisches Modell, das erklärt, wie Belohnungen als Informationssignale wirken. Eine Belohnung kann dem Agenten signalisieren, dass die Aufgabe unangenehm ist oder der Prinzipal ihm wenig zutraut, was die Motivation senkt.
Gibt es empirische Belege für den Verdrängungseffekt?
Ja, Studien zeigen, dass in Bereichen, die hohes Engagement erfordern, leistungsvariable Vergütung oft kontraproduktiv wirkt. Unternehmen wie Bosch oder Daimler haben deshalb teilweise variable Anteile wieder abgeschafft.
Wie sollten Anreizsysteme in modernen Unternehmen gestaltet sein?
Anstatt rein auf Geld zu setzen, sollten Unternehmen die Autonomie, Sinnhaftigkeit und Kompetenzentwicklung fördern, um die intrinsische Motivation der Mitarbeiter zu erhalten und zu stärken.
- Citation du texte
- Klarina Paulisch (Auteur), 2020, Überblick über die Crowding-Out These. Verdrängt die extrinsische die intrinsische Motivation in Arbeitsbeziehungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191718