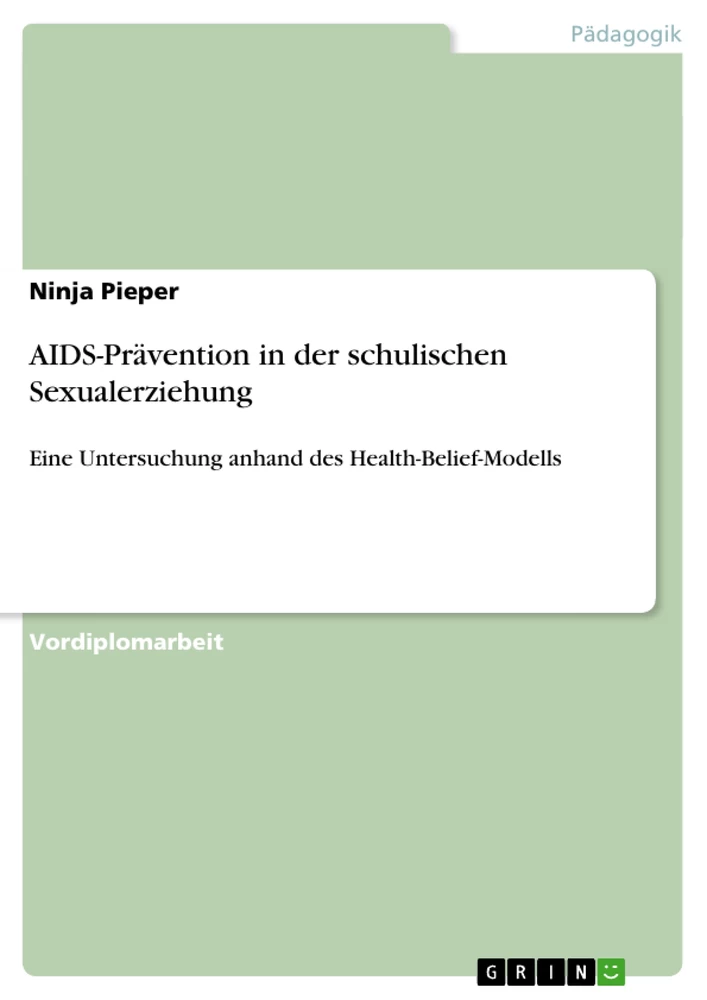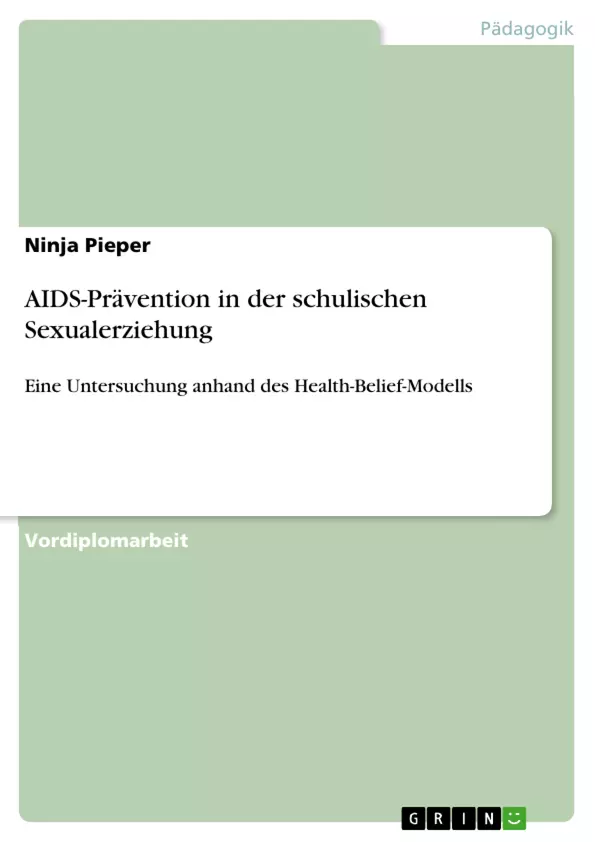Beginnen werde ich mit einem kleinen Überblick über die aktuelle AIDS-Debatte bzw. aktuelle Zahlen, herausgegeben vom Robert-Koch-Institut, die mich zum Verfassen dieser Arbeit veranlasst haben. Im Weiteren werde ich kurz ausführen wie sich die schulische Sexualerziehung seit dem Aufkommen von AIDS Mitte der 80er Jahre verändert hat. Im dritten Kapitel soll es dann anhand des Health-Belief-Modells, um die Bedingungen für präventives Verhalten von Individuen gehen. Dies soll im Bezug zur schulischen Sexualerziehung seit dem Aufkommen von AIDS ausgeführt werden. Im Wesentlichen soll es darum gehen, die Faktoren vorzustellen, die für eine Verhaltensänderung bezüglich des präventiven Verhaltens des Einzelnen notwendig sind. Hier soll besonders darauf eingegangen werden, in wie weit die Schule unterstützend wirkt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich dann mit Formen des Ansteckungsschutzes, deren Effektivität und auch damit, wie ihr Gebrauch in der schulischen Sexualerziehung vermittelt wird. Zu diesem Zweck werden die einzelnen Schutzmöglichkeiten vorgestellt und auf ihre Effektivität und Realisierbarkeit untersucht. Dabei soll deutlich werden, welche Verhaltensmöglichkeiten in der schulischen Sexualerziehung besonders empfohlen werden und in wie weit dies förderlich für das angestrebte, präventive Verhalten der Kinder und Jugendlichen ist.
Abschließend werde ich die Ergebnisse meiner Betrachtungen auswerten. Ich werde versuchen Lücken und Fehler der schulischen Sexualerziehung aufzuzeigen und untersuchen an welchen Stellen ein Verbesserungsbedarf besteht, damit eine effektive, auf nachhaltige Verhaltensänderung basierende, schulische Präventionsarbeit geleistet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Einordnung des Themas
- Aktuelle Zahlen aus der AIDS-Debatte in der Bundesrepublik
- Das Aufkommen von AIDS als Auslöser für die Neuentdeckung der Sexualerziehung
- Bedingungen für präventives Verhalten des Individuums
- Das Health-Belief-Modell
- Die wahrgenommene Gefährlichkeit der Krankheit
- Die wahrgenommene Bedrohung durch die Krankheit
- Der wahrgenommene Nutzen präventiven Verhaltens
- Die wahrgenommenen Kosten als Barrieren für präventives Verhalten
- Formen des Ansteckungsschutzes, deren Effektivität und Vermittlung ihres Gebrauchs in der Sexualerziehung
- Kondombenutzung
- Sexuelle Treue/Enthaltsamkeit
- „Safer Sex“
- Der HIV-Antikörpertest
- Auswertung der Ergebnisse - Ansatz für eine effektivere schulische Präventionsarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der schulischen Sexualerziehung zur Prävention von HIV/AIDS-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert, inwieweit die Sexualerziehung effektiv über Ansteckungsgefahren informiert und zu präventivem Verhalten motiviert. Die Arbeit stützt sich dabei auf aktuelle Zahlen des Robert Koch-Instituts und das Health-Belief-Modell.
- Aktuelle HIV/AIDS-Statistik in Deutschland
- Entwicklung der schulischen Sexualerziehung seit dem Aufkommen von AIDS
- Anwendbarkeit des Health-Belief-Modells auf die AIDS-Prävention
- Effektivität verschiedener Ansteckungsschutzmaßnahmen
- Verbesserungspotenzial der schulischen AIDS-Präventionsarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Relevanz des Themas und die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 bietet einen historischen Überblick über die AIDS-Debatte in Deutschland und die Veränderungen in der schulischen Sexualerziehung. Kapitel 3 analysiert die Bedingungen für präventives Verhalten im Kontext des Health-Belief-Modells. Kapitel 4 stellt verschiedene Formen des Ansteckungsschutzes vor und bewertet deren Effektivität und Vermittlung in der Sexualerziehung.
Schlüsselwörter
AIDS-Prävention, Schulische Sexualerziehung, Health-Belief-Modell, HIV-Infektion, Kondombenutzung, Safer Sex, Präventives Verhalten, Risikofaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird AIDS-Prävention in der Schule vermittelt?
Die schulische Sexualerziehung nutzt Informationen über Ansteckungswege und Schutzmaßnahmen wie Kondomnutzung und Safer Sex, um Jugendliche aufzuklären.
Was ist das Health-Belief-Modell?
Ein psychologisches Modell, das erklärt, warum Menschen präventive Maßnahmen ergreifen – basierend auf der wahrgenommenen Bedrohung und dem Nutzen des Schutzes.
Welche Schutzmaßnahmen werden im Unterricht besprochen?
Thematisiert werden die korrekte Kondombenutzung, sexuelle Treue, Enthaltsamkeit und die Bedeutung des HIV-Antikörpertests.
Warum ist die „wahrgenommene Gefährlichkeit“ wichtig für die Prävention?
Nur wenn Individuen eine Krankheit als ernsthafte Bedrohung für sich selbst wahrnehmen, sind sie bereit, ihr Verhalten nachhaltig zu ändern.
Wo gibt es Lücken in der aktuellen schulischen Sexualerziehung?
Die Arbeit untersucht, an welchen Stellen die Vermittlung von Fakten nicht ausreicht, um eine echte Verhaltensänderung bei Jugendlichen zu bewirken.
- Arbeit zitieren
- Ninja Pieper (Autor:in), 2005, AIDS-Prävention in der schulischen Sexualerziehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119337