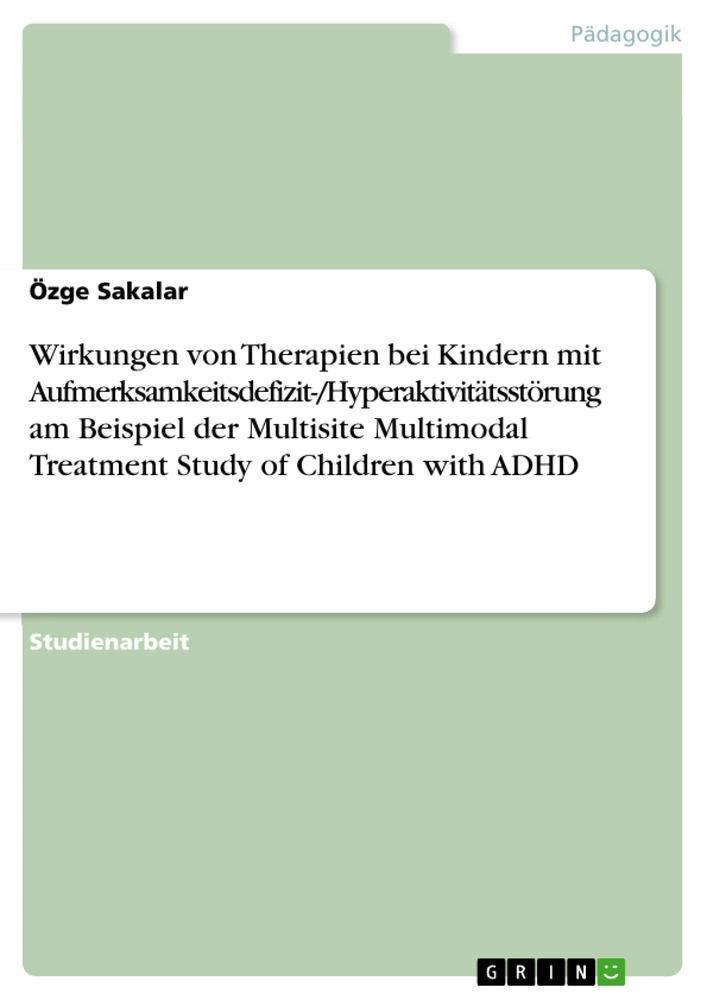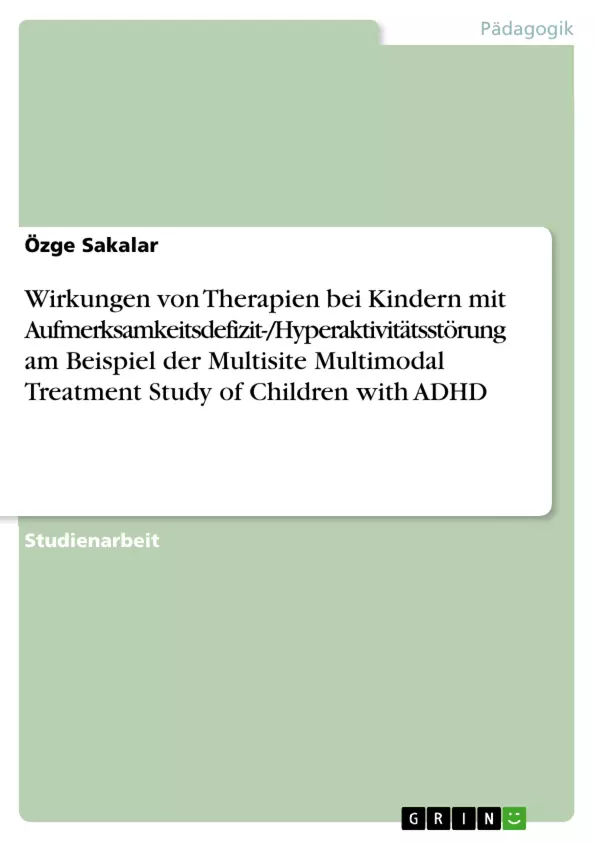Die vorliegende Arbeit geht ansatzweise der Frage nach, inwiefern Wirkungen anhand von unterschiedlichen Therapiestrategien bei Kindern mit einer diagnostizierten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) erzielt werden. Die Frage nach der adäquaten Behandlung von ADHS bei Kindern steht fortwährend im Zusammenhang mit kontrovers geführten Diskussionen um die Frage, ob die Pharmakotherapie der Psychotherapie bezüglich ihrer Wirkung überlegen ist. Mehrere empirische Befunde münden in dem Konsens, dass die effektivste Behandlung aus der Kombination der Pharmako- und Psychotherapie besteht. Ob die simultane Nutzung beider Therapiestrategien zusätzliche Vorteile bringt, ist bereits Gegenstand der Multisite Multimodal Treatment Study of Children with ADHD (MTA) gewesen.
Die MTA-Studie wurde als erste große Therapievergleichsstudie im Auftrag des National Institute of Mental Health (NIMH) in den USA durchgeführt. Sie besitzt für die vorliegende Arbeit insofern Relevanz, als dass bei keiner anderen Therapiestudie im Kindes- und Jugendalter, auch nicht an einem anderen Störungsbild ein vergleichbarer Aufwand hinsichtlich Stichprobengröße, Therapieintensität, Mess- und Evaluationsmethodik betrieben wurde, wie in dieser Studie .Durch den Rückgriff auf eine zeitlich zurückliegende Studie soll verdeutlicht werden, dass die Forschung sich seit jeher auf Fragen im Zusammenhang mit ADHS-Ätiologie, -Prävention und -Intervention fokussiert und von Fragen nach der Existenz bzw. Nicht-Existenz der ADHS absieht. Angesichts dessen kann die in der Öffentlichkeit kursierende Annahme, dass die ADHS lediglich eine Modediagnose und nicht in dem Ausmaß vertreten sei, relativiert und mithin der Stellenwert von Interventionsmöglichkeiten unterstrichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bei Kindern
- 1.1 Klassifikation und Diagnostik
- 1.2 Prävalenz
- 1.3 Komorbidität
- 2. Multimodale Behandlungsformen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
- 2.1 Psychoedukation
- 2.3 Psychotherapie
- 2.3 Pharmakotherapie
- 3. Multisite Multimodal Treatment Study of Children with ADHD
- 3.1 Methodenteil
- 3.3 Ergebnisteil
- 4. Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Effektivität unterschiedlicher Therapiestrategien bei Kindern mit einer diagnostizierten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Insbesondere wird die kontroverse Frage nach der Überlegenheit der Pharmakotherapie gegenüber der Psychotherapie beleuchtet.
- Klassifikation und Diagnostik der ADHS nach ICD-10 und DSM-5
- Prävalenz und Komorbidität von ADHS bei Kindern und Jugendlichen
- Multimodale Behandlungsansätze bei ADHS, einschließlich Psychoedukation, Psychotherapie und Pharmakotherapie
- Die Multisite Multimodal Treatment Study of Children with ADHD (MTA) als Referenzstudie für die langfristige Wirksamkeit von Therapiestrategien bei ADHS
- Diskussion der Ergebnisse der MTA-Studie und Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung der MTA-Studie für die Untersuchung der Wirksamkeit von ADHS-Therapien. Kapitel 1 definiert und klassifiziert die ADHS und beleuchtet die Prävalenz sowie die Bedeutung von Komorbidität. Kapitel 2 widmet sich den multimodalen Behandlungsansätzen bei ADHS, wobei die Psychoedukation, die Psychotherapie und die Pharmakotherapie im Detail betrachtet werden. Kapitel 3 stellt die MTA-Studie vor und behandelt Aspekte des Untersuchungsdesigns, der Stichprobenauswahl und des Auswertungsverfahrens. Die Ergebnisse der MTA-Studie werden in Kapitel 3.2 zusammengefasst. Der Diskussionsteil in Kapitel 4 interpretiert die Ergebnisse und beleuchtet Konsequenzen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Pharmakotherapie, Psychotherapie, Multisite Multimodal Treatment Study of Children with ADHD (MTA), Klassifikation, Diagnostik, Prävalenz, Komorbidität, Psychoedukation, NIMH (National Institute of Mental Health)
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der MTA-Studie zu ADHS?
Die Studie untersuchte die Wirksamkeit von Pharmakotherapie, Psychotherapie und deren Kombination bei Kindern mit ADHS über einen längeren Zeitraum.
Ist die Pharmakotherapie der Psychotherapie überlegen?
Die MTA-Studie zeigte, dass eine sorgfältig eingestellte Medikation oft effektiver bei Kernsymptomen war, die Kombination beider Ansätze jedoch Vorteile bei sozialen Kompetenzen bot.
Was bedeutet „multimodale Behandlung“ bei ADHS?
Es beschreibt einen Therapieansatz, der verschiedene Bausteine wie Psychoedukation, Verhaltenstherapie und medikamentöse Unterstützung kombiniert.
Ist ADHS nur eine „Modediagnose“?
Die Arbeit verdeutlicht, dass ADHS eine wissenschaftlich belegte Störung mit klarer Ätiologie und Diagnostik ist, deren Behandlung für Betroffene von hohem Stellenwert ist.
Welche Rolle spielt die Komorbidität bei ADHS?
Viele ADHS-Patienten leiden zusätzlich an anderen Störungen (z. B. Lernschwächen oder Angststörungen), was bei der Wahl der Therapiestrategie berücksichtigt werden muss.
- Arbeit zitieren
- Özge Sakalar (Autor:in), 2019, Wirkungen von Therapien bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung am Beispiel der Multisite Multimodal Treatment Study of Children with ADHD, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1194623