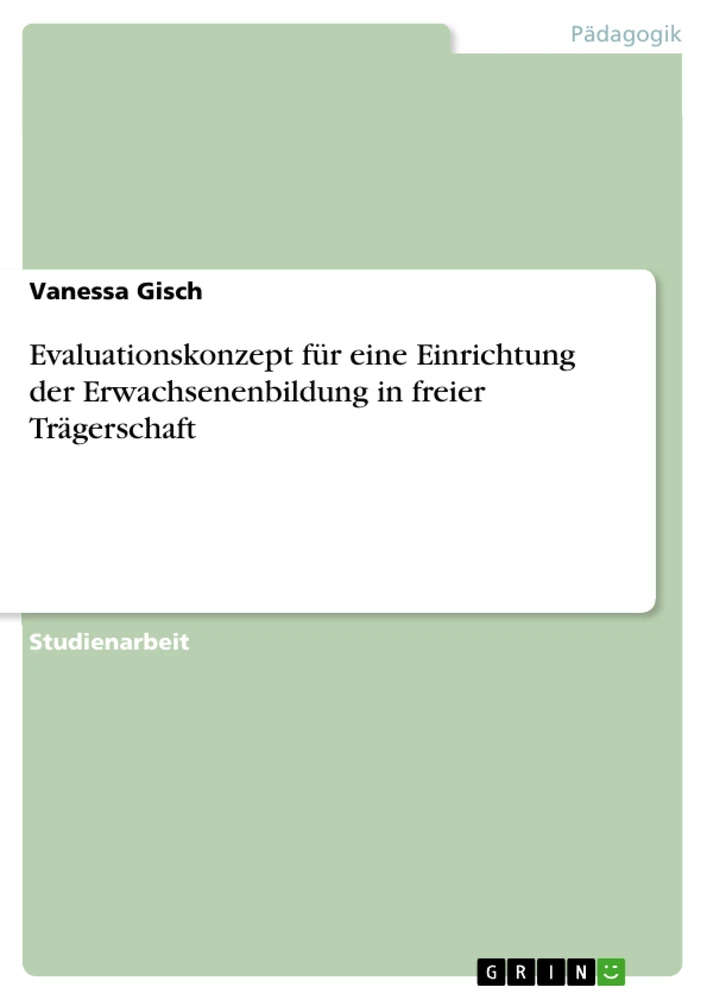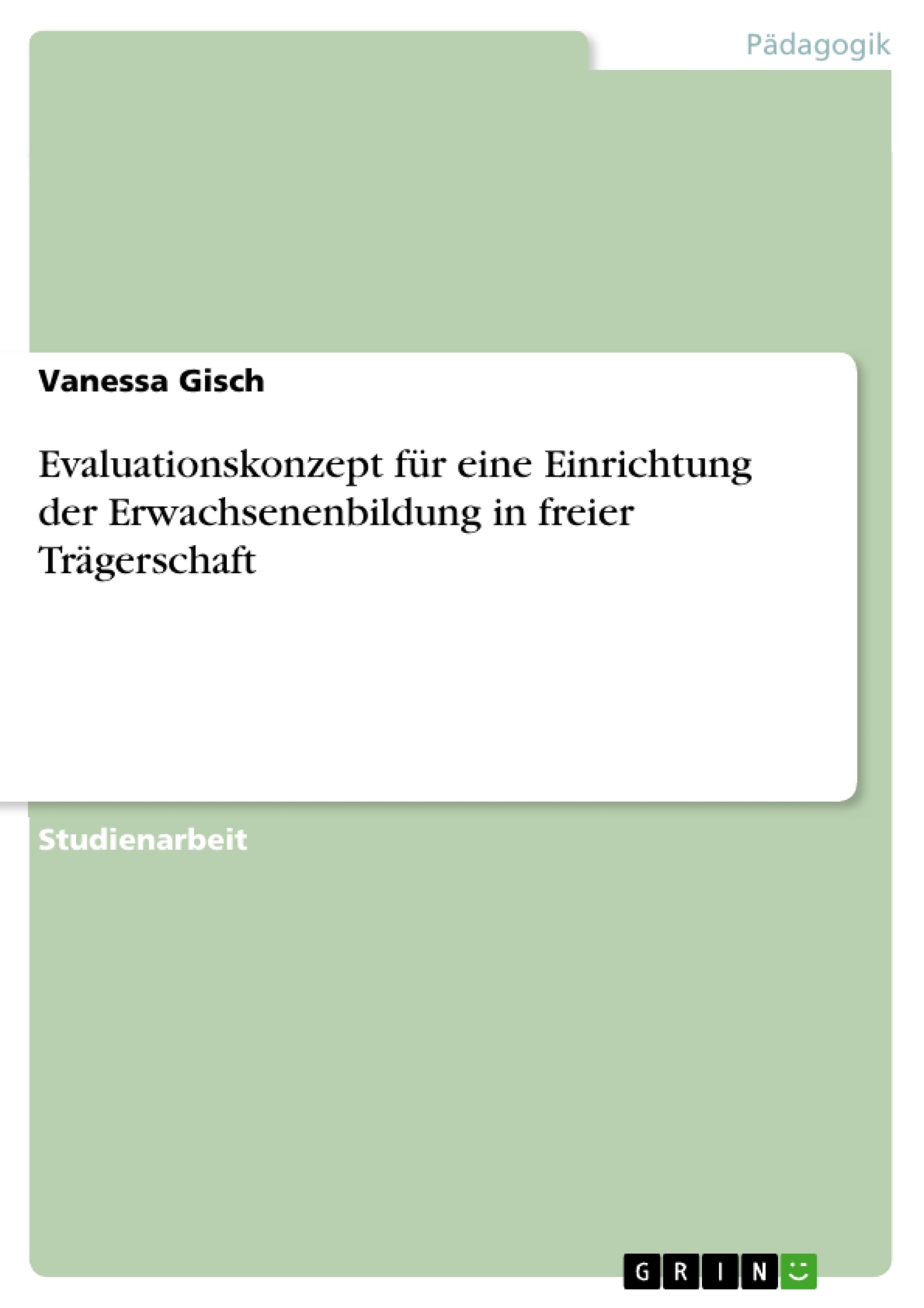Ein gemeinnütziger Verein wendete sich an die TU Kaiserslautern, um Unterstützung in Form eines Evaluationskonzeptes zu erhalten. Dadurch sollen notwendige Daten gewonnen werden, die bei der Neupositionierung der Einrichtung beziehungsweise der Verbesserung der Situation helfen können. Das vorliegende Konzeptpapier wird zunächst die Ausgangssituation veranschaulichen und die vorhandene Datenlage bewerten. Anschließend wird darauf eingegangen, ob und wenn ja welche Daten noch zusätzlich gewonnen werden müssen, um mögliche Verbesserungspotenziale/ Maßnahmen ableiten zu können. Nachfolgend wird ein Evaluationskonzept dargelegt, welches dazu dient, die fehlenden Daten zu erheben.
Mögliche Maßnahmen werden dann im folgenden Kapitel beschrieben, wonach eine der Maßnahmen weiter ausgeführt und bewertet wird. Abschließend wird eine auf Kriterien basierte Bewertung und ein auf die Rückmeldung von der Leitung gestütztes Fazit gegeben, um der Einrichtung ein schlüssiges Lösungsszenario vorlegen zu können.
Mit dem Begriff Evaluation wird im Weiterbildungsbereich eine systematische Beurteilung der Durchführung und Resultate eines Programms oder Projektes verstanden. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Dienstleistung, die auf Daten und Informationen basiert, die mittels sozialwissenschaftlicher Methoden gewonnen werden. Diese Bewertung erfolgt transparent, nachvollziehbar und beurteilt die Programme bzw. Projekte für festgelegte Zwecke und nach entsprechend begründeten Kriterien auf deren Qualität, um bspw. Verbesserungen zu fördern.
Die Evaluation wird in der Praxis als Teil des Qualitätsmanagements angesehen. Angesichts der zunehmenden Konkurrenzsituation auf dem Weiterbildungsmarkt und der sinkenden Bereitstellung an Fördergeldern, sind die Bildungsorganisationen dazu angehalten eine kontinuierliche Überprüfung ihrer Bildungsprogramme durchzuführen. Es geht um die Offenlegung von Informationen und Daten, die Erkennung von Schwachstellen und Verbesserungspotenzialen, die dabei helfen Entscheidungen über Programme treffen zu können. Es können Gegenmaßnahmen bzw. Optimierungsschritte zur Gewährleistung der Qualität und Wettbewerbsfähigkeit eingeleitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation
- Bewertung der Datenlage
- Beschreibung des Zielzustandes
- Evaluationskonzept für den gemeinnützigen Verein
- Evaluationsgegenstand
- Interessierte Akteure und Rolle der Evaluierenden
- Evaluationszweck und Fragestellungen
- Bewertungskriterien
- Erhebungsdesign und -methoden
- Durchführung der Erhebungen
- Datenauswertung, Interpretation und Bewertungssynthese
- Handlungsoptionen für die Einrichtung
- Diskussion des Lösungskonzeptes für die Einrichtung
- Ausführliche Darstellung des Lösungskonzeptes
- Rückmeldung zum Lösungskonzept durch die Leitung
- Fazit und Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Fallarbeit ist die Entwicklung eines Evaluationskonzeptes für einen gemeinnützigen Verein im Bereich der gesellschaftspolitischen Bildung. Die Fallarbeit analysiert die Ausgangssituation, bewertet die vorhandene Datenlage und identifiziert notwendige Daten, um Verbesserungspotenziale und Maßnahmen zur Optimierung der Einrichtung zu ermitteln. Das Konzept umfasst die Definition von Evaluationsgegenstand, Akteuren, Zweck und Fragestellungen, sowie die Festlegung von Bewertungskriterien, Erhebungsmethoden und -design.
- Evaluation eines gemeinnützigen Vereins im Bereich der gesellschaftspolitischen Bildung
- Analyse der Ausgangssituation und Bewertung der Datenlage
- Entwicklung eines Evaluationskonzeptes mit klaren Zielen und Fragestellungen
- Identifizierung von Verbesserungspotenzialen und möglichen Maßnahmen
- Bewertung der Handlungsoptionen und Entwicklung eines Lösungskonzeptes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Fallarbeit vor und erläutert die Bedeutung der Evaluation im Weiterbildungsbereich. Kapitel 1 beleuchtet die Ausgangssituation des gemeinnützigen Vereins, beschreibt die Organisationsstruktur und das Bildungsangebot. Kapitel 2 widmet sich dem Evaluationskonzept, welches die Festlegung von Evaluationsgegenstand, Akteuren, Zweck, Fragestellungen, Bewertungskriterien, Erhebungsmethoden und -design umfasst. Kapitel 3 behandelt die Handlungsoptionen für die Einrichtung, die aus der Evaluation resultieren.
Schlüsselwörter
Evaluation, Weiterbildung, gemeinnütziger Verein, gesellschaftspolitische Bildung, Bildungsangebot, Datenanalyse, Verbesserungspotenziale, Handlungsoptionen, Lösungskonzept.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Evaluation in der Erwachsenenbildung?
Evaluation ist die systematische Beurteilung von Programmen oder Projekten auf Basis sozialwissenschaftlicher Daten zur Qualitätssicherung.
Warum ist Evaluation für gemeinnützige Vereine wichtig?
Sie hilft Schwachstellen aufzudecken, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Rechenschaft über die Verwendung von Fördergeldern abzulegen.
Was gehört in ein Evaluationskonzept?
Dazu gehören der Evaluationsgegenstand, Zweck, Fragestellungen, Bewertungskriterien sowie das Erhebungsdesign und die Methoden.
Welche Methoden der Datenerhebung werden genutzt?
Häufig werden Befragungen, Interviews oder die Analyse vorhandener Programmdaten eingesetzt.
Wie werden die Ergebnisse einer Evaluation genutzt?
Sie dienen als Grundlage für Handlungsoptionen und Optimierungsschritte zur Verbesserung des Bildungsangebots.
- Quote paper
- Vanessa Gisch (Author), 2019, Evaluationskonzept für eine Einrichtung der Erwachsenenbildung in freier Trägerschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1195073