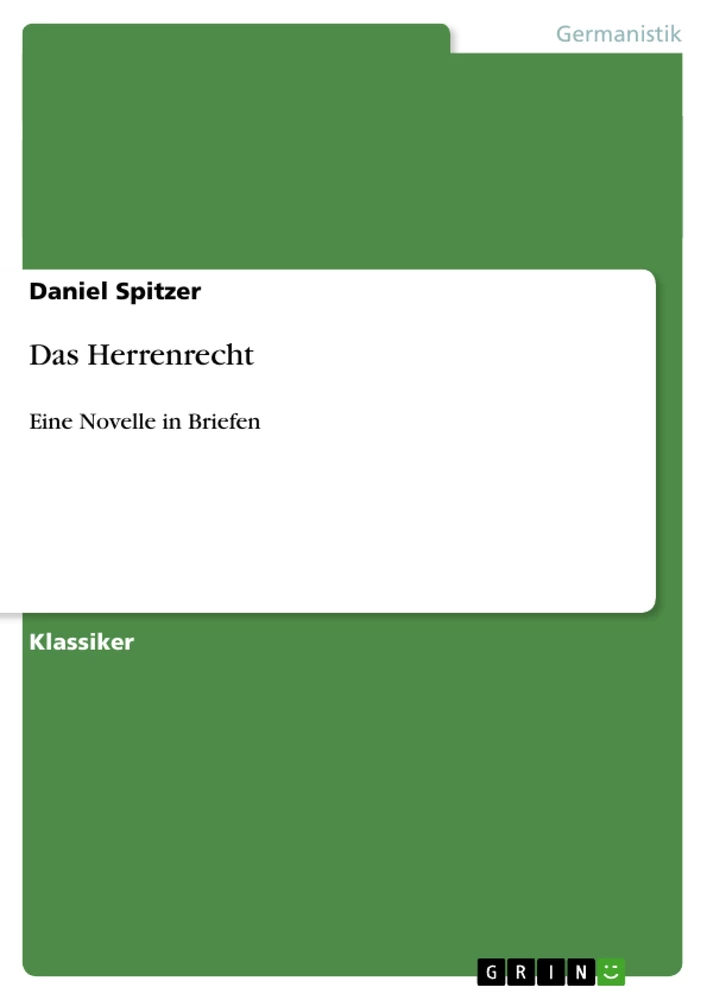Erstmalig erschienen 1877. Ein Auszug: [...] Die Besitzung des Oheims liegt fast eine Fahrstunde von der Eisenbahnstation entfernt in einer paradiesischen Gegend. Ringsum erheben sich bewaldete Hügel und Berge, von deren Dunkel sich sanft ansteigende lichte Wiesen abheben, auf denen leichtsinnige Fohlen weiden und sich austoben und die Kühe nachdenklich die rothen und gelben Blumen fressen und nur manchmal besorgt den Kopf nach ihrem Schweife umwenden, wie Hofdamen, die sich umsehen, ob ihre Schleppe gut auf den Boden fällt. Im
Hintergrunde aber schauen gefurchte Felsschroffen ernst zum blauen Himmel auf. Vom Waldessaume herab winden sich durch die Wiesen schmale Rinnsale, deren leise murmelnde Wässer dem Bache zueilen, der zwischen dem Schlosse und dem Dorfe rauschend dahinfließt. Wälder, Berge, rauschende Wasser, hinter jedem Hause ein Düngerhaufen und nur manchmal ein Gensdarm - kann man von einem Paradiese mehr verlangen? Aber was ist ein Paradies ohne Schlange, die Einen zur Sünde verführt? Ich habe noch kein hübsches Bauernmädchen hier gesehen, und wenn ich nicht jeden Tag meiner gottesfürchtigen Tante die Hand küßte, würde ich das Küssen ganz verlernen, das mich doch so viel Zeit und so schwere
Soupers gekostet hat. Das Schloß hat mein Urgroßvater im vorigen Jahrhundert erbaut und aus dieser Zeit stammt auch die ganze Einrichtung desselben, die aber noch immer den Eindruck größerer Jugendlichkeit macht als die weibliche Dienerschaft. Es ist ein weitläufiges Gebäude mit zwei Thürmen und einer so großen Anzahl von Fenstern, daß mindestens vierzig Personen, die durch
den Aufenthalt im Schlosse lebensüberdrüßig geworden sind, gleichzeitig herausspringen können. Es liegt mitten in einem großen Gartenpark, in dessen Alleen sich einige griechische Götter langweilen, deren nähere Betrachtung jetzt durch übertünchte blecherne Feigenblätter, die der Oheim an den passenden oder vielmehr unpassenden Stellen anbringen ließ, auch dem schamhaftesten Auge ermöglicht worden ist. Ich habe gleich am ersten Tage meines Aufenthaltes mich in der Malerei geübt, indem ich auf diese leeren Feigenblätter das Wappen unseres Hauses, das doch sonst nirgends fehlt, mit rother Farbe gemalt und auch unsere schöne Devise: Abstine anzubringen nicht versäumt habe. [...]
Inhaltsverzeichnis
Erster Brief
Zweiter Brief
Dritter Brief
Vierter Brief
Fünfter Brief
Sechster Brief
Erster Brief.
Graf Heinrich Lehnburg an den Grafen Paul Welsthal.
St. Lambrecht - 3. Juli 1876.
Erschrick nicht, lieber Paul, wenn du diesen Brief öffnest und meine Unterschrift liest. Er enthält kein letztes Lebewohl und die traurige Mittheilung, daß ich mir wegen drückender Schulden oder aus unglücklicher Liebe eine Kugel durch den Kopf gejagt habe. Nein, lieber Freund, mein frommer Oheim hat neuerdings meine Schulden gezahlt, so daß ich seit der Einlösung meines letzten Wechsels keinen Busenfreund mehr habe, der Abraham heißt, und den ich als Retter in der Noth an mein Herz schließe, mit der jesuitischen Reservatio mentalis, eine halbe Stunde später ein warmes Bad zu nehmen. Da ich aber erst drei und zwanzig Jahre alt bin, hat der Oheim leider noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben, mich zu bessern und mich hierher auf sein großes Gut in die Verbannung geschleppt, wo allerdings die den guten Sitten so unentbehrlichen bösen Beispiele gänzlich mangeln, so daß ich gar keine Gelegenheit habe, mich in den dummen Streichen, zu denen ich eine so große Anlage besitze, weiter auszubilden. Es ist hier bei der Abgeschiedenheit, in der wir uns befinden, auch nicht zu der kleinsten unglücklichen Liebe Gelegenheit, und obwohl ich erst seit drei Tagen hier bin, langweile ich mich doch schon so entsetzlich, daß ich mich entschlossen habe, dir zu schreiben und so endlich das Versprechen zu erfüllen, das ich dir schon vor vier Monaten in einer schwachen Stunde gegeben, als der Abschiedschampagner, den wir vor deiner Abreise nach deinen böhmischen Gütern tranken, meinen Verstand verwirrt hatte.
Die Besitzung des Oheims liegt fast eine Fahrstunde von der Eisenbahnstation entfernt in einer paradiesischen Gegend. Ringsum erheben sich bewaldete Hügel und Berge, von deren Dunkel sich sanft ansteigende lichte Wiesen abheben, auf denen leichtsinnige Fohlen weiden und sich austoben und die Kühe nachdenklich die rothen und gelben Blumen fressen und nur manchmal besorgt den Kopf nach ihrem Schweife umwenden, wie Hofdamen, die sich umsehen, ob ihre Schleppe gut auf den Boden fällt. Im Hintergrunde aber schauen gefurchte Felsschroffen ernst zum blauen Himmel auf. Vom Waldessaume herab winden sich durch die Wiesen schmale Rinnsale, deren leise murmelnde Wässer dem Bache zueilen, der zwischen dem Schlosse und dem Dorfe rauschend dahinfließt. Wälder, Berge, rauschende Wasser, hinter jedem Hause ein Düngerhaufen und nur manchmal ein Gensdarm - kann man von einem Paradiese mehr verlangen? Aber was ist ein Paradies ohne Schlange, die Einen zur Sünde verführt? Ich habe noch kein hübsches Bauernmädchen hier gesehen, und wenn ich nicht jeden Tag meiner gottesfürchtigen Tante die Hand küßte, würde ich das Küssen ganz verlernen, das mich doch so viel Zeit und so schwere Soupers gekostet hat. Das Schloß hat mein Urgroßvater im vorigen Jahrhundert erbaut und aus dieser Zeit stammt auch die ganze Einrichtung desselben, die aber noch immer den Eindruck größerer Jugendlichkeit macht als die weibliche Dienerschaft. Es ist ein weitläufiges Gebäude mit zwei Thürmen und einer so großen Anzahl von Fenstern, daß mindestens vierzig Personen, die durch den Aufenthalt im Schlosse lebensüberdrüßig geworden sind, gleichzeitig herausspringen können. Es liegt mitten in einem großen Gartenpark, in dessen Alleen sich einige griechische Götter langweilen, deren nähere Betrachtung jetzt durch übertünchte blecherne Feigenblätter, die der Oheim an den passenden oder vielmehr unpassenden Stellen anbringen ließ, auch dem schamhaftesten Auge ermöglicht worden ist. Ich habe gleich am ersten Tage meines Aufenthaltes mich in der Malerei geübt, indem ich auf diese leeren Feigenblätter das Wappen unseres Hauses, das doch sonst nirgends fehlt, mit rother Farbe gemalt und auch unsere schöne Devise: Abstine anzubringen nicht versäumt habe. Diese künstlerische Ausstattung hat mir am nächsten Morgen von Seite des Oheims eine Strafpredigt mit Belegstellen aus der heiligen Schrift eingetragen, der heute beim Frühstück eine zweite mit Hundegeheul gefolgt ist, da ich während derselben das Hündchen der Tante in den Schweif kniff, das aus Treue gegen seine Herrin, deren Leibesumfang sich in den letzten Jahren verdoppelt hat, auch nicht mehr länger mager sein wollte und sich aus Liebe zu ihr fett gefressen hat. Der Oheim las nämlich die eingelaufenen Briefe und war über einen derselben so ergrimmt, daß er ihn in der Faust zerknitterte. Die Tante studierte die Theaternachrichten in den Blättern und nun spielte folgende kleine Scene:
Die Tante (erschreckt): Es ist entsetzlich!
Der Oheim (ergrimmt): Wieder ein Angriff auf die Kirche?
Die Tante (die Hände faltend): Das nicht, Gott sei Dank, aber der neu engagirte Schauspieler für die Rollen von Bonvivants soll ein Jude sein!
Der Oheim (bitter): Alle Schauspieler sind Juden!
Die Tante (besorgt): Mein Gott, dann kann man ja nicht mehr ins Theater gehen.
Der Oheim (wüthend): Man kann überhaupt nirgends mehr hingehen, man trifft überall nur Juden: im Theater, im Concertsaal, im Parlament und sogar in der Kirche, wenn für eine Messe in den Judenblättern Reclame gemacht wird. Da schreibt mir eben (zeigt auf den zerknitterten Brief) der Feldmarschall-Lieutenant, daß er erfahren habe, der Beichtvater seiner Frau, Pater Cölestin, sei auch ein Jude gewesen und habe früher Amschel Rosenzweig geheißen.
Die Tante (die Hände ringend): Jesus, Maria und Josef!
Ich (den Ton des Oheims nachahmend): Waren auch Juden.
Nun erhob sich der Oheim und gab eine jener Reden zum Besten, wie er sie in den katholischen Vereinen zu halten pflegt, gegen den Liberalismus, die Aufklärung und sogar gegen die moderne Schule, so daß ich, als er fertig war, seine Hand ergriff und rief: Wie bedauere ich es, daß ich noch nicht das Alter habe, das für das active Wahlrecht erfordert wird, sonst würde ich Dir nach dieser Candidatenrede mit Vergnügen meine Stimme geben. Doch ich schließe meine Mittheilungen, denn es schlägt Mitternacht, die Stunde der Gespenster, die allerdings, nachdem ich den Kammerjungfern meiner Tante so oft ins Gesicht gesehen, ihren Schrecken für mich verloren hat.
Zweiter Brief.
Derselbe an Denselben.
St. Lambrecht - 24. Juli.
Du würdest mich nicht wieder erkennen, theurer Freund, so verändert habe ich mich seit den drei Wochen meiner Verbannung. Ich habe seit acht Tagen keine Strafpredigt mehr gehört, und ach! auch nicht verdient; die Bäuerinnen erröthen und kichern nicht mehr, wenn ich an ihnen vorübergehe, kurz ich habe mich entschlossen den Freuden dieser Welt zu entsagen und mich auf das Fischangeln zu verlegen. Selbst meine Tante gibt zu, daß ich mich gebessert habe, aber wenn dies der Fall ist, dann habe ich mich entschieden zu meinem Nachtheile gebessert. O, die Zeit bringt traurige Veränderungen hervor, du würdest mich nicht wieder erkennen, so vernünftig bin ich geworden. Nur einmal schien mein Glück, das schon so lange auf Reisen ist, wieder zurückkehren zu wollen, ich glaubte die Gelegenheit beim Schopfe zu fassen, aber ich behielt nur ihren Chignon in der Hand, während sie mir davon lief.
Ich hatte mich nämlich am vorigen Sonntag entschlossen, endlich einen lang gehegten Wunsch meiner Tante zu erfüllen und die Dorfkirche zu besuchen, um mich dort in der Andacht zu üben. Die Kirche war voll von Bauern und Bäuerinnen aus dem Dorfe und aus den Gehöften und Weilern der Umgebung. Auf sämmtlichen Gesichtern lag eine sonderbare Mischung von Sonnenbrand, Inbrunst und Durst. Da sah ich plötzlich aus der wirren Masse von rothen Ohren, schwarzen Filzhüten, fettglänzenden blonden und braunen Zöpfen, silbernen Jackenknöpfen, nackten Knieen, grellen Busentüchern, Lederhosen, Runzeln und Gebetbüchern auf einer der vordern Bänke einen kleinen grauen Handschuh von allerliebster Weltlichkeit hervorleuchten. Ich konnte mich nur langsam durch die Menge drängen und sah zuerst den blonden Schimmer der Spitze eines Zopfes, dann ein kleines Ohr, weiter nachdem mir ein Bauernmädchen die linke Zehe zerquetscht und den einen Lackschuh für immer dienstuntauglich gemacht hatte, eine blühende Wange und einen reizenden Nasenflügel, darauf, nachdem ich vorher meinen obersten Westenknopf zum Opfer hatte bringen müssen, ein Stück von einem Kinne, die Hälfte eines Grübchens und das lieblichste »noch etwas«, um eine Umschreibung zu gebrauchen, deren sich Goethe in seinem Gedichte »Christel« bei Schilderung der Reize dieses trefflichen Mädchens bedient:
Ist eine, die so lieben Mund,
Liebrunde Wänglein hat?
Ach, und es ist noch etwas rund,
Da sieht kein Aug’ sich satt.
Endlich, nachdem ich auch noch meinen schönen Scheitel in die Schanze einiger Bauernbusen geschlagen hatte, sah ich ihre ganze Person: schlank, blond, weiß und rosig. Sie hatte die dunkeln Augen niedergeschlagen und die Hände gefaltet, und schien zu beten, zu träumen oder über ein kleines Geheimniß nachzudenken. Ich suchte vergebens ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, indem ich seufzte, räusperte, hustete und endlich sogar mich im hohen C schneuzte obwohl ich weiß, daß dieses Geräusch nicht besonders geeignet ist, einen tiefen Eindruck auf ein unverdorbenes Mädchenherz zu üben. Ich wiederholte nach einer Viertelstunde dieses Concert mit unverändertem Programm, allein sie blickte nicht auf, und nur ein älterer Mann, der neben ihr saß und ebenfalls städtisch gekleidet war, wahrscheinlich ein Schlingel von Vater, warf dem Andachtstörer einen zornigen Blick zu. Ich hatte schon Lust, den ungerathenen Vater der Heiligen für diesen Blick zur Rede zu stellen, nur um der Tochter so meine Existenz zu verrathen. Allein diese Einleitung zu einem Liebesroman schien mir doch zu gewagt, und ich zog es vor, die Kirche zu verlassen, ein Blatt Papier aus meiner Brieftasche zu reißen, einige Zeilen mit Bleistift darauf zu schreiben und ihr diesen Liebesbrief à la minute unbemerkt zuzustecken. Ich machte mir daher durch das Gedränge mit der ganzen Geschwindigkeit eines Verliebten Platz, eilte hinaus und schrieb, daß ich sie gesehen, und daß sie die einzige Heilige in der Kirche gewesen sei, die ich sofort angebetet hätte; daß ich sie bitte, mir bei einem Rendezvous, in Wolken gehüllt, oder wie sie es sonst für zweckmäßig erachte, zu erscheinen; daß mein Oheim der durch seine strenge kirchliche Haltung berühmte Graf Lehnburg sei, und daß sie einen kleinen Theil der Gunst, den sie als Heilige sicherlich ihm gewähre, seinem Neffen und Erben zuwenden möge. Ich wartete bei der Kirchenthüre, um ihr im Gedränge der Herausströmenden das Briefchen in die Hand zu drücken. Ich wartete und wartete, die Kirche leerte sich, aber sie konnte ich nicht erblicken. Alles war schon verschwunden und ich stand mit einem Male ganz allein und traurig vor der Kirchenthüre mit meinem Liebesbriefe in der Hand. Ich ging betrübt in die Kirche zurück, um sie dort zu suchen, denn vielleicht wohnte sie auf einem Altare. Sie war nicht da. Allein jetzt erst sah ich, daß die Kirche noch einen zweiten Ausgang hatte, und durch diesen mußte sie verschwunden sein. So, mein lieber Paul, straft der Himmel Diejenigen, die niemals in die Kirche gehen; sie wissen in ihrer Gottlosigkeit nicht einmal, wie viele Thüren die Kirche hat, und während sie bei der einen warten, geht die Geliebte bei der anderen hinaus. Ich habe sie nicht wiedergesehen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Inhaltsverzeichnis" in diesem Dokument?
Das "Inhaltsverzeichnis" listet die Briefe auf, die in diesem Dokument enthalten sind. Es enthält die Titel der ersten sechs Briefe: "Erster Brief", "Zweiter Brief", "Dritter Brief", "Vierter Brief", "Fünfter Brief" und "Sechster Brief".
Wer sind die Hauptpersonen im "Ersten Brief"?
Die Hauptpersonen im "Ersten Brief" sind Graf Heinrich Lehnburg und Graf Paul Welsthal. Der Brief ist von Graf Heinrich Lehnburg an Graf Paul Welsthal adressiert.
Was sind die Hauptthemen im "Ersten Brief"?
Die Hauptthemen im "Ersten Brief" sind Langeweile, Exil auf dem Landgut des Onkels, Kritik an der Bigotterie und Spott über die katholisch-politischen Ansichten des Onkels.
Was erfährt man über das Leben von Graf Heinrich Lehnburg im "Ersten Brief"?
Man erfährt, dass Graf Heinrich Lehnburg Schulden hatte, die von seinem Onkel bezahlt wurden. Er wurde auf das Landgut seines Onkels verbannt, um sich zu bessern. Er langweilt sich dort und vermisst das städtische Leben.
Was ist das Thema des Vorfalls mit dem Hund der Tante im "Ersten Brief"?
Der Vorfall mit dem Hund der Tante zeigt Graf Heinrich Lehnburgs respektloses Verhalten und seine Neigung zu Streichen. Er kneift den Hund der Tante, was zu weiterem Ärger mit seinem Onkel führt.
Welche Debatte findet beim Frühstück im "Ersten Brief" statt?
Beim Frühstück entbrennt eine Debatte über Juden im Theater und in anderen Bereichen des Lebens. Der Onkel äußert seine Verärgerung über den Einfluss von Juden in der Gesellschaft, woraufhin Graf Heinrich Lehnburg sarkastische Bemerkungen macht.
Was erfährt man im "Zweiten Brief" über Graf Heinrichs Zustand?
Im "Zweiten Brief" beschreibt Graf Heinrich seine veränderte Natur und seine scheinbare Entsagung der weltlichen Freuden. Er gibt an, vernünftig geworden zu sein und sich dem Fischfang zuzuwenden.
Was passierte in der Kirche im "Zweiten Brief"?
In der Kirche sah Graf Heinrich eine attraktive junge Frau und versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Er schrieb ihr einen Liebesbrief, konnte sie aber nicht erreichen, da sie die Kirche durch einen anderen Ausgang verließ.
Wer ist Severin im "Zweiten Brief"?
Severin ist ein Gast auf dem Schloss von Graf Lehnburgs Onkel. Er ist ein fleischfressender Zehengänger, der Geflügel isst und St. Julien dazu trinkt. Er schreibt clericale Broschüren und ist eine Zierde der katholisch-politischen Vereine. Er forscht, um zu beweisen, dass das Jus primae noctis nie existiert habe.
Was ist das "Jus primae noctis", von dem im "Zweiten Brief" die Rede ist?
Das "Jus primae noctis" (Recht der ersten Nacht) ist das angebliche Recht von Gutsherren im Mittelalter, mit den Bräuten ihrer Untertanen in der Hochzeitsnacht zu schlafen. Severin versucht, zu beweisen, dass dieses Recht nie existiert hat.
Was ist der Zusammenhang zwischen Graf Almaviva und dem "Jus primae noctis" im "Zweiten Brief"?
Graf Almaviva in Mozarts Hochzeit des Figaro verzichtet auf das Jus primae noctis, ohne einen Schürzenzins zu verlangen, was ein juristisch interessanter Fall ist.
- Quote paper
- Daniel Spitzer (Author), 2008, Das Herrenrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119870