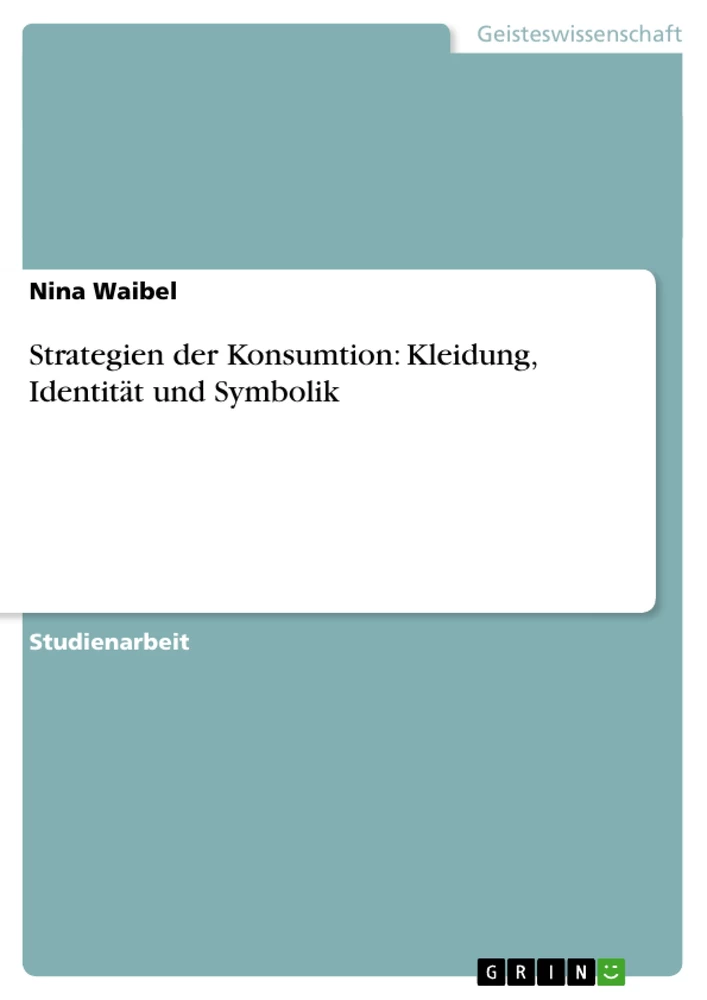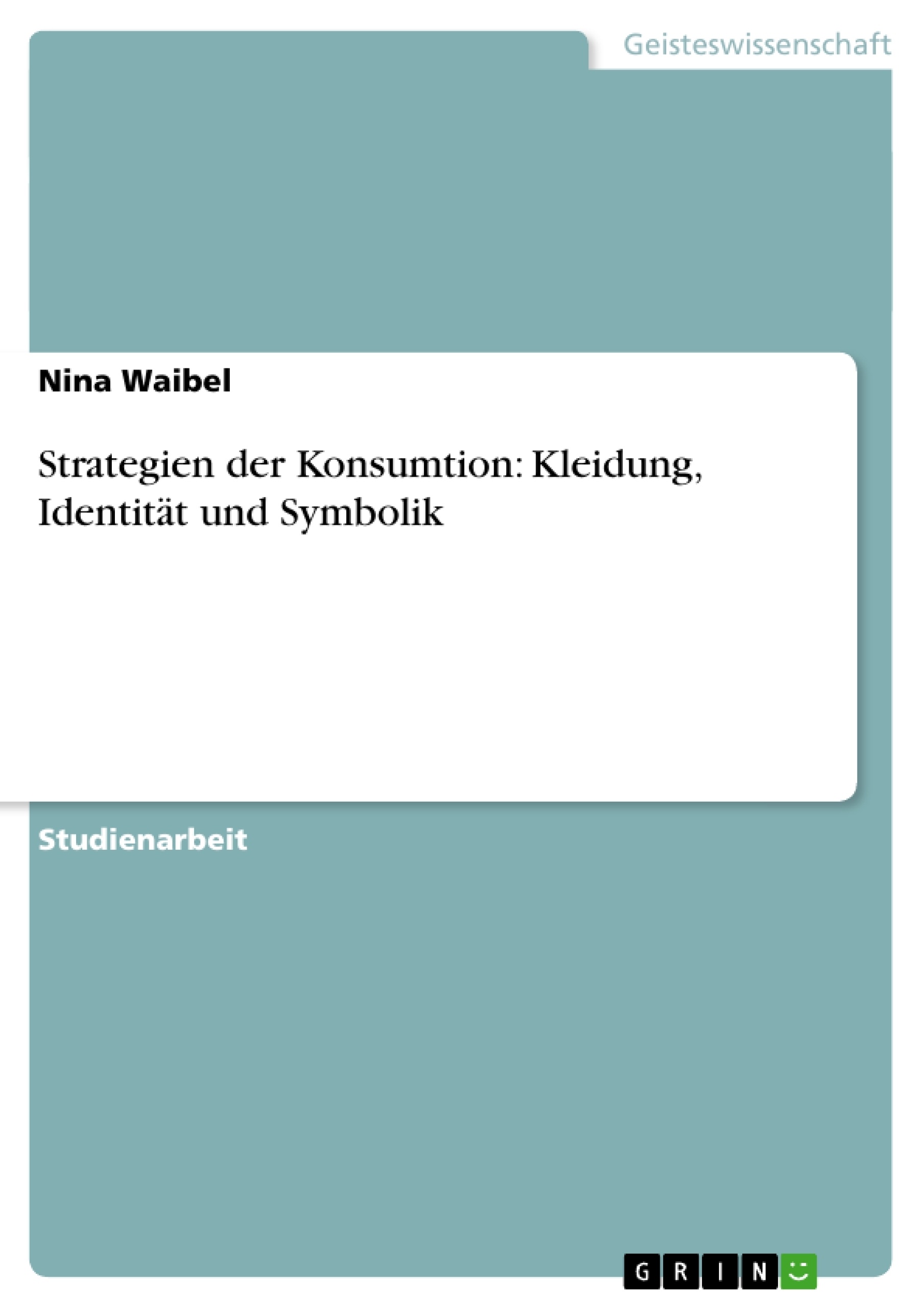Die Beschäftigung mit dem Thema „Strategien der Konsumtion“ birgt in sich verschiedene Aspekte, die man auch als Schwierigkeiten bezeichnen könnte und die es in der vorliegenden Arbeit zu behandeln gilt. Um sich mit der anvisierten Thematik: „Strategien der Konsumtion – Kleidung, Identität und Symbolik“ auseinander zu setzen, müssen zunächst zwei grundlegende Sachverhalte geklärt werden. Was bedeutet – zum einen – der Begriff der Strategie in diesem Zusammenhang und darüber hinaus im engeren Sinne in Bezug auf die Frage nach Kleidung, Identität und Symbolik? Zum anderen muss sich mit der Frage beschäftigt werden, was Konsum oder Konsumtion an sich bedeutet und weiterführend: welche Bedeutung hat dieser Begriff für unsere heutige Welt, für die sozialen Strukturen in denen wir leben? Selbstverständlich ist die vorliegende Arbeit keine soziologische, sondern eine ethnologische und so wird im Mittelpunkt des Interesses der Blick aus der westlichen Welt hinaus zu suchen sein.
Im ersten Teil der Arbeit werden somit anfangs Grundlagen geschaffen, die durchaus auch auf soziologischer und wirtschaftswissenschaftlicher Forschung basieren. Anhand eines historischen Rückblicks, der seinen Anfang in kurzen Überlegungen zu Adam Smith und John Maynard Keynes nimmt, um sich dann ausgehend von Karl Marx mit grundlegenden Überlegungen zur Konsumtion namenhafter Soziologen zu beschäftigen, soll die oben erwähnte Frage nach der eigentlichen Bedeutung von Konsumtion, zumindest teilweise, geklärt werden. Das zweite Kapitel zu diesem Oberpunkt „Theorien der Konsumtion in der Disziplin der Völkerkunde“ wird dann aufzeigen, welche Rolle dieses Themenfeld in der Ethnologie spielte und inwiefern das Thema eben lange Zeit nicht behandelt wurde. Der Begriff der Strategie wird sich in diesem Zuge in Ansätzen miterklären, genauer wird er aber nochmals in einem nächsten allgemeinen und theoretisch fundierten Kapitel behandelt. In diesem Abschnitt werden Überlegungen zur Kleidung und ihrer Bedeutung für Identität, soziales Ich und nicht zuletzt für größere soziale Grundstrukturen und Prozesse dargelegt – die Strategien der Konsumtion kommen in diesem Zusammenhang nämlich besonders anschaulich zum Tragen.
Diese grundlegenden und spezifischeren Abschnitte dieser Arbeit werden im Folgenden als Basis für zwei Fallbeispiele dienen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Annäherung: Strategien der Konsumtion
- 2.1 Der Begriff der Konsumtion
- 2.2 Historischer Abriss aus Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
- 2.3 Theorien der Konsumtion in der Disziplin der Völkerkunde
- 3. Kleidung, Identität und Symbolik
- 3.1 Der Prozess des Programmierens
- 3.1.1 Programmieren und Kommunizieren durch Kleidung
- 3.2 Allgemeine Bedeutungen von Einkaufsstätten als soziale Räume der Konsumtion
- 3.3 Die theoretische Konzeption von „Style and Fashion“
- 3.1 Der Prozess des Programmierens
- 4. Fallbeispiele
- 4.1 Chua Beng Huat: „Life is not complete without shopping“ – Singapur
- 4.1.1 Designerboutiquen als Bühnen der Identitätsbildung
- 4.1.2 Der „Cheongsam“ als Zeichen des Chinesisch-Seins
- 4.2 Daniel Miller: „Style and Ontology“ – Trinidad
- 4.1 Chua Beng Huat: „Life is not complete without shopping“ – Singapur
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Strategien der Konsumtion im Kontext von Kleidung, Identität und Symbolik. Sie klärt zunächst den Begriff der Konsumtion und beleuchtet dessen historischen und theoretischen Hintergrund in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie in der Völkerkunde. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Konsumstrategien die Identität beeinflussen und wie sich dies in verschiedenen Kulturräumen zeigt.
- Der Begriff der Konsumtion und seine Bedeutung in verschiedenen Disziplinen
- Die Rolle von Kleidung als Ausdruck von Identität und sozialer Zugehörigkeit
- Die Symbolik von Kleidung und Konsumgütern
- Vergleichende Fallstudien aus Singapur und Trinidad
- Der Einfluss von Globalisierung auf Konsumverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage, die sich mit den Strategien der Konsumtion im Bezug auf Kleidung, Identität und Symbolik auseinandersetzt. Sie benennt die Herausforderungen, die mit der Bearbeitung dieser Thematik verbunden sind, und umreißt den Aufbau der Arbeit. Es wird betont, dass der Fokus auf einer ethnologischen Perspektive liegt, die über den westlichen Blick hinausgeht. Die Arbeit legt den Grundstein für die folgenden Kapitel, indem sie die zentralen Fragen formuliert und den methodischen Ansatz ankündigt.
2. Theoretische Annäherung: Strategien der Konsumtion: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den Forschungsstand zum Thema Konsumtion. Es beginnt mit einer Klärung des Begriffs "Konsumtion" selbst und verfolgt dann einen historischen Abriss der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, beginnend mit klassischen Ökonomen wie Adam Smith und John Maynard Keynes bis hin zu soziologischen Perspektiven. Es wird hervorgehoben, dass die Auseinandersetzung mit Konsumtion in der Ethnologie ein relativ junges Forschungsfeld darstellt. Der Abschnitt über die Theorien der Konsumtion in der Völkerkunde zeigt den bisherigen Mangel an Aufmerksamkeit für dieses Thema in der Disziplin auf und legt den Grundstein für eine ethnologisch fundierte Betrachtungsweise. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Fallbeispiele.
3. Kleidung, Identität und Symbolik: Dieses Kapitel untersucht die komplexe Beziehung zwischen Kleidung, Identität und Symbolik. Es beleuchtet den Prozess des "Programmierens" von Identität durch Kleidung und die Kommunikation, die durch Kleidung stattfindet. Der Text analysiert die Bedeutung von Einkaufsstätten als soziale Räume und die theoretische Konzeption von "Style and Fashion". Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Kleidung als Mittel der Selbstinszenierung und der sozialen Interaktion. Dieses Kapitel liefert die theoretischen Werkzeuge, um die Fallbeispiele zu analysieren.
4. Fallbeispiele: Dieses Kapitel präsentiert zwei Fallstudien, eine aus Singapur und eine aus Trinidad, um die vorherigen theoretischen Überlegungen zu illustrieren. Die Studie über Singapur konzentriert sich auf Designerboutiquen als Orte der Identitätsbildung und die Rolle des Cheongsam als Symbol chinesischer Identität. Die Studie in Trinidad analysiert die Konzepte von Style und Fashion. Ein Vergleich der beiden Fallbeispiele ermöglicht einen transkulturellen Blick auf die Konsumstrategien und die Bedeutung von Kleidung. Dieser Abschnitt veranschaulicht die theoretischen Argumente anhand konkreter Beispiele und zeigt, wie Konsumstrategien in unterschiedlichen kulturellen Kontexten funktionieren.
Schlüsselwörter
Konsumtion, Strategien, Kleidung, Identität, Symbolik, Ethnologie, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Singapur, Trinidad, Globalisierung, Style, Fashion, Identitätsbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Strategien der Konsumtion im Kontext von Kleidung, Identität und Symbolik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Strategien der Konsumtion im Kontext von Kleidung, Identität und Symbolik. Sie analysiert, wie Konsumstrategien die Identität beeinflussen und sich dies in verschiedenen Kulturräumen zeigt, mit einem Fokus auf einer ethnologischen Perspektive.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff der Konsumtion und seine Bedeutung in verschiedenen Disziplinen (Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Ethnologie), die Rolle von Kleidung als Ausdruck von Identität und sozialer Zugehörigkeit, die Symbolik von Kleidung und Konsumgütern, und vergleicht Fallstudien aus Singapur und Trinidad, um den Einfluss der Globalisierung auf das Konsumverhalten zu beleuchten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Annäherung (Strategien der Konsumtion), Kleidung, Identität und Symbolik, Fallbeispiele (Singapur und Trinidad) und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und trägt zur umfassenden Analyse der Forschungsfrage bei.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (einschließlich klassischer Ökonomen wie Adam Smith und John Maynard Keynes) sowie auf Ansätze der Völkerkunde/Ethnologie. Sie verbindet diese Perspektiven, um ein umfassendes Verständnis der Konsumstrategien zu entwickeln.
Welche Fallstudien werden untersucht?
Die Arbeit analysiert zwei Fallstudien: eine über Designerboutiquen in Singapur und die Rolle des Cheongsam als Symbol chinesischer Identität, und eine über Style und Fashion in Trinidad. Der Vergleich der beiden Fallbeispiele ermöglicht einen transkulturellen Blick auf die Konsumstrategien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konsumtion, Strategien, Kleidung, Identität, Symbolik, Ethnologie, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Singapur, Trinidad, Globalisierung, Style, Fashion, Identitätsbildung.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht, wie Konsumstrategien, insbesondere im Bereich der Kleidung, die Identität beeinflussen und wie sich dies in verschiedenen kulturellen Kontexten manifestiert. Die Arbeit betrachtet dabei den Einfluss der Globalisierung und die Bedeutung von Kleidung als Symbolträger.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine ethnologische Perspektive, die über einen westlichen Blick hinausgeht und transkulturelle Vergleiche ermöglicht. Sie kombiniert theoretische Analysen mit empirischen Fallstudien, um die Forschungsfrage zu beantworten.
- Arbeit zitieren
- Nina Waibel (Autor:in), 2007, Strategien der Konsumtion: Kleidung, Identität und Symbolik , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119876