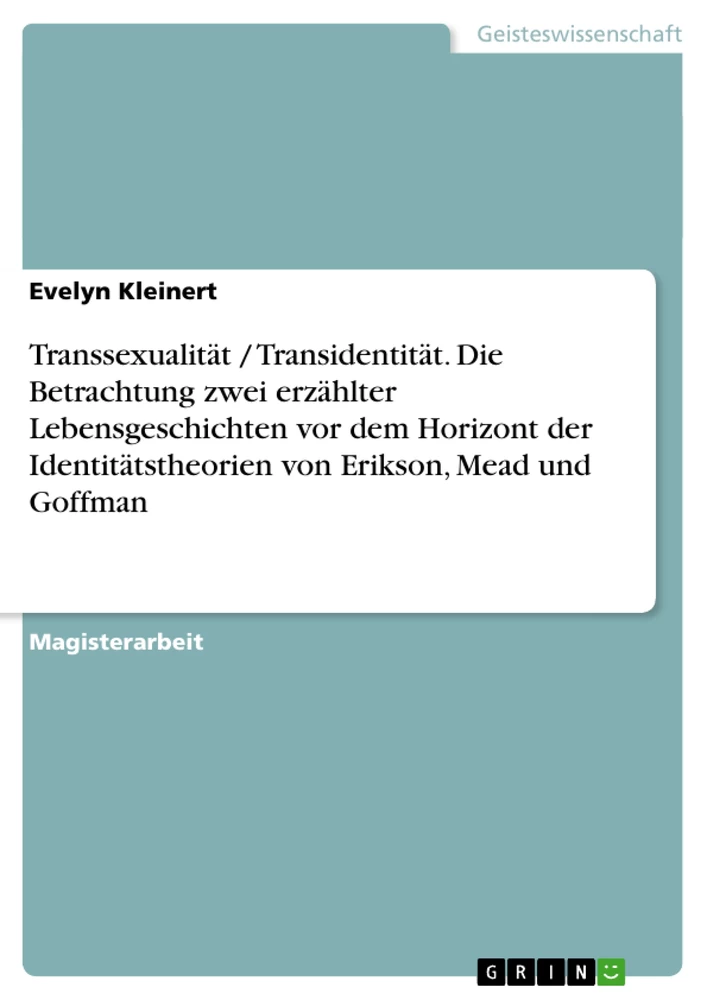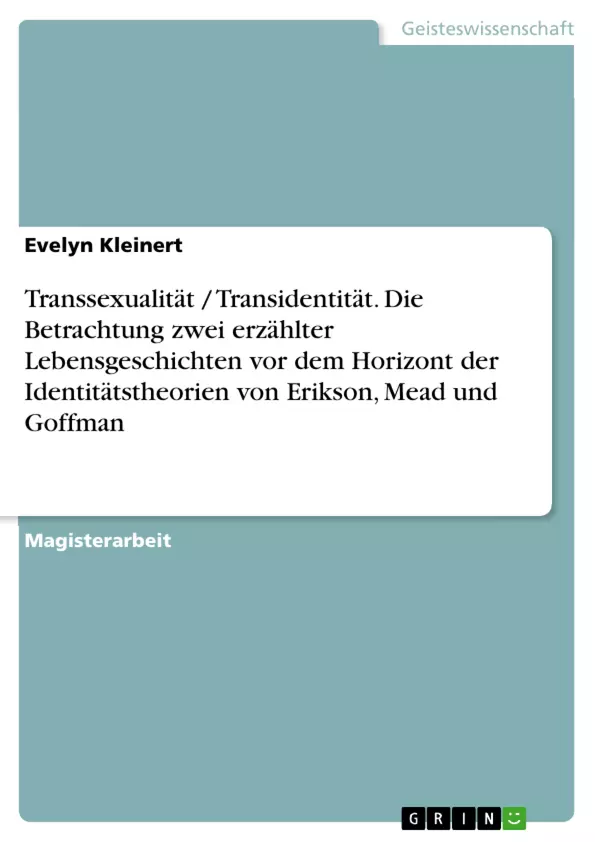Wenn ein Mensch mit einem Körper weiblichen oder männlichen Geschlechts zur Welt kommt, sich mit diesem aber nicht identifizieren und die damit verbundenen Rollen- und Verhaltensanforderungen nicht erfüllen kann spricht man von einer Störung der Geschlechtsidentität. Kommt ein dringender Wunsch hinzu, den eigenen Körper an den des anderen Geschlechtes mittels medizinischer Maßnahmen anzupassen, spricht man von Transsexualität beziehungsweise von Transidentität.
Bisher wurde dieses Thema aus psychologischer, medizinischer, politischer und historischer Perspektive wissenschaftlich bearbeitet. Das Anliegen dieser Arbeit ist es, diesen interdisziplinären Umgang mit dem Thema durch einen soziologischen Blickwinkel zu erweitern.
Hierzu sollen zunächst die bestehenden Ansätze vorgestellt werden:
So beschäftigt sich der zweite Teil der Arbeit mit Transidentität als Krankheit. So wird herausgearbeitet, wie sowohl im medizinischen als auch im psychologischen Kontext mit Transidentität umgegangen wird, wobei diese beiden Bereiche eng miteinander verknüpft sind. Dabei werden die Probleme der Symptomatik, Diagnostik und der Differentialdiagnostik diskutiert, die eher in den Bereich der Psychologie fallen. Die Medizin beschäftigt sich vorwiegend mit der hormonellen und chirurgischen Umsetzung des Wunsches nach einem Geschlechtswechsel. Auch darauf wird näher eingegangen.
Des Weiteren wird das Phänomen der Transidentität aus historischer Sicht betrachtet, wobei der Schwerpunkt auf dem Wandel der begrifflichen Verwendung liegt. Im Folgenden wird Transidentität aus juristischer Perspektive betrachtet. Hierbei wird das geltende Transsexuellengesetz vorgestellt. Dieses regelt alle Fragen der Namens- und Personenstandsänderung und ermöglicht ein Zustandekommen scheinbarer Paradoxien. So kommt es vor, dass eine transidente Person bereits ihren Vornamen geändert hat, aber in ihren Personalien noch in ihrem ursprünglichen Geschlecht aufgeführt ist. Auf diese Weise kommt es zu Formulierungen wie „Herr Marliese Müller“, oder „Frau Matthias Meier“. Der dritte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Methode des narrativen Interviews.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Von der Geschlechtsidentität und deren Störungen
- 2 Das Themenfeld: Transsexualität
- 2.1 Was ist Transsexualität?
- 2.2 Transidentität aus historischer Perspektive
- 2.3 Transidentität als „Krankheit“
- 2.3.1 Symptomatik – Diagnostik – Differenzialdiagnostik
- 2.3.2 Behandlungsmöglichkeiten
- 2.4 Transidentität aus juristischer Perspektive
- 3 Methodischer Teil - Qualitative Sozialforschung
- 3.1 Zur Wahl der Untersuchungsmethode
- 3.2 Qualitative Sozialforschung
- 3.2.1 Zum Verhältnis zwischen qualitativem und quantitativem Forschungsparadigma
- 3.2.2 Gütekriterien in qualitativen Untersuchungen
- 3.3 Die Datenerhebung anhand von Interviews
- 3.4 Auswertung der Interviews
- 3.5 Auswahl der zu Interviewenden
- 3.6 Kritische Auseinandersetzung mit dem Umgang mit der Methode des narrativen Interviews
- 4. Die Biographien von A. Neubert und S. Meinhart
- 4.1 A. Neubert
- 4.1.1 Kontaktaufnahme
- 4.1.2 Das ganze Leben ist ein Spiel
- 4.2 S. Meinhart
- 4.2.1 Kontaktaufnahme
- 4.2.2 Der Glückspilz
- 4.3 Methodische Bemerkungen
- 4.1 A. Neubert
- 5 Theoretischer Hintergrund – Identität
- Exkurs: Sozialisationstheorie
- 5.1 „Ich gehörte meinem biologischen Geschlecht nie richtig an.“ „Identität“ als Kontinuität und Gleichheit in der Zeit
- 5.2 „Die anderen müssen mich in meinem Wunschgeschlecht erkennen“ Die Bedeutung der Interaktion für die Identität
- 5.3 Die Inszenierung der Identität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht Transsexualität/Transidentität aus soziologischer Perspektive, erweitert damit den interdisziplinären Diskurs und analysiert zwei Lebensgeschichten im Kontext von Identitätstheorien (Erikson, Mead, Goffman).
- Soziologische Betrachtung von Transsexualität/Transidentität
- Analyse zweier Lebensgeschichten transsexueller Personen
- Anwendung von Identitätstheorien auf die Fallbeispiele
- Methodische Auseinandersetzung mit dem narrativen Interview
- Juristische und historische Perspektiven auf Transidentität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 1 behandelt die Störung der Geschlechtsidentität. Kapitel 2 beleuchtet Transsexualität/Transidentität aus medizinischer, psychologischer, historischer und juristischer Sicht. Kapitel 3 beschreibt die qualitative Forschungsmethode (narratives Interview) und die Auswahl der Interviewpartner. Kapitel 4 präsentiert Auszüge der beiden Lebensgeschichten. Kapitel 5 verbindet die Lebensgeschichten mit den Identitätstheorien von Erikson, Mead und Goffman.
Schlüsselwörter
Transsexualität, Transidentität, Geschlechtsidentität, Identitätstheorien (Erikson, Mead, Goffman), Qualitative Sozialforschung, Narratives Interview, Lebensgeschichten, Soziologie, Medizin, Psychologie, Juristische Perspektive, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Transsexualität und Transidentität?
Transsexualität betont oft den Wunsch nach medizinischer Körperanpassung, während Transidentität den Fokus auf das innere Wissen um die eigene Geschlechtsidentität legt, die nicht mit dem Geburtsgeschlecht übereinstimmt.
Welche Identitätstheorien werden in der Arbeit genutzt?
Die Arbeit analysiert Lebensgeschichten auf Basis der Theorien von Erikson (Identitätsentwicklung), Mead (Interaktionismus) und Goffman (Selbstpräsentation/Inszenierung).
Was regelt das Transsexuellengesetz (TSG)?
Das TSG regelt die rechtlichen Voraussetzungen für die Änderung des Vornamens und des Personenstands (Geschlechtseintrag) in offiziellen Dokumenten.
Was ist ein "narratives Interview"?
Eine qualitative Forschungsmethode, bei der die Befragten ihre Lebensgeschichte frei erzählen, um tiefe Einblicke in ihre biografische Entwicklung und Identitätsbildung zu geben.
Welche Rolle spielt die Medizin bei Transidentität?
Die Medizin befasst sich primär mit hormonellen Behandlungen und chirurgischen Eingriffen zur Angleichung des Körpers an das empfundene Geschlecht.
- Citar trabajo
- MA Evelyn Kleinert (Autor), 2008, Transsexualität / Transidentität. Die Betrachtung zwei erzählter Lebensgeschichten vor dem Horizont der Identitätstheorien von Erikson, Mead und Goffman, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120763