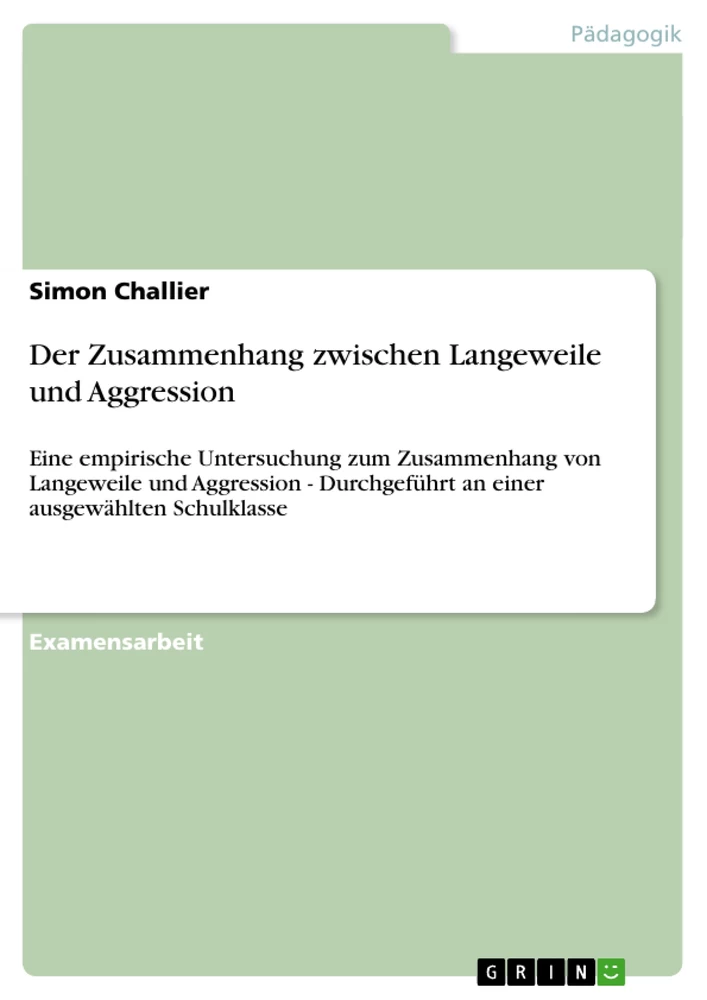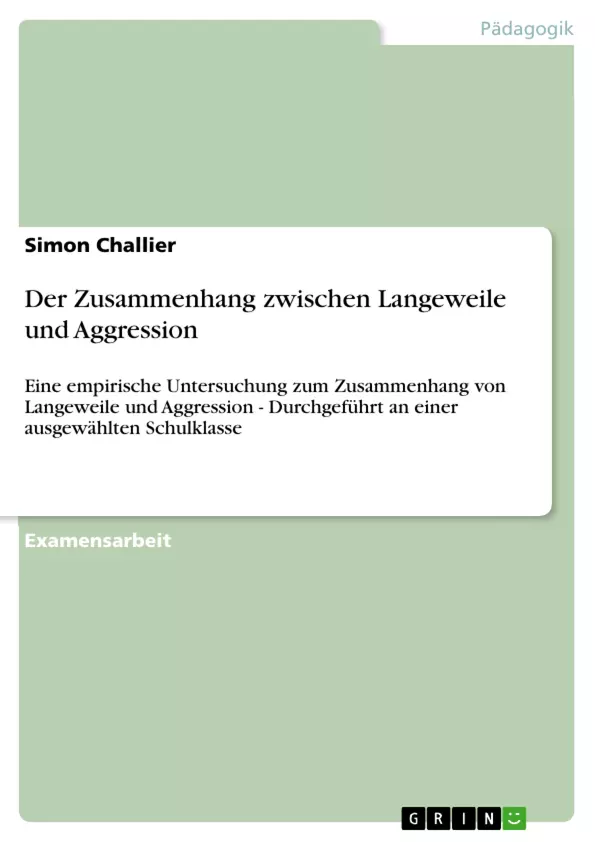Was ist die Ursache eines erhöhten Aggressionspotentials bei Jugendlichen? Die Ursachenforschung zur Entstehung von Aggressionen und zur erhöhten Gewaltbereitschaft wird schon seit längerer Zeit betrieben und die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Eines ist den meisten dieser Studien jedoch gemein, sie alle ziehen die verhaltensbiologischen Ansätze bei ihren Ursachenforschungen
nicht in Betracht. Allerdings kann eben genau dieser Ansatz der Verhaltensbiologie dazu beitragen, eine Erklärung für ein erhöhtes Aggressionspotential zu liefern.
In der vorliegenden Arbeit sollen diese Ansätze der Verhaltensbiologie näher
durchleuchtet werden. Zuerst wird dem Leser die Triebtheorie von Lorenz aufgezeigt. Anhand dieser Theorie wird erklärt, wie es zu dem vermehrten Aufkommen von Aggressionen kommen kann. Die theoretischen Erkenntnisse sollen
abschließend in einer empirischen Studie über den Zusammenhang zwischen
Langeweile und Aggression überprüft werden. Diese Studie und die daraus
abgeleiteten Ergebnisse werden im dritten Teil der vorliegenden Arbeit erläutert
und dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Vorüberlegungen
- 2.1 Überblick über die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie
- 2.1.1 Konrad Lorenz und seine Theorie der Triebe
- 2.1.2 Verwöhnung und Aggression
- 2.2 Die Triebtheorie bei Tier und Mensch
- 2.2.1 Triebsystem und Reflexion als Quelle menschlichen Verhaltens
- 2.2.2 Triebstärke und Reizstärke
- 2.2.2.1 Das Prinzip der doppelten Quantifizierung bei Tieren
- 2.2.2.2 Das Prinzip der doppelten Quantifizierung beim Menschen
- 2.2.3 Spontaneität der Triebe: das Appetenzverhalten
- 2.2.3.1 Das Appetenzverhalten bei Tieren
- 2.2.3.2 Das Appetenzverhalten beim Menschen
- 2.3 Triebtheorie der Aggression
- 2.3.1 Triebtheorie der Aggression bei Tieren
- 2.3.2 Triebtheorie der Aggression beim Menschen
- 2.4 Andere Aggressionstheorien
- 2.4.1 Frustrations-Aggressions-Theorie
- 2.4.2 Lerntheorie der Aggression
- 2.5 Verwöhnung als Ursache von Aggressionen
- 2.5.1 Definition Verwöhnung
- 2.5.2 Folgen der Verwöhnung
- 2.5.2.1 Steigende Ansprüche und aggressive Langeweile
- 2.5.2.2 Überhöhtes Aktionspotential
- 2.5.2.3 Überhöhtes Aggressionspotential
- 2.5.3 Der Neugiertrieb und Verwöhnung
- 2.5.3.1 Verhaltensbiologischer Sinn der Neugier
- 2.5.3.2 Neugier als Trieb
- 2.5.3.3 Unbefriedigte Aktionspotentiale
- 2.5.4 Massenmedien als Endstadium der Verwöhnung
- 2.5.4.1 Fernsehen
- 2.5.4.2 Computer
- 2.6 Ausblick auf die Untersuchung zum Zusammenhang zwischen Langeweile und Aggression
- 3 Empirische Untersuchung zum Zusammenhang zwischen Langeweile und Aggression
- 3.1 Aufbau der Studie
- 3.1.1 Zielsetzung
- 3.1.2 Hypothesengenerierung
- 3.2 Methodik
- 3.2.1 Wahl der Datenerhebungsmethode
- 3.2.1.1 Befragung als dominantes Datenerhebungsverfahren
- 3.2.1.2 Die Vor- und Nachteile einer Fragebogenerhebung
- 3.2.2 Konstruktion des Fragebogens
- 3.2.2.1 Formulierung der Items
- 3.2.2.2 Itemformate
- 3.2.2.3 Antwortkategorien
- 3.2.2.4 Aufbau des Fragebogens
- 3.2.3 Gütekriterien
- 3.2.4 Pretest
- 3.2.5 Durchführung der Untersuchung
- 3.2.6 Datenanalyse und -auswertung
- 3.3 Ergebnisse
- 3.3.1 Hypothese 1
- 3.3.1.1 Einteilung in hypothesenspezifische Gruppen
- 3.3.1.2 Untersuchung der Hypothese
- 3.3.2 Hypothese 2
- 3.3.2.1 Einteilung in hypothesenspezifische Gruppen
- 3.3.2.2 Untersuchung der Hypothese
- 3.3.3 Hypothese 3
- 3.3.3.1 Einteilung in hypothesenspezifische Gruppen
- 3.3.3.2 Untersuchung der Hypothese
- 3.3.4 Hypothese 4
- 3.3.4.1 Einteilung in hypothesenspezifische Gruppen
- 3.3.4.2 Untersuchung der Hypothese
- 4 Diskussion und Ausblick
- 4.1 Diskussion der Ergebnisse
- 4.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Langeweile und Aggression. Ziel ist es, durch eine empirische Untersuchung an einer Schulklasse diese Beziehung zu belegen oder zu widerlegen. Die Studie basiert auf theoretischen Vorüberlegungen aus der Verhaltensbiologie und Aggressionstheorien.
- Verhaltensbiologische Grundlagen von Aggression
- Triebtheorien der Aggression
- Alternative Aggressionstheorien (Frustrations-Aggressions-Theorie, Lerntheorie)
- Der Einfluss von Langeweile als Auslöser für Aggression
- Empirische Überprüfung des Zusammenhangs von Langeweile und Aggression
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beginnt mit aktuellen Beispielen von Jugendgewalt, um die Relevanz des Themas zu unterstreichen. Sie verortet das Thema im gesellschaftlichen Kontext und leitet zur Fragestellung der Arbeit über, nämlich den Zusammenhang zwischen Langeweile und Aggression zu untersuchen. Die erschütternden Beispiele von Gewaltdelikten dienen als eindrucksvoller Aufhänger und betonen die Notwendigkeit der Forschung in diesem Bereich.
2 Theoretische Vorüberlegungen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es präsentiert einen Überblick über verhaltensbiologische Erkenntnisse, insbesondere die Triebtheorie nach Konrad Lorenz, und diskutiert die Rolle von Verwöhnung als potentiellen Auslöser von Aggression. Es werden verschiedene Aggressionstheorien gegenübergestellt und analysiert, um ein fundiertes Verständnis des komplexen Zusammenspiels zwischen inneren Trieben und äusseren Einflüssen auf aggressives Verhalten zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Erklärung von Aggression im Kontext von Triebtheorien und der Rolle von unbefriedigten Bedürfnissen und Langeweile als potenzielle Auslöser.
3 Empirische Untersuchung zum Zusammenhang zwischen Langeweile und Aggression: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und die Ergebnisse der empirischen Studie. Es wird detailliert auf die Zielsetzung, die Hypothesen, die gewählte Datenerhebungsmethode (Fragebogen), die Konstruktion des Fragebogens (Itemformulierung, Antwortkategorien), sowie die Durchführung und Auswertung der Studie eingegangen. Die Ergebnisse der Hypotheseprüfung werden dargestellt, ohne jedoch konkrete Zahlen oder detaillierte Schlussfolgerungen vorwegzunehmen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Vorgehens und der systematischen Analyse der erhobenen Daten.
Schlüsselwörter
Langeweile, Aggression, Verhaltensbiologie, Triebtheorie, Konrad Lorenz, Verwöhnung, Frustrations-Aggressions-Theorie, Lerntheorie, Empirische Untersuchung, Fragebogen, Jugendgewalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Zusammenhang zwischen Langeweile und Aggression
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Langeweile und Aggression, insbesondere bei Jugendlichen. Sie basiert auf verhaltensbiologischen Grundlagen und verschiedenen Aggressionstheorien.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Verhaltensbiologie, speziell die Triebtheorie nach Konrad Lorenz. Weitere relevante Theorien sind die Frustrations-Aggressions-Theorie und die Lerntheorie der Aggression. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle von Verwöhnung als möglicher Auslöser von Aggression und der Bedeutung unbefriedigter Bedürfnisse (z.B. durch Langeweile).
Welche Methode wurde zur Untersuchung des Zusammenhangs verwendet?
Es wurde eine empirische Untersuchung mittels Fragebogen an einer Schulklasse durchgeführt. Die Arbeit beschreibt detailliert die Konstruktion des Fragebogens (Itemformulierung, Antwortkategorien), die Durchführung der Studie und die anschließende Datenanalyse und -auswertung. Die Vor- und Nachteile der Fragebogenerhebung werden ebenfalls diskutiert.
Welche Hypothesen wurden geprüft?
Die Arbeit formuliert mehrere Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Langeweile und Aggression. Die konkreten Hypothesen und deren Überprüfung werden im Kapitel "Empirische Untersuchung" detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Hypotheseprüfung werden jedoch ohne konkrete Zahlen oder detaillierte Schlussfolgerungen im FAQ zusammengefasst.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Hypotheseprüfung. Eine detaillierte Beschreibung der Ergebnisse findet sich im Kapitel "Ergebnisse" der Arbeit. Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Hypothesen systematisch dargestellt und interpretiert. Konkrete Zahlen oder detaillierte Schlussfolgerungen werden im FAQ nicht vorweggenommen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Langeweile, Aggression, Verhaltensbiologie, Triebtheorie, Konrad Lorenz, Verwöhnung, Frustrations-Aggressions-Theorie, Lerntheorie, Empirische Untersuchung, Fragebogen, Jugendgewalt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Theoretische Vorüberlegungen, Empirische Untersuchung und Diskussion und Ausblick. Die Einleitung stellt das Thema vor und begründet seine Relevanz. Die theoretischen Vorüberlegungen liefern den wissenschaftlichen Hintergrund. Die empirische Untersuchung beschreibt die Methodik und Ergebnisse der Studie. Schließlich werden die Ergebnisse diskutiert und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen gegeben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit den Themen Aggression, Jugendgewalt, Verhaltensbiologie und der Rolle von Langeweile als potenziellen Auslöser von aggressivem Verhalten beschäftigen. Sie richtet sich an Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die ein tiefergehendes Verständnis dieser komplexen Zusammenhänge gewinnen möchten.
- Arbeit zitieren
- Simon Challier (Autor:in), 2008, Der Zusammenhang zwischen Langeweile und Aggression, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120806