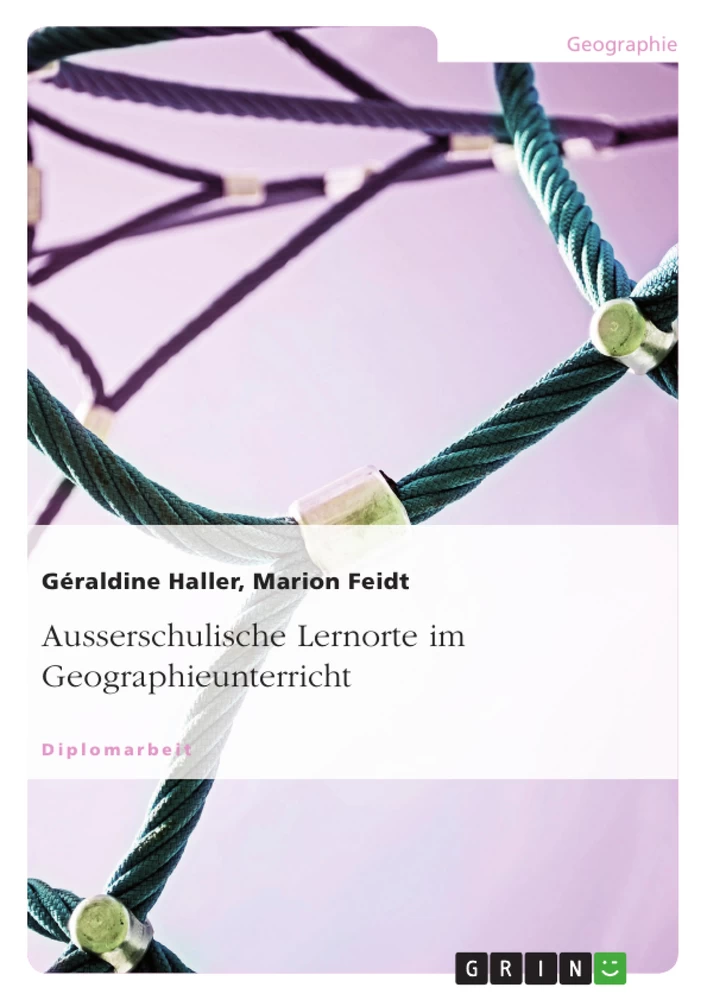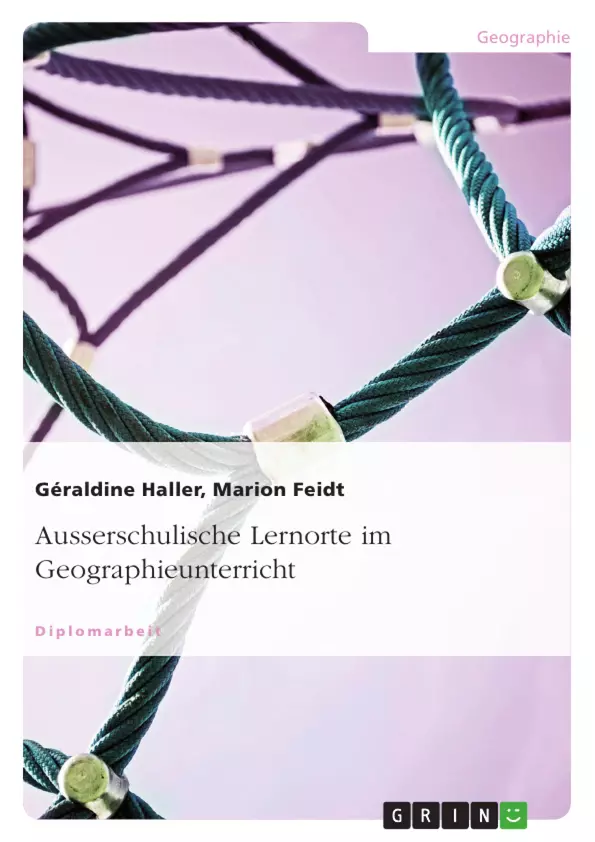"Das erste Beginnen jeder Methodik muss deshalb sein, das originale Kind, wie es von sich aus in die Welt hineinlebt, mit dem originalen Gegenstand, wie er seinem eigentlichen Wesen nach ist, so in Verbindung zu bringen, dass das Kind fragt, weil ihm der Gegenstand Fragen stellt, und der Gegenstand Fragen aufgibt, weil er eine Antwort für das Kind hat." (Roth, 1973, S.111)
In den letzten Jahrzehnten hat ein schneller und tiefgreifender Wandel in fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens stattgefunden. Der rasante gesellschaftliche Wandel hat einschneidende Veränderungen für das Aufwachsen der Kinder mit sich gebracht und damit auch für die Schule. Als Hauptmerkmal heutiger Kindheit wird häufig die Entsinnlichung der Lebenswirklichkeit genannt. Kinder wachsen überwiegend in einer mediatisierten und verinselten Welt auf, die von Leistungskonkurrenz geprägt ist und sinnlichen Erfahrungen nur wenig Raum lässt. Gesellschaftlich-ökonomische Veränderungen haben die Erfahrungsmöglichkeiten von Kindern stark eingeschränkt, bzw. verschoben, so dass es für sie immer schwieriger wird, sich ihre Lebenswelt zu erschließen. Beispiele sind die dicht besiedelten Wohngebiete und die Verhäuslichung, die sogenannten Erfahrungen aus zweiter Hand und ein veränderter Umgang mit der Zeit.
Die neuzeitlichen Veränderungen der Lebensumwelt haben die Gelegenheiten für Primärerfahrungen der Kinder in ihrer Umgebung und in der Natur stark reduziert. Die heutigen "Multimedia - Kids" sind also nicht mehr mit Kindern früherer Jahrgänge zu vergleichen. Sie wachsen in einer ganz anderen Welt auf, die geprägt ist durch Fernsehprogrammvielfalt, Videoclips und aufwändige Computerspiele. Die Fähigkeit zur Abstraktion und zur Konzentration ist bei vielen Schülern stark zurück gegangen. Nur wenige Kinder haben heute noch einen unmittelbaren Zugang zur Natur. Fernsehen, Kassetten, Bücher usw. vermitteln den Kindern eine Fülle von Informationen, jedoch aus zweiter Hand. Die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse bleiben auf der Strecke.
Die Konsequenzen dieses Wandels (die man als Lehrer bedauern und bejammern könnte) und deren Bedeutung für das Schulwesen wurden allerdings erst in den letzten Jahren wahrgenommen. Dieser Entwicklung kann die Schule entgegenwirken, indem sie den Unterricht darauf einstellt und es sich zur Aufgabe macht, zur Rückgewinnung von Erfahrungsräumen für Kinder beizutragen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Theoretischer Teil
- Einleitung
- 1. Veränderte Kindheit
- 1.1. Veränderung der kindlichen Lebens- und Zeiträume
- 1.2. Veränderung der Kindheit durch Medien
- 1.3. Kinder in einer Vielfalt der Kulturen
- 1.4. Veränderung der Konzentrationsfähigkeit der Kinder
- 2. Forderungen an die Schule
- 2.1. Allgemeine Überlegungen
- 2.2. Unterrichtskonzepte und -prinzipien
- 2.2.1. Anschauungsunterricht und Realbegegnung
- 2.2.2. Ganzheitliches Lernen
- 2.2.3. Handlungsorientiertes (handelndes) Lernen
- 2.2.4. Soziales Lernen
- 2.2.5. Problemorientiertes Lernen
- 2.2.6. Schülerorientiertes Lernen
- 2.2.7. Situatives Lernen
- 2.3. Schlussfolgerung
- 2.4. Der Lehrplan
- 3. Außerschulische Lernorte
- 3.1. Definition
- 3.2. Begriffliche Hinweise zum Thema „außerschulisches Lernen”
- 3.3. Begründung außerschulischen Lernens
- 3.3.1. Anschauungsunterricht (Realbegegnung) am außerschulischen Lernort
- 3.3.2. Ganzheitliches Lernen am außerschulischen Lernort
- 3.3.3. Handlungsorientiertes (handelndes) Lernen am außerschulischen Lernort
- 3.3.4. Soziales Lernen am außerschulischen Lernort
- 3.3.5. Schülerorientiertes Lernen am außerschulischen Lernort
- 3.3.6. Situatives Lernen am außerschulischen Lernort
- 3.3.7. Entdeckendes Lernen am außerschulischen Lernort
- 3.3.8. Anwendung von Arbeitsweisen und -techniken
- 3.4. Anforderungen an außerschulische Lernorte oder Kriterien eines geeigneten außerschulischen Lernortes
- 3.5. Der außerschulische Lernort und seine Bedeutung für den Geographieunterricht
- 4. Leitlinien für Planung und Organisation: Was muss bedacht werden?
- 4.1. Didaktisch-methodische Überlegungen
- 4.1.1. Lehrplanbezug
- 4.1.2. Der didaktische Ort außerschulischen Lernens
- 4.1.2.1. Der Unterrichtsgang zu Beginn der Unterrichtseinheit
- 4.1.2.2. Der Unterrichtsgang innerhalb einer Unterrichtseinheit
- 4.1.3. Methodisches Vorgehen und Schüleraktivitäten
- 4.1.3.1. Mögliche Aktivitäten in der Vorbereitungsphase
- 4.1.3.2. Mögliche Aktivitäten in der Durchführungsphase
- 4.1.3.3. Mögliche Aktivitäten in der Nachbereitungsphase
- 4.2. Rolle des Lehrers
- 4.3. Administrative Voraussetzungen und Haftungsfrage
- 4.4. Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen
- 4.4.1. Information der Eltern
- 4.4.2. Transport
- 4.4.3. Verhaltensregeln laut „Code de la route populaire”
- 4.4.4. Medizinische Versorgung
- II. Praktischer Teil
- 1. Möglichkeiten außerschulischen Lernens im Geographieunterricht des Obergrades
- 2. Stadt-Rallye
- 2.1. Zur Wahl dieses außerschulischen Lernens
- 2.2. Vorbereitende Maßnahmen
- 2.2.1. Festlegen der Route und Stationen
- 2.2.2. Sachanalyse der einzelnen Stationen
- 2.2.3. Abschließende Vorbereitungen
- 2.3. Vorbereitungsphase
- 2.3.1. Lernziele
- 2.3.2. Unterrichtsverlauf
- 2.3.3. Kommentar
- 2.4. Durchführungsphase
- 2.4.1. Lernziele
- 2.4.2. Verlauf der Stadt-Rallye
- 2.4.3. Kommentar
- 2.5. Nachbereitungsphase
- 2.5.1. Lernziele
- 2.5.2. Unterrichtsverlauf
- 2.5.3. Kommentar
- 3. Thillenvogtei („musée rural vivant”)
- 3.1. Zur Wahl dieses außerschulischen Lernortes
- 3.2. Vorbereitende Maßnahmen
- 3.2.1. Vorhergehende Besichtigung
- 3.2.2. Organisatorische Maßnahmen
- 3.2.2.1. Schulkommission
- 3.2.2.2. Transport
- 3.2.2.3. Elternbrief
- Veränderte Kindheit und ihre Auswirkungen auf den Unterricht
- Forderungen an die Schule im Hinblick auf die moderne Bildung
- Bedeutung und Begründung außerschulischen Lernens
- Didaktische und methodische Aspekte der Planung und Organisation außerschulischer Lerngänge
- Praktische Beispiele für außerschulische Lerngänge im Geographieunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Abschlussarbeit „Außerschulische Lernorte im Geographieunterricht” befasst sich mit der Integration außerschulischer Lernorte in den Geographieunterricht. Die Autoren untersuchen die Bedeutung dieser Lernorte im Kontext der veränderten Kindheit und der sich entwickelnden Anforderungen an die Schule.
Zusammenfassung der Kapitel
Der theoretische Teil der Arbeit beleuchtet zunächst die Veränderungen in der Kindheit und ihre Auswirkungen auf das Lernverhalten von Kindern. Anschließend werden die Forderungen an die Schule im Kontext dieser Veränderungen diskutiert, wobei verschiedene Unterrichtskonzepte und -prinzipien, wie z.B. Anschauungsunterricht, Ganzheitliches Lernen und Handlungsorientiertes Lernen, im Detail betrachtet werden. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung des außerschulischen Lernens und seiner theoretischen Begründung.
Der praktische Teil präsentiert zwei konkrete Beispiele für außerschulische Lerngänge im Geographieunterricht: eine Stadt-Rallye und eine Exkursion zur Thillenvogtei. Für beide Lerngänge werden die Planung und Organisation, die Lernziele und der Unterrichtsverlauf detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf zentrale Themen wie außerschulische Lernorte, Geographieunterricht, veränderte Kindheit, Unterrichtskonzepte, didaktische und methodische Aspekte, Planung und Organisation, praktische Beispiele, Stadt-Rallye und Thillenvogtei. Darüber hinaus spielen Themen wie Anschauungsunterricht, Ganzheitliches Lernen, Handlungsorientiertes Lernen und Schülerorientierung eine wichtige Rolle.
- Quote paper
- Géraldine Haller (Author), Marion Feidt (Author), 2002, Ausserschulische Lernorte im Geographieunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12151