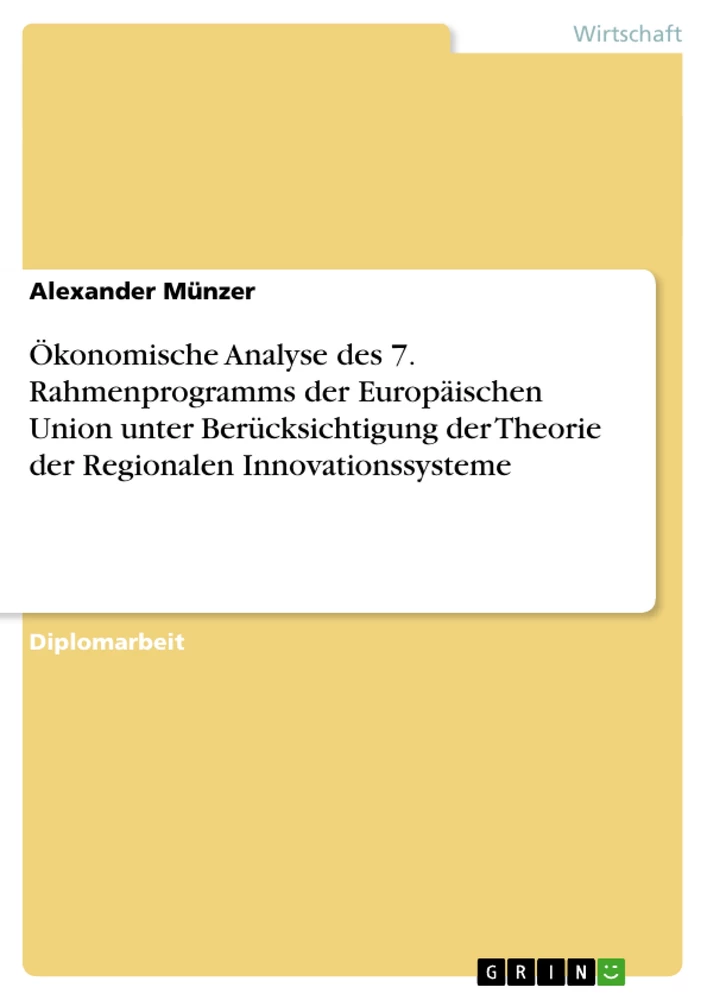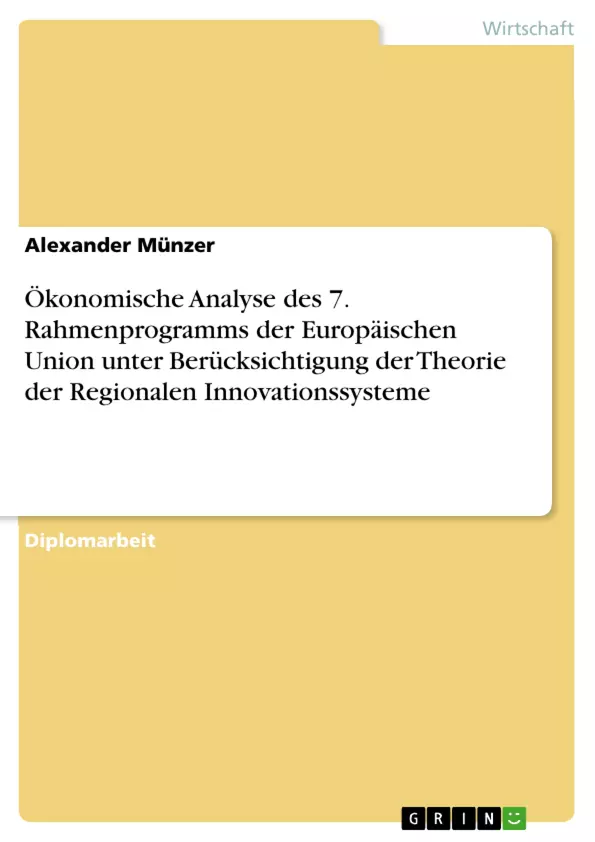Das letzte Jahrhundert war für Europa von einschneidender Veränderung. Der zweite Weltkrieg hatte z.B. die Teilung in zwei Ideologien zur Folge und der Kalte Krieg führte u.a. zu einer Trennung der bis dahin gemeinsamen Kultur, wodurch sich auch eine Aufteilung der Wirtschaftsräume vollzog. Während Westeuropa unter der Marktwirtschaft und den offenen Wirtschaftsräumen und –märkten aufblühte, regelte im Warschauer Pakt der Sozialismus das wirtschaftliche Leben. Hier wie dort wurden jedoch Forschung und technologische Entwicklung größtenteils von Staaten finanziert und umgesetzt sowie militärische Innovationen im Laufe der Zeit auch der zivilen Nutzung zugänglich gemacht. Mit dem Fall der Berliner Mauer begann das Zusammenwachsen der Regionen und Kulturen Europas, was sich auch in Institutionen wie der Europäischen Union (EU) widerspiegelte. Als Folge hieraus nahm jedoch auch der Wettbewerb zwischen den einzelnen europäischen Regionen zu. Darüber hinaus führten die Globalisierung und die sich daraus ergebenden Auswirkungen für die Regionen Europas auch zu Kontroversen. So zeichnet sich nun der Westen Europas z.B. durch gute Infrastrukturen aus, wogegen im Osten billiger produziert wird, was einen Wechsel von Produktionsstandorten in Billiglohnländer zur Folge hat.
Nach und nach traten osteuropäische Staaten der EU bei, so dass neben dem schon vorherrschenden Nord-Süd-Gefälle nun auch noch ein Ost-West-Unterschied in der EU hinzukommt. Diese Unterschiede sind nicht nur zwischen den einzelnen Ländern spürbar, sondern auch zwischen den Regionen. Es besteht somit eine regionale Differenzierung der Verfügbarkeit, die sich in den klassischen Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital sowie dem vor allem für die Innovationsfähigkeit immer bedeutender werdenden vierten Produktionsfaktor, dem Wissen, auszeichnet, dem in der heutigen Zeit bereits ein Anteil an der allgemeinen Wertschöpfung in Höhe von ca. 50 % zugeschrieben wird (vgl. Backhaus 2000 : 7). Durch Innovationen, d.h. Forschung und technologische Entwicklung, streben Staaten und Regionen nach Abgrenzung, um so eine Vormachtstellung innerhalb eines Wirtschaftszweigs einnehmen zu können. Sie erhoffen sich so wirtschaftliche Vorteile, die sich z.B. in einem stabilen Wirtschaftswachstum, der Schaffung von Arbeitsplätzen mit Dezimierung der Arbeitslosenzahlen oder einer Erhöhung der Lebensqualität für die heimische Bevölkerung auszeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Spagat zwischen der europäischen und regionalen Betrachtungsweise
- Glokalisierung
- Die regionale Dimension auf Europäischer Ebene
- Innovationstheorie und Innovationsmodelle
- Theorie der Innovation
- Wissen, Lernen und Interaktion
- Theorie der Innovationssysteme
- Nationale Innovationssysteme
- Theorie der Innovation
- Regionale Innovationssysteme
- Der Ursprung der RIS
- Die Region als Betrachtungsebene
- Regionalisierung
- Rahmenbedingungen einer Region
- Systembegriff
- Konzept und Definitionsmerkmale der RIS
- Akteure im RIS
- Finanzen im RIS
- Regionale Budgets
- Finanzierung von Infrastruktur
- Lernen im RIS
- Netzwerke und Cluster
- Politik im RIS
- Modell nach Autio
- Typisierung der RIS nach Cooke
- Zwischenfazit
- Forschungsrahmenprogramme der EU
- Lissabon-Strategie und Europäische Forschungsraum
- Die Forschungsrahmenprogramme
- Fünftes Rahmenprogramm
- Thematische Programme
- Horizontale Programme
- Sicherung der internationalen Stellung der Gemeinschaftsforschung
- Förderung der Innovation und Einbeziehung von KMU
- Ausbau des Potentials an Humanressourcen
- Sechstes Rahmenprogramm
- Spezielle Maßnahmen
- Ausgestaltung des Europäischen Forschungsraums
- Forschung und Innovation
- Humanressourcen und Mobilität
- Forschungsinfrastruktur
- Wissenschaft und Gesellschaft
- Stärkung der Grundpfeiler des Europäischen Forschungsraums
- Siebtes Rahmenprogramm
- Zusammenarbeit
- Idee
- Mensch
- Kapazität
- Forschungsinfrastruktur
- KMU
- Wissensorientierte Regionen
- Forschungspotenzial
- Wissenschaft und Gesellschaft
- Internationale Zusammenarbeit
- Ökonomische Analyse des siebten Rahmenprogramms
- Datenbeschaffung und Problematik
- Durchführung der ökonomischen Analyse
- Netzwerkbeziehungen und räumliche Nähe
- Humanressourcen
- Unternehmensbeteiligung am Rahmenprogramm
- Unterstützung der Regionen
- Auswirkungen des Rahmenprogramms für Europa
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die ökonomische Analyse des siebten Forschungsrahmenprogramms der Europäischen Union im Kontext der Theorie der Regionalen Innovationssysteme. Die Arbeit zielt darauf ab, Parallelen und Unterschiede zwischen der Theorie und der Praxis der Förderprogramme aufzuzeigen und die ökonomischen Vorteile einer Beteiligung am Rahmenprogramm zu beleuchten.
- Regionale Innovationssysteme (RIS) und deren Bedeutung für die Innovationsfähigkeit
- Ökonomische Analyse der Forschungsrahmenprogramme der EU
- Der Einfluss des Europäischen Forschungsraums auf regionale Entwicklungen
- Die Rolle von KMU und Humanressourcen in Innovationsprozessen
- Zusammenhang zwischen Wissenstransfer, Netzwerkbildung und Innovationserfolg
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 untersucht die Relevanz der regionalen Perspektive im Kontext der EU-Förderpolitik. Kapitel 3 definiert den Innovationsbegriff und beschreibt verschiedene Innovationsmodelle. Kapitel 4 erläutert die Theorie der regionalen Innovationssysteme (RIS), inklusive ihrer Akteure, Finanzierungsmechanismen und Rolle der Politik. Kapitel 5 gibt einen Überblick über die Forschungsrahmenprogramme der EU, insbesondere das fünfte und sechste Programm.
Schlüsselwörter
Regionale Innovationssysteme, Forschungsrahmenprogramme EU, Europäischer Forschungsraum, Innovation, Wissenstransfer, KMU, Humanressourcen, Netzwerkbildung, ökonomische Analyse, Lissabon-Strategie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Regionales Innovationssystem (RIS)?
Ein RIS ist ein Netzwerk aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und politischen Akteuren in einer Region, die zusammenarbeiten, um Innovationen zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Was war das Ziel des 7. Forschungsrahmenprogramms der EU?
Das Programm diente der Förderung von Forschung und technologischer Entwicklung in Europa, um den Europäischen Forschungsraum zu stärken und die Lissabon-Strategie umzusetzen.
Welche Rolle spielen KMU in Innovationsprozessen?
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelten als Motor für regionale Innovationen, benötigen aber oft Unterstützung durch Netzwerke und Zugang zu Forschungsinfrastruktur.
Was bedeutet „Glokalisierung“?
Es beschreibt den Spagat zwischen globalem Wettbewerb und der Bedeutung lokaler bzw. regionaler Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Erfolg.
Wie wird Wissen als Produktionsfaktor definiert?
Wissen gilt heute als der vierte Produktionsfaktor neben Arbeit, Boden und Kapital und trägt maßgeblich zur allgemeinen Wertschöpfung und Innovationsfähigkeit bei.
- Citar trabajo
- Diplom-Kaufmann Alexander Münzer (Autor), 2007, Ökonomische Analyse des 7. Rahmenprogramms der Europäischen Union unter Berücksichtigung der Theorie der Regionalen Innovationssysteme, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122075