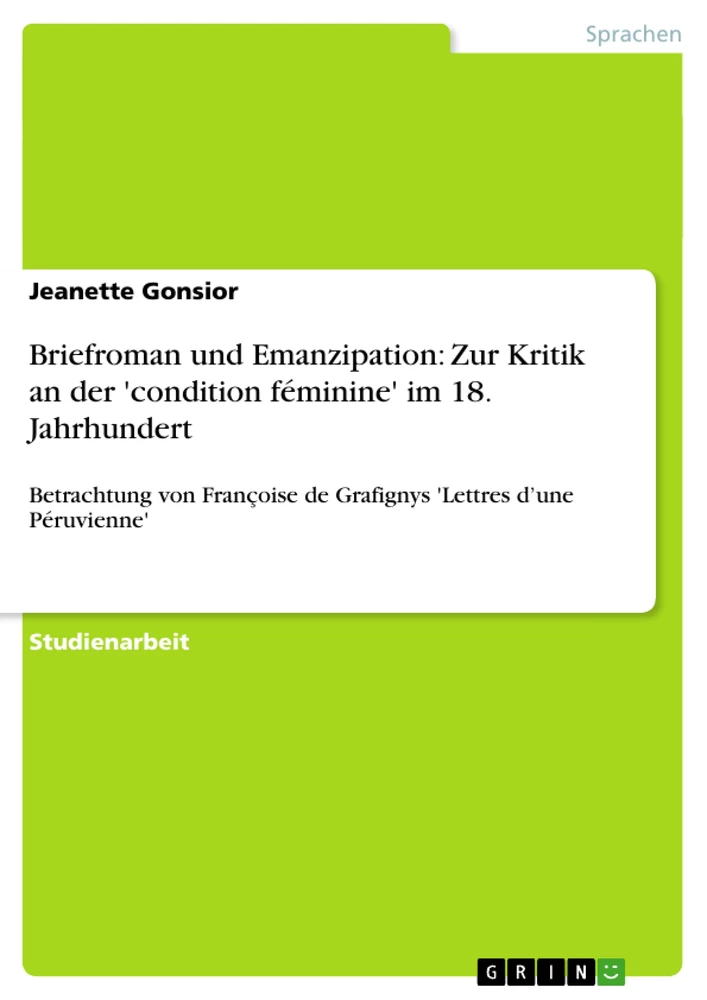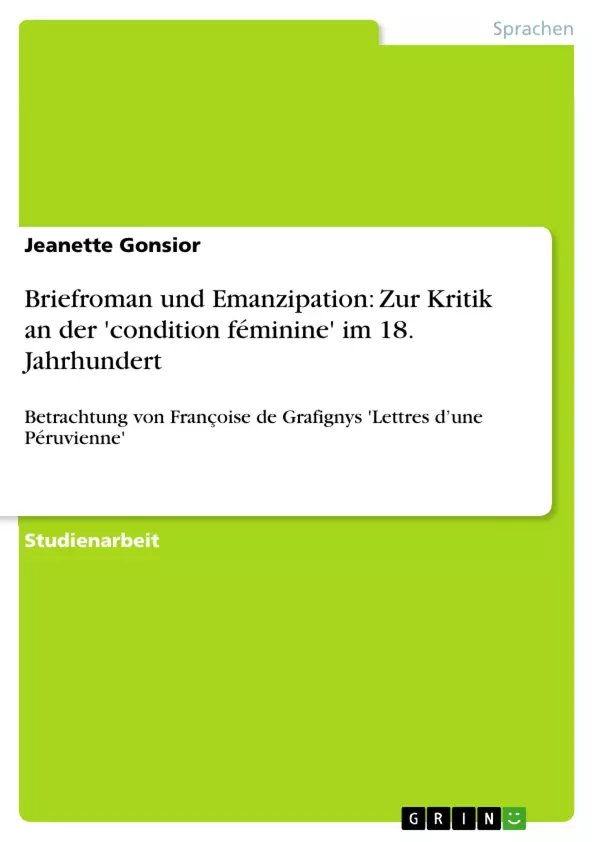Bereits 1789 wurde in der 'Déclaration des droits de l’homme et du citoyen' die rechtliche Gleichstellung der „hommes“ verankert: „Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.“ Allerdings steht „homme“ hier nicht für „Mensch“, sondern für „Mann“. Die französische Revolutionärin/Rechtsphilosophin und Schriftstellerin Olympe de Gouges verfasste 1791 – in Analogie zur ausschließlich für Männer geltenden Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 – die 'Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne'. In dieser „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ forderte sie die völlige Gleichberechtigung der Geschlechter in allen Bereichen des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Am Beispiel Olympe de Gouges’ zeigt sich, dass auch Frauen sich während der Französischen Revolution für ihre Rechte einsetzten.
Die Gleichheit der Frau wurde in Frankreich erst im Jahre 1946 in der „Préambule de la constitution du 27 octubre 1946“ gesetzlich verankert: „La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.“ Bereits hier wird deutlich, wie viel Zeit noch nach der Aufklärung vergehen musste, um eine gesetzlich garantierte Gleichstellung der Frau zu erlangen. (...)
Gerade im 18. Jahrhundert, dem 'siècle des lumières', wurde die Entwicklungsgeschichte der „weiblichen Bildung“ durch zahlreiche Publikationen von pädagogischen Werken beeinflusst. Bereits 15 Jahre vor Veröffentlichung von Jean-Jacques Rousseaus pädagogischem Erziehungsroman 'Émile ou De l’éducation' („Emile oder Über die Erziehung“) im Jahre 1962 formulierte Françoise de Grafigny ihre Gedanken zu Moral, Kultur und Gesellschaft und übte Kritik an der Gesellschaft, an der Eroberung und Vereinnahmung der sogenannten „primitiven“ Völker ('les sauvages') durch weiße Europäer sowie an der gesellschaftlichen Stellung der Frau. Vor diesem Hintergrund soll die Bedeutung von Françoise de Grafignys monologischem Briefroman 'Lettres d’une Péruvienne' betrachtet werden, der 1747 anonym veröffentlicht wurde (1752 erschien eine erweiterte Fassung unter ihrem Namen).
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Kritik der 'Lettres' an der 'condition féminine' im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Zunächst soll die Gattung des Briefomans betrachtet werden (Kapitel 1 und 1.1), um anschließend auf die Bedeutung der 'Lettres d’une Péruvienne' einzugehen (1.2).
In Kapitel 2 soll die Rolle der Frau im 18. Jahrhundert verdeutlicht werden. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Briefroman im 18. Jahrhundert
- Theoretische Betrachtung: Die Gattung des Briefromans
- Bedeutung der Lettres d'une Péruvienne
- Die Rolle der Frau im Frankreich des 18. Jahrhunderts
- Gesellschaftliche Stellung: Mutter und Ehefrau vs. Salonkultur
- Kurzbiographie Françoise de Grafignys
- Zur Kritik an der condition féminine im 18. Jahrhundert - Betrachtung von Grafignys Lettres d'une Péruvienne
- Mangelnde Frauenbildung
- Mädchenerziehung
- Geschlechterbeziehungen: Ehefrau oder Kloster?
- amour-passion
- amitié amoureuse
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Kritik an der gesellschaftlichen Stellung der Frau im Frankreich des 18. Jahrhunderts, anhand von Françoise de Grafignys Lettres d'une Péruvienne. Die Arbeit beleuchtet die Gattung des Briefromans, die Rolle der Frau in dieser Zeit und analysiert die spezifischen Kritikpunkte Grafignys an der "condition féminine".
- Die Gattung des Briefromans im 18. Jahrhundert
- Die gesellschaftliche Stellung der Frau im Frankreich des Ancien Régime
- Françoise de Grafignys Kritik an der mangelnden Frauenbildung und Mädchenerziehung
- Analyse der Darstellung von Geschlechterbeziehungen in den Lettres d'une Péruvienne
- Der Vergleich der Perspektiven von Zilia (der Protagonistin) mit den Forderungen von Olympe de Gouges.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Frauenrechte im Frankreich des 18. Jahrhunderts dar und führt in die Thematik der Hausarbeit ein, wobei die Bedeutung von Olympe de Gouges und ihrer Forderungen hervorgehoben wird. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Lettres d'une Péruvienne von Françoise de Grafigny als Kritik an der "condition féminine".
Kapitel 1: Dieses Kapitel behandelt den Briefroman als literarische Gattung und erläutert die besondere Bedeutung von Grafignys Werk in diesem Kontext.
Kapitel 2: Kapitel 2 beschreibt die Rolle der Frau im 18. Jahrhundert in Frankreich, einschließlich ihrer gesellschaftlichen Stellung und bietet eine kurze Biographie von Françoise de Grafigny.
Kapitel 3: Hier wird die Kritik von Grafigny an der Stellung der Frau im 18. Jahrhundert anhand der Lettres d'une Péruvienne analysiert, fokussiert auf die Themen Frauenbildung, Mädchenerziehung und Geschlechterbeziehungen.
Schlüsselwörter
Briefroman, condition féminine, Françoise de Grafigny, Lettres d'une Péruvienne, Frauenrechte, 18. Jahrhundert, Frankreich, Ancien Régime, Mädchenerziehung, Geschlechterbeziehungen, Olympe de Gouges, Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Lettres d’une Péruvienne"?
Es ist ein Briefroman von Françoise de Grafigny aus dem Jahr 1747, der aus der Sicht einer Inka-Prinzessin die französische Gesellschaft und die Stellung der Frau kritisiert.
Was kritisierte Grafigny an der "condition féminine"?
Sie prangerte die mangelnde Bildung für Frauen, die einengende Mädchenerziehung und die Abhängigkeit in der Ehe an.
Wer war Olympe de Gouges?
Eine Revolutionärin, die 1791 die "Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin" verfasste und die völlige Gleichberechtigung forderte.
Warum war die Gattung des Briefromans im 18. Jahrhundert so beliebt?
Der Briefroman erlaubte eine intime, subjektive Perspektive und eignete sich ideal für moralische und gesellschaftskritische Reflexionen.
Was bedeutet "amitié amoureuse" im Kontext des Romans?
Es beschreibt eine Form der intellektuellen und emotionalen Freundschaft zwischen den Geschlechtern, die eine Alternative zur traditionellen Unterwerfung in der Ehe darstellt.
- Quote paper
- Jeanette Gonsior (Author), 2007, Briefroman und Emanzipation: Zur Kritik an der 'condition féminine' im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122151