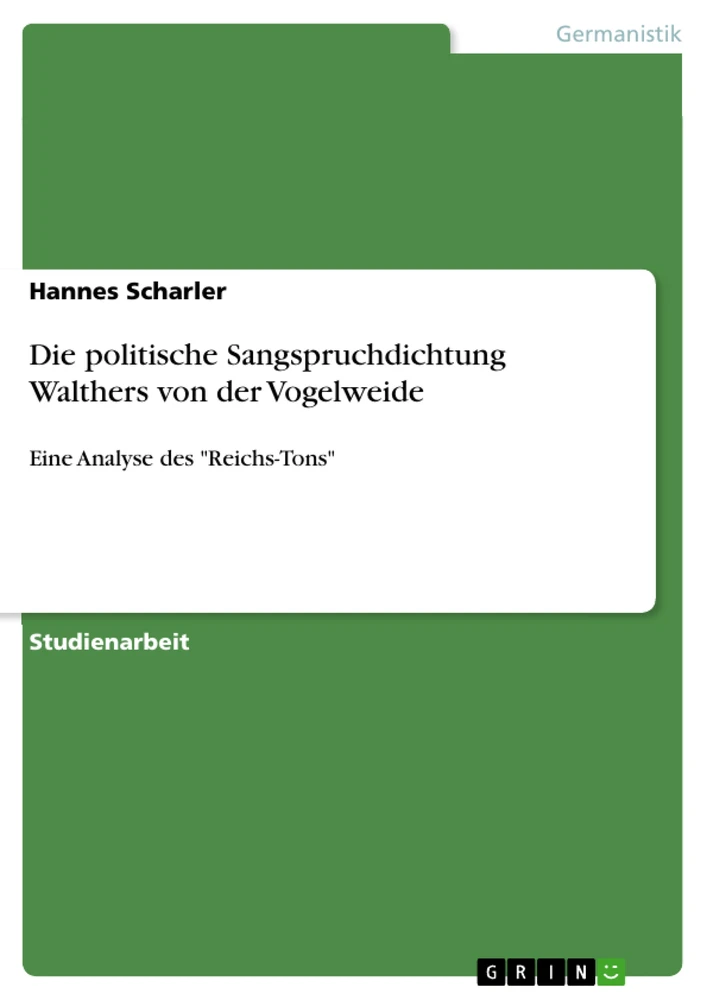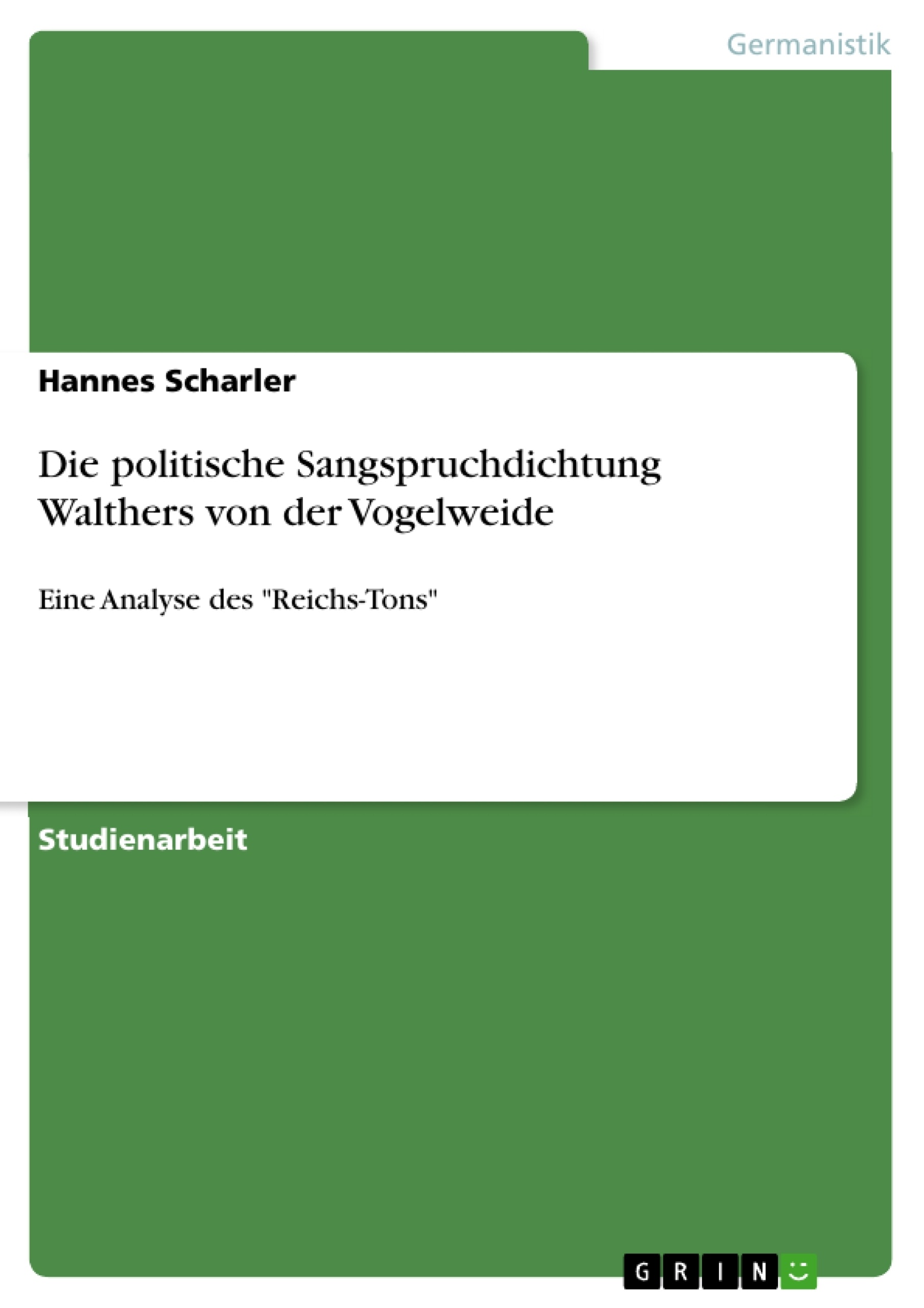Wie äußerte sich politische Kritik im Reichs-Ton Walthers von der Vogelweide und vertrat der Dichter dort eine politische Eigenmeinung? Diese soll durch den Primärtext, der unter Zuhilfenahme von Forschungsliteratur analysiert wird, beantwortet und einem abschließenden Fazit unterzogen werden.
Um Walthers politische Dichtung genauer analysieren zu können, werden zunächst die Charakteristika der mittelhochdeutschen Sangspruchdichtung betrachtet, worauf im folgenden Kapitel die Lebenswelt des Dichters im römisch-deutschen Reich, die sein literarisches Schaffen mitprägte, beleuchtet wird. Dort begann im Jahr 1198 Walthers politische Dichtung mit dem dreistrophigen Reichs-Ton, den der Dichter im Gefolge des Staufers Philipp von Schwaben, dem Bruder des verstorbenen Kaisers Heinrich IV., dichtete. Dieser wird für die Arbeit als Primärtext herangezogen und in Kapitel 4 einer kritischen Analyse hinsichtlich politischer Aussagen unterzogen. Inhaltlich inszeniert der Dichter sein lyrisches Ich im Reichs-Ton als allwissender Seher, der das politische Geschehen im ‚rîche‘ kritisch betrachtet. Dabei leitet er vom Allgemeinen zum Spezifischen hin, denn der einleitenden Reichsklage folgen in den späteren Strophen immer konkretere politische Aussagen. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern eine Auftraggeberschaft oder auch die politische Eigenmeinung des Dichters zum Ausdruck kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Mittelalterliche Sangspruchdichtung
- 2.1 Charakteristika
- 2.2 Walthers politische Sangspruchdichtung
- 3 Walther und die mittelalterliche Lebenswelt
- 3.1 Herkunft und Name
- 3.2 Leben und Wirken
- 3.3 Politische Situation
- 3.4 Papst Innozenz III
- 3.5 Auftragsdichtung oder Eigenaussagen des Dichters
- 4 Politische Kritik in Walthers Reichs-Ton
- 4.1 Hintergrund und Entstehungskontext
- 4.2 Gliederung des Reichs-Tons
- 4.2.1 Reichsklage (L 8,4)
- 4.2.2 Weltklage (L 8,28)
- 4.2.3 Kirchenklage (L 9,16)
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der politischen Sangspruchdichtung Walthers von der Vogelweide und analysiert den "Reichs-Ton" als Primärtext. Ziel ist es, die politische Kritik in diesem Werk zu untersuchen und zu ergründen, ob Walther eine politische Eigenmeinung vertritt.
- Die Charakteristika der mittelalterlichen Sangspruchdichtung
- Walthers Leben und Wirken im römisch-deutschen Reich
- Die politische Situation im 12. Jahrhundert
- Die politische Kritik im "Reichs-Ton" Walthers von der Vogelweide
- Die Frage nach Auftragsdichtung oder der politischen Eigenmeinung des Dichters
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der politischen Sangspruchdichtung Walthers von der Vogelweide ein und stellt den "Reichs-Ton" als Primärtext vor. Kapitel 2 analysiert die Charakteristika der Sangspruchdichtung im Mittelalter und beleuchtet die spezifischen Eigenschaften von Walthers politischer Lyrik. Kapitel 3 beleuchtet Walthers Lebenswelt im römisch-deutschen Reich und die politische Situation, die sein literarisches Schaffen prägten. Kapitel 4 befasst sich mit der politischen Kritik im "Reichs-Ton" und untersucht die Hintergründe, Entstehungskontext und Gliederung des Textes.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die politische Sangspruchdichtung Walthers von der Vogelweide, den "Reichs-Ton", die mittelalterliche Lebenswelt, die politische Situation im 12. Jahrhundert, Auftragsdichtung, politische Kritik, politische Eigenmeinung, Kirchenklage, Weltklage und Reichsklage.
- Quote paper
- Hannes Scharler (Author), 2022, Die politische Sangspruchdichtung Walthers von der Vogelweide, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1225303