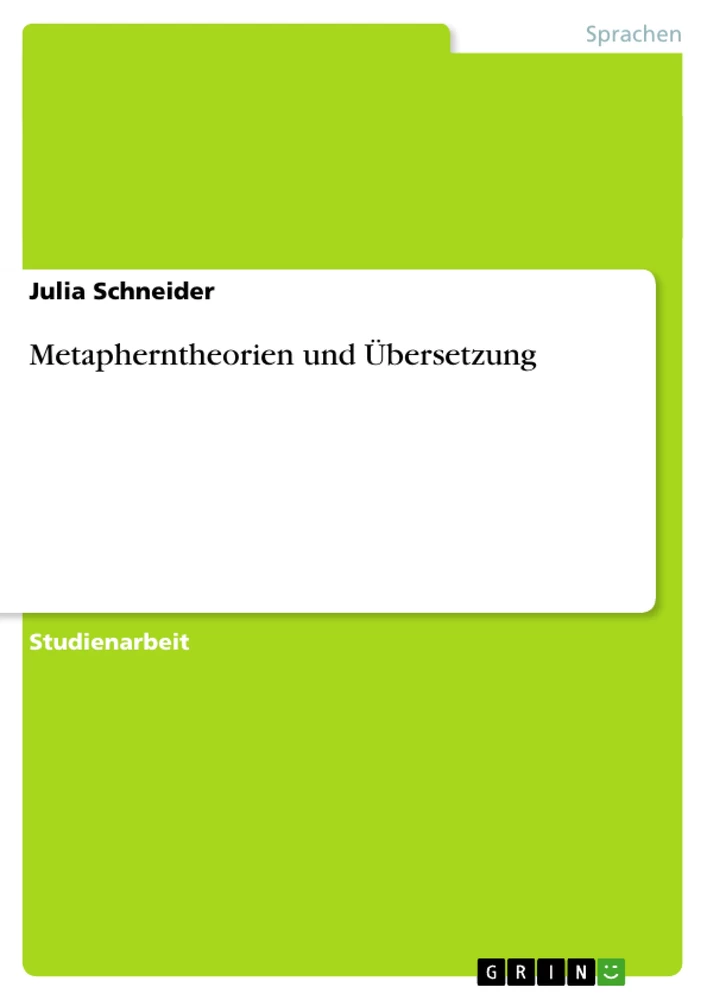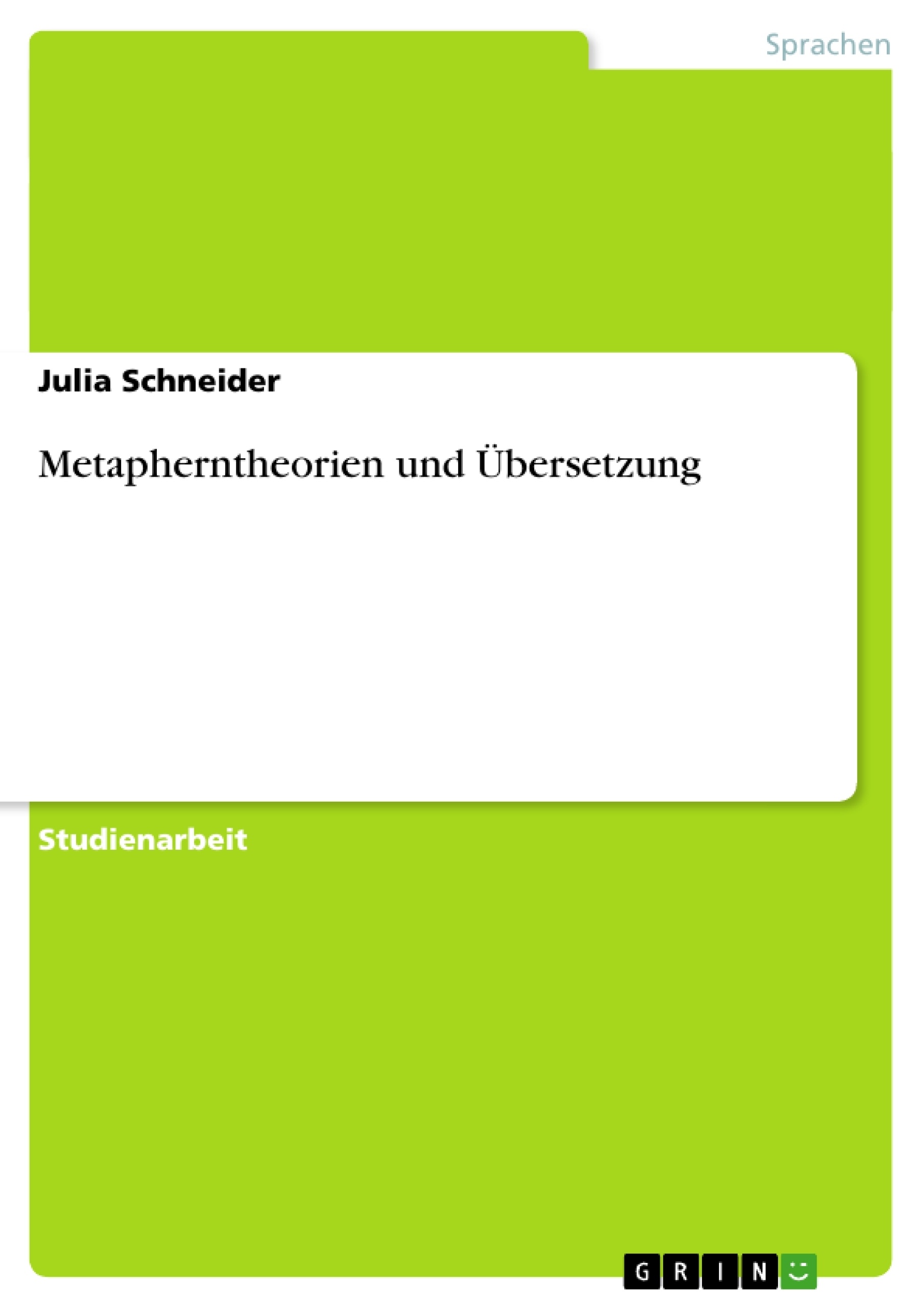„Wer auch immer kommuniziert, verwendet Metaphern, meistens unbemerkt, stillschweigend und ohne ihnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir bringen einem anderen etwas nahe, stehen auf Standpunkten, ziehen uns zurück, sind wahnsinnig vor Glück, fühlen uns von Bemerkungen anderer zutiefst getroffen oder dringen tief in andere ein. Manchmal trifft, was wir sagen, ins Schwarze, manchmal geht es daneben. Wir knüpfen Kontaktfäden und verstricken uns dabei, und wenn wir auf andere zugehen, kommt es zu Berührungen – oder nicht. Manchmal funkt es sogar.“ Ich beginne meine Hauptseminararbeit zum Thema „Metapherntheorien und Übersetzung“ mit diesem Zitat, da es mir beim Einlesen in die Literatur sehr gefallen hat und mir im Hinblick auf die Definition der Metapher die Augen geöffnet hat. Es stammt aus dem Vorwort zur deutschen Übersetzung des Buches „Metaphors we live by“, mit dem George Lakoff und Mark Johnson Anfang der achtziger Jahre die kognitive Wende in der Semantik einleiteten und eine ganz neue Sichtweise auf den Begriff der Metapher begründeten. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, wie sehr unser tägliches Leben durch Metaphern geprägt ist und dass die Metapher in ihrer Definition als bildhafter Ausdruck nicht nur als ausschmückendes Stilmittel dient. Das aus der kognitiven Linguistik hervorgegangene Metaphernverständnis ist jedoch nur eine der vielen verschiedenen Metapherntheorien, die sich seit der Antike entwickelt haben. Im ersten Teil meiner Arbeit stelle ich die wichtigsten Metapherntheorien vor. Dazu gehören neben dem soeben erwähnten kognitiven Metaphernverständnis, die Interaktionstheorie und die Bildfeldtheorie aus der modernen Semantik sowie die Substitutions- und Vergleichstheorie aus der Antike, die noch heute eine große Rolle spielen. Danach gehe ich auf die Stellung der Metaphorik in der übersetzungs-wissenschaftlichen Diskussion ein und skizziere die verschiedenen Typen von Metaphern. Im letzten Teil meiner Hauptseminararbeit erläutere ich die Übersetzungsproblematik und weise mögliche Strategien im Umgang mit Metaphern auf.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Metapherntheorien
- 1.1 Das klassische Metaphernverständnis
- 1.1.1 Substitutionstheorie
- 1.1.2 Vergleichstheorie
- 1.2 Das moderne Metaphernverständnis
- 1.2.1 Interaktionstheorie
- 1.2.2 Bildfeldtheorie nach Weinrich
- 1.2.3 Kognitive Metapherntheorie
- 1.1 Das klassische Metaphernverständnis
- 2 Die Metaphorik in der Übersetzungswissenschaft
- 3 Metaphertypen
- 4 Übersetzbarkeit
- 5 Übersetzungsverfahren
- 5.1 Eins-zu-Eins-Übertragung
- 5.2 Substitution
- 5.3 Paraphrasierung
- 6 Schlussbetrachtung
- 7 Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Metapherntheorien und deren Relevanz für die Übersetzungswissenschaft. Sie beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze zur Beschreibung von Metaphern, von der Antike bis zur modernen kognitiven Linguistik. Das Ziel ist es, ein Verständnis für die Komplexität des Umgangs mit Metaphern in Übersetzungsprozessen zu entwickeln.
- Entwicklung und Vergleich verschiedener Metapherntheorien (klassisch und modern)
- Die Rolle der Metaphorik in der Übersetzungswissenschaft
- Klassifizierung von Metaphertypen
- Herausforderungen der Übersetzbarkeit von Metaphern
- Strategien und Verfahren der Übersetzung metaphorischer Ausdrücke
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat, das die allgegenwärtige, oft unbemerkte Verwendung von Metaphern im Alltag hervorhebt. Sie führt in das Thema „Metapherntheorien und Übersetzung“ ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Metaphern, die über reine Stilmittel hinausgehen und tiefgreifend unsere Denk- und Kommunikationsweisen prägen. Die Arbeit wird die verschiedenen Metapherntheorien vorstellen und deren Relevanz für die Übersetzungswissenschaft beleuchten.
1 Metapherntheorien: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Metapherntheorien, wobei zwischen klassischen und modernen Ansätzen unterschieden wird. Es analysiert die Substitutionstheorie und die Vergleichstheorie als klassische Ansätze, die auf Aristoteles zurückgehen und die Metapher als Wort- oder Bedeutungsübertragung verstehen. Die modernen Ansätze, wie die Interaktionstheorie, die Bildfeldtheorie und die kognitive Metapherntheorie, werden in ihrer Differenzierung zu den klassischen Theorien dargestellt und ihre jeweiligen Perspektiven auf den Metapherbegriff beleuchtet.
2 Die Metaphorik in der Übersetzungswissenschaft: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung der Metaphorik innerhalb der Übersetzungswissenschaft. Es diskutiert die Herausforderungen, die die Übersetzung von Metaphern mit sich bringt und analysiert, wie Metaphern in der Übersetzungstheorie betrachtet und behandelt werden. Es legt den Grundstein für die weiteren Kapitel, die sich mit den konkreten Aspekten der Übersetzbarkeit und den verschiedenen Übersetzungsverfahren auseinandersetzen.
3 Metaphertypen: Das Kapitel beschreibt verschiedene Kategorien von Metaphern, um die Vielfältigkeit metaphorischer Ausdrücke zu veranschaulichen und ein detaillierteres Verständnis für ihre Eigenschaften und Funktionen zu schaffen. Dies bildet die Grundlage für die spätere Betrachtung der Übersetzbarkeit und der Auswahl geeigneter Übersetzungsverfahren.
4 Übersetzbarkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Frage der Übersetzbarkeit von Metaphern. Es analysiert die Schwierigkeiten, die sich bei der Übersetzung metaphorischer Ausdrücke ergeben, und erörtert die Faktoren, die die Übersetzbarkeit beeinflussen. Dabei werden unterschiedliche Aspekte wie kulturelle Kontexte und die spezifischen Eigenschaften der Metapher selbst berücksichtigt.
5 Übersetzungsverfahren: Hier werden verschiedene Strategien und Verfahren zur Übersetzung von Metaphern vorgestellt und analysiert. Das Kapitel vergleicht unter anderem die Eins-zu-Eins-Übertragung, die Substitution und die Paraphrasierung als mögliche Lösungsansätze für die Übersetzung metaphorischer Ausdrücke. Die jeweilige Eignung der Verfahren in Abhängigkeit von Kontext und Metaphertyp wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Metapherntheorien, Übersetzungswissenschaft, kognitive Linguistik, Aristoteles, Substitutionstheorie, Vergleichstheorie, Interaktionstheorie, Bildfeldtheorie, Übersetzbarkeit, Übersetzungsverfahren, kulturelle Unterschiede.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Metapherntheorien und Übersetzung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Metapherntheorien und ihre Bedeutung für die Übersetzungswissenschaft. Sie analysiert klassische und moderne Ansätze der Metapherntheorie und deren Anwendung auf die Herausforderungen der Übersetzung metaphorischer Ausdrücke.
Welche Metapherntheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl klassische Metapherntheorien (Substitutionstheorie, Vergleichstheorie) als auch moderne Ansätze (Interaktionstheorie, Bildfeldtheorie nach Weinrich, kognitive Metapherntheorie). Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Theorien werden verglichen und analysiert.
Welche Aspekte der Übersetzungswissenschaft werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die die Übersetzung von Metaphern mit sich bringt. Sie untersucht, wie Metaphern in der Übersetzungstheorie betrachtet werden und analysiert die Übersetzbarkeit von Metaphern unter Berücksichtigung kultureller Kontexte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Metapherntheorien, Die Metaphorik in der Übersetzungswissenschaft, Metaphertypen, Übersetzbarkeit, Übersetzungsverfahren und Schlussbetrachtung. Zusätzlich enthält sie ein Literaturverzeichnis.
Welche Übersetzungsverfahren werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert und vergleicht verschiedene Übersetzungsverfahren für Metaphern, darunter die Eins-zu-Eins-Übertragung, die Substitution und die Paraphrasierung. Die Eignung der jeweiligen Verfahren in Abhängigkeit vom Kontext und Metaphertyp wird diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Metapherntheorien, Übersetzungswissenschaft, kognitive Linguistik, Aristoteles, Substitutionstheorie, Vergleichstheorie, Interaktionstheorie, Bildfeldtheorie, Übersetzbarkeit, Übersetzungsverfahren, kulturelle Unterschiede.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Komplexität des Umgangs mit Metaphern in Übersetzungsprozessen zu entwickeln. Sie vergleicht verschiedene theoretische Ansätze und analysiert die Herausforderungen und Strategien der Übersetzung metaphorischer Ausdrücke.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Die Arbeit bietet für jedes Kapitel eine detaillierte Zusammenfassung, die den Inhalt und die Kernaussagen jedes Abschnitts prägnant darstellt. Dies ermöglicht einen schnellen Überblick über den Aufbau und den thematischen Fokus der gesamten Arbeit.
Wie wird die Übersetzbarkeit von Metaphern behandelt?
Das Kapitel "Übersetzbarkeit" widmet sich der zentralen Frage, inwieweit sich Metaphern überhaupt übersetzen lassen. Es analysiert die Schwierigkeiten und Faktoren, die die Übersetzbarkeit beeinflussen, wie z.B. kulturelle Kontexte und die spezifischen Eigenschaften der Metapher.
Welche Rolle spielt die kognitive Linguistik?
Die kognitive Linguistik spielt eine wichtige Rolle, indem sie moderne Metapherntheorien wie die kognitive Metapherntheorie liefert, die den Metapherbegriff aus einer kognitiven Perspektive beleuchtet und somit einen wichtigen Beitrag zur Übersetzungstheorie leistet.
- Arbeit zitieren
- Stud. phil. Julia Schneider (Autor:in), 2007, Metapherntheorien und Übersetzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122922