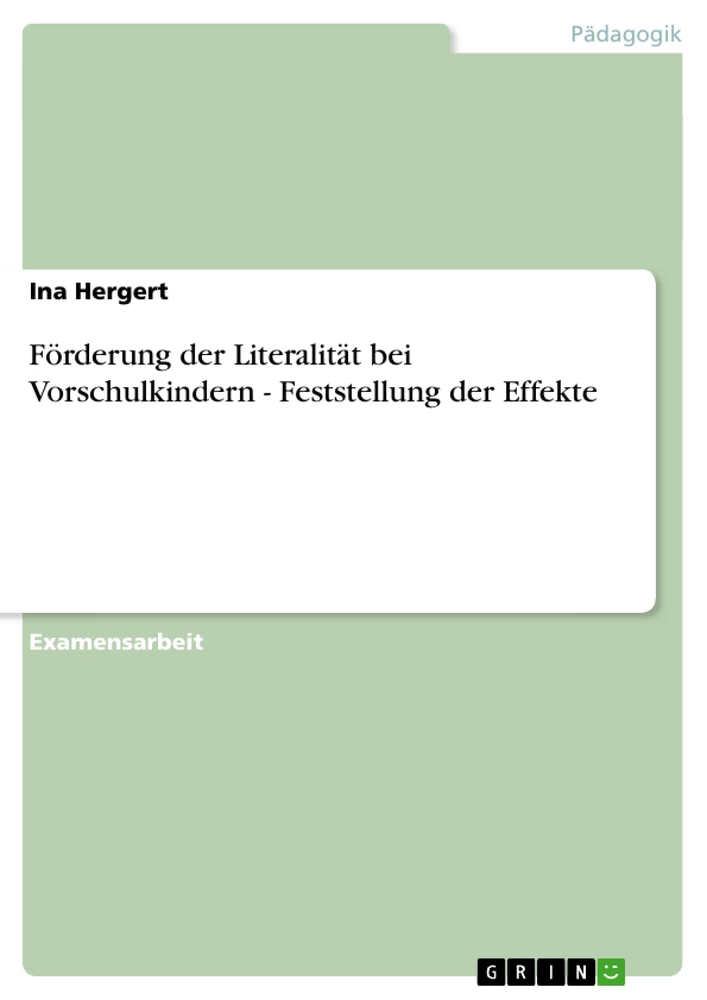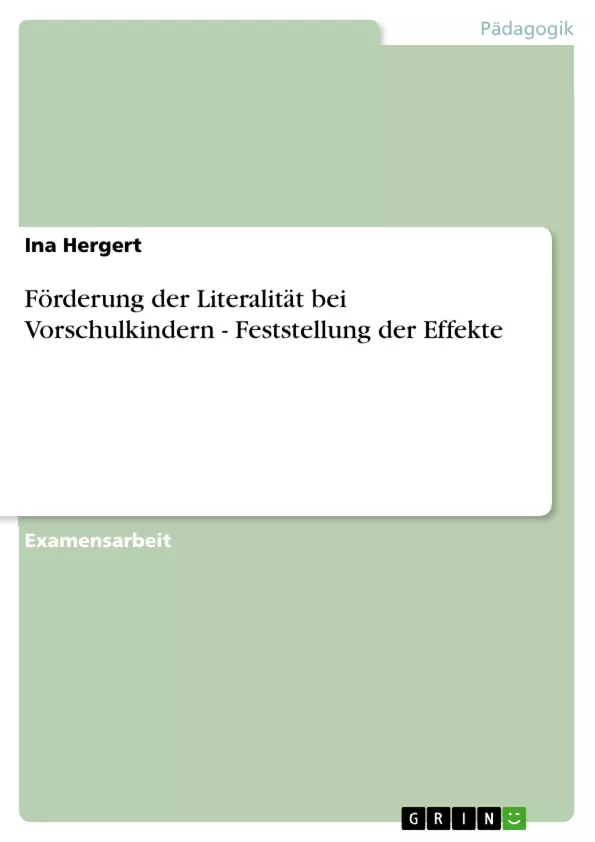Vor einigen Jahren lautete eine Schlagzeile in der Zeit: „Das deutsche Bildungssystem hat versagt: Es ist ungerecht und produziert Mittelmaß.“ (Fahrholz, Gabriel, Müller, 2002).
Die Medien berichteten Tage lang über die internationale Schulstudie PISA. Der Befund von PISA schlug wie eine Bombe in die bildungspolitische Landschaft ein: Die Lesekompetenz von 23% der 15- jährigen Schüler in Deutschland gab Anlass zur Besorgnis. Die geringe Lesebereitschaft und Leselust der Schüler sind Gründe für dieses schlechte Ergebnis. „Dieser Schock war sozusagen ein Weckruf an uns alle.“ (Fahrholz, Gabriel, Müller, 2002).
Experten kamen zu dem Schluss, dass vor allem die Förderung von Kindern im Vor- und Grundschulbereich dringend verbessert und ausgebaut werden muss. Denn wenn man Vorschulkinder eines Jahrgangs betrachtet, kann man feststellen, dass die Entwicklungsschere bei Kindern gleichen Alters immer mehr auseinanderklafft.
Ein entscheidender Schlüssel zum Erwerb bzw. Nicht-Erwerb bedeutsamer Spracherfahrungen und Sprachleistungen, wie auch zu der damit zusammenhängenden Lesekompetenz liegt in der frühen Kindheit (vgl. Roux, 2005, S.3).
Im Schulalltag ist aber oft zu wenig Zeit oder es mangelt an engagierten Lehrern, sodass die Voraussetzungen der Schüler nicht ermittelt werden können. So können Schüler schon bald Probleme bekommen, die man mit Hilfe einer Frühförderung hätte verringern oder beseitigen können.
In jedem Falle sollte eine Präventionsdiagnostik einer Sprachförderung vorangehen. Eine für das letzte Kindergartenjahr oder das erste Schuljahr geeignete Präventionsdiagnostik ist die Fitness-Probe, bei der in verschiedenen Bereichen Schwächen und Stärken der Kinder ermittelt werden können. Passend dazu gibt es ein Konzept mit unterschiedlichen Förderbausteinen die eine gezielte Förderung ermöglichen.
Der erste Teil meiner Arbeit wird sich mich mit der Theorie der Sprachförderung auseinandersetzen und in dem darauf folgenden Teil wird von den Erfahrungen mit der Fitness-Probe und den Förderbausteinen berichtet.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I Theoretischer Teil
- 1 Sprache
- 1.1 Was ist Sprache?
- 1.2 Die Sprachstruktur
- 1.3 Unterscheidung zwischen Sprache und Sprechen
- 2 Kommunikation
- 2.1 Was ist Kommunikation?
- 2.2 Kommunikationsablauf
- 2.3 Stufen der Kommunikation
- 2.3.1 Körpersprache
- 2.3.2 Lautsprache
- 2.3.3 Schriftsprache
- 2.3.4 Rechnersprache
- 3 Erstspracherwerb
- 3.1 Theoretische Erklärungsversuche
- 3.1.1 Behaviorismus
- 3.1.2 Nativismus
- 3.1.3 Kognitivismus
- 3.1.4 Interaktionismus
- 3.2 Voraussetzungen des Erstspracherwerbs
- 3.2.1 Hörvermögen
- 3.2.2 Sprechwerkzeuge
- 3.2.3 Hirnreifung
- 3.2.4 Motivationale Faktoren
- 3.2.5 Familiäre Lebensbedingungen
- 3.3 Entwicklungsphasen
- 3.1 Theoretische Erklärungsversuche
- 4 Zweitspracherwerb
- 4.1 Theorien zum Zweitspracherwerb
- 4.1.1 Identitätshypothese
- 4.1.2 Transfer-Hypothese
- 4.1.3 Interlanguage-Hypothese
- 4.1.4 Monitor-Hypothese
- 4.1.5 Pidgin-Hypothese
- 4.2 Bedingungen des Zweitspracherwerbs
- 4.2.1 Allgemeine Entwicklung des Kindes
- 4.2.2 Bisherige Erfahrungen
- 4.2.3 Eigenarten der deutschen Sprache
- 4.2.4 Fehlerschwerpunkte ausländischer Kinder
- 4.2.5 Erstsprache
- 4.1 Theorien zum Zweitspracherwerb
- 5 Sprachförderung
- 5.1 Förderung der Erstsprache
- 5.1.1 Sprachförderkonzepte
- 5.1.2 Prinzipien der Förderung
- 5.2 Förderung beim Erwerb der Zweitsprache
- 5.2.1 Förderkonzepte
- 5.2.2 Förderschwerpunkte
- 5.1 Förderung der Erstsprache
- 6 Literalität
- 6.1 Was ist Literalität?
- 6.2 Wie entsteht Literalität?
- 6.3 Stufen der Literalität
- 6.4 Wie kann man Literalität fördern?
- 1 Sprache
- II Praktischer Teil
- 7 Vorstellung der Kindertagesstätte
- 7.1 Das letzte Jahr im Kindergarten
- 7.2 Elternarbeit
- 7.3 Kontaktaufnahme mit der Kindertagesstätte und den Eltern
- 7.4 Beschreibung des Förderraumes
- 8 Beschreibung der Fitnessprobe
- 8.1 Allgemeines
- 8.2 Beobachtungsaspekte und Aufgaben
- 8.2.1 Beobachtungsaspekt 1: Sprachgedächtnis
- 8.2.2 Beobachtungsaspekt 2: Auditive Wahrnehmung
- 8.2.3 Beobachtungsaspekt 3: Sprachverstehen
- 8.2.4 Beobachtungsaspekt 4: Malen/Schreiben
- 8.2.5 Beobachtungsaspekt 5: Aussprache einzelner Wörter
- 8.2.6 Beobachtungsaspekt 6: Konstruieren von Sätzen
- 8.2.7 Beobachtungsaspekt 7: Sprachbewusstsein und Phonologische Bewusstheit
- 8.3 Durchführung der Fitness-Probe
- 9 Beschreibung der Kinder und Ergebnisse des Eingangstestes
- 9.1 Beschreibung und Ergebnisse des Eingangstestes der Fördergruppe
- 9.1.1 Athieshan
- 9.1.2 Darius
- 9.1.3 Mert
- 9.1.4 Timon
- 9.1.5 Jathu
- 9.2 Beschreibung und Ergebnisse des Eingangstestes der Kontrollgruppe
- 9.2.1 Anna
- 9.2.2 Marcel
- 9.2.3 Sanchi
- 9.2.4 Lennart
- 9.2.5 Ansgar
- 9.3 Vergleich der Ergebnisse des Einganstestes der Fördergruppe und der Kontrollgruppe
- 9.1 Beschreibung und Ergebnisse des Eingangstestes der Fördergruppe
- 10 Die Förderung
- 10.1 Fördertermine
- 10.2 Fördereinheiten
- 10.2.1 Erste Fördereinheit
- 10.2.2 Zweite Fördereinheit
- 10.2.3 Dritte Fördereinheit
- 10.2.4 Vierte Fördereinheit
- 10.2.5 Fünfte Fördereinheit
- 10.2.6 Sechste Fördereinheit
- 10.2.7 Siebte Fördereinheit
- 10.2.8 Achte Fördereinheit
- 10.2.9 Neunte Fördereinheit
- 10.2.10 Zehnte Fördereinheit
- 10.2.11 Elfte Fördereinheit
- 10.2.12 Zwölfte Fördereinheit
- 11 Ergebnisse des Abschlusstestes
- 11.1 Ergebnisse des Abschlusstestes der Fördergruppe
- 11.1.1 Athieshan
- 11.1.2 Darius
- 11.1.3 Mert
- 11.1.4 Timon
- 11.1.5 Jathu
- 11.2 Ergebnisse des Abschlusstestes der Kontrollgruppe
- 11.2.1 Anna
- 11.2.2 Marcel
- 11.2.3 Sanchi
- 11.2.4 Lennart
- 11.2.5 Ansgar
- 11.3 Vergleich der Ergebnisse des Abschlusstestes der Fördergruppe und der Kontrollgruppe
- 11.1 Ergebnisse des Abschlusstestes der Fördergruppe
- 12 Auswertung
- 12.1 Auswertungen der Ergebnisse der Fördergruppe
- 12.1.1 Athieshan
- 12.1.2 Darius
- 12.1.3 Mert
- 12.1.4 Timon
- 12.1.5 Jathu
- 12.2 Auswertungen der Ergebnisse der Kontrollgruppe
- 12.3 Prozentualer Vergleich der Fördergruppe und der Kontrollgruppe
- 12.1 Auswertungen der Ergebnisse der Fördergruppe
- 13 Elternnachmittag
- Schlusswort
- 7 Vorstellung der Kindertagesstätte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirksamkeit eines Sprachförderungsprogramms bei Vorschulkindern. Ziel ist es, die Effekte einer gezielten Förderung auf die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder zu analysieren und zu evaluieren.
- Förderung der Literalität bei Vorschulkindern
- Entwicklungsphasen des Erst- und Zweitspracherwerbs
- Effektivität verschiedener Sprachfördermethoden
- Analyse der sprachlichen Fähigkeiten von Kindern mit und ohne Förderprogramm
- Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Elternhaus
Zusammenfassung der Kapitel
Der theoretische Teil behandelt den Spracherwerb, die Kommunikation und verschiedene Sprachförderkonzepte. Der praktische Teil beschreibt die Durchführung einer empirischen Studie in einer Kindertagesstätte, einschließlich der verwendeten Fitness-Probe, der Beschreibung der teilnehmenden Kinder, und der detaillierten Darstellung der einzelnen Fördereinheiten. Die Auswertung der Ergebnisse des Eingangs- und Abschlusstests wird ebenfalls präsentiert.
Schlüsselwörter
Sprachförderung, Literalität, Vorschulkinder, Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Fitness-Probe, empirische Studie, Sprachentwicklung, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Sprachförderung im Vorschulalter so wichtig?
Die frühe Kindheit ist der Schlüssel zum Erwerb von Lesekompetenz. Versäumnisse in dieser Phase führen oft zu dauerhaften Bildungsschwächen, wie die PISA-Studie zeigte.
Was ist die „Fitness-Probe“ für Vorschulkinder?
Die Fitness-Probe ist ein diagnostisches Instrument, das Bereiche wie Sprachgedächtnis, auditive Wahrnehmung und phonologische Bewusstheit prüft, um Förderbedarf zu ermitteln.
Was versteht man unter Literalität?
Literalität umfasst mehr als nur Lesen und Schreiben; es bezeichnet die allgemeine Vertrautheit mit der Schriftsprache und die Fähigkeit, Informationen daraus zu nutzen.
Wie unterscheiden sich Erst- und Zweitspracherwerb?
Während der Erstspracherwerb meist intuitiv erfolgt, unterliegt der Zweitspracherwerb (z.B. bei Migrationshintergrund) spezifischen Bedingungen und Fehlerschwerpunkten.
Welche Rolle spielen die Eltern bei der Sprachförderung?
Die Elternarbeit ist essenziell, da familiäre Lebensbedingungen und motivationale Faktoren den Spracherwerb maßgeblich beeinflussen.
- Quote paper
- Ina Hergert (Author), 2008, Förderung der Literalität bei Vorschulkindern - Feststellung der Effekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122958