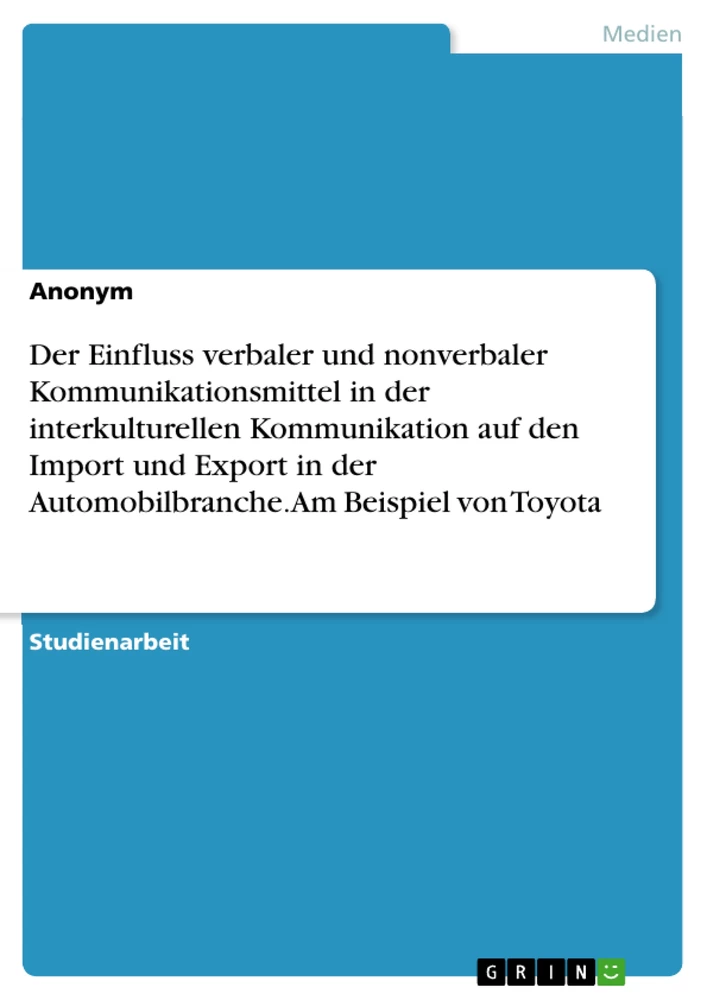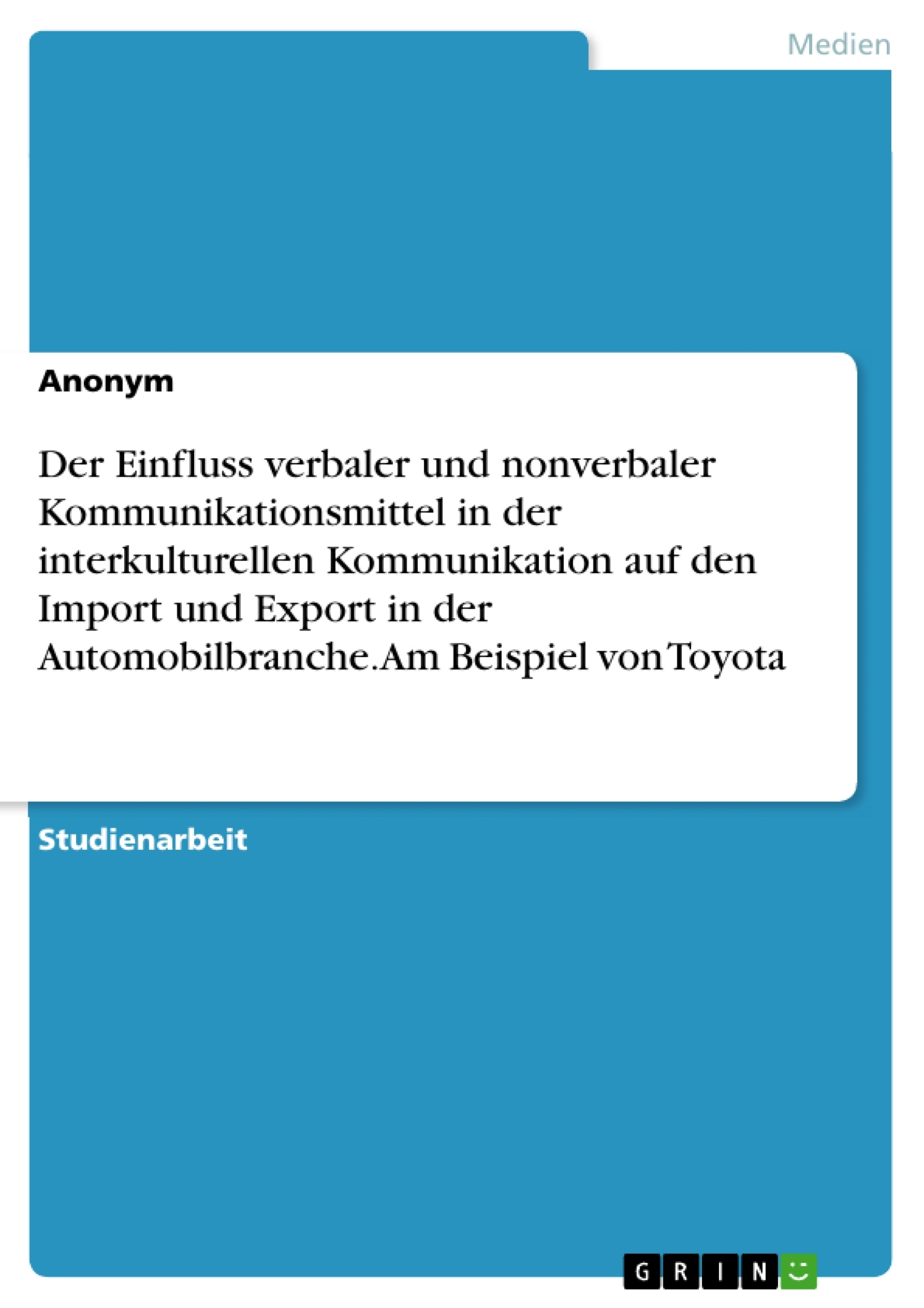Ziel dieser Arbeit ist es, zu bewerten, inwieweit die verbalen und nonverbalen Kommunikationsmittel in der interkulturellen Kommunikation Einfluss auf den Import und Export in der Automobilbranche zu nehmen. Dies wird am Beispiel von Toyota gezeigt.
Sucht man in Büchern oder im World Wide Web nach dem Thema "Interkulturelle Kommunikation", wird es normalerweise als Kommunikation zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen beschrieben oder definiert. Gerade der Begriff Kultur hat unterschiedlichste Definitionen und wird kontextual auf verschiedenste Weise verwendet. Eine Einigung auf eine allgemeine Definition ist bis heute nicht erfolgt. Allein im Duden wird "Kultur" mit fünf Bedeutungen definiert. Es stellt sich jedoch schnell die Frage, was interkulturelle Kommunikation wirklich definiert. Insbesondere derzeit, da der Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen immer wichtiger und selbstverständlicher wird, steigt die Zahl von Begegnungen mit Personen aus anderen Kulturen im Studium, im persönlichen Alltag und in der Geschäftswelt, hierin auch in der Automobilbranche, rapide.
Um eine Einführung in das Thema zu geben, wird zu Beginn dieser wissenschaftlichen Arbeit die Terminologie der allgemeinen Kommunikation nach Friedemann Schulz von Thun erörtert und nachfolgend verwendet. Im Besonderen sind die Formen der kulturinternen verbalen, nonverbalen und paraverbalen Kommunikation zu untersuchen. Nachfolgend wird der Einfluss der interkulturellen Kommunikation auf den Import und Export und die Relevanz für die Automobilbranche beleuchtet. Auf die daraus entstehenden Kommunikationsprobleme in der Wirtschaft zwischen Deutschland und Japan wird eingegangen. Im letzten Kapitel wird die Beeinflussung durch interkulturelle Kommunikation auf den Import und Export in der Automobilbranche mit Hilfe des Beispiels Toyota bewertet und zusammengefasst. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Kommunikation anhand verbaler und nonverbaler Kommunikationsmittel mit Bezug auf die interkulturelle Kommunikation
- 2.1. Unterschiede verbaler, nonverbaler und paraverbaler Kommunikationsmittel
- 2.2. Kulturelle Eigenheiten verbaler, nonverbaler und paraverbaler Kommunikationsmittel
- 2.3. Konkrete Eigenheiten verbaler, nonverbaler und paraverbaler Kommunikation Japans
- 3. Einfluss der interkulturellen Kommunikation auf den Import und Export in der Automobilbranche
- 3.1. Relevanz der interkulturellen Kommunikation in der Automobilbranche
- 3.2. Kommunikationsprobleme zwischen Deutschland und Japan in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
- 4. Bewertung des Einflusses der interkulturellen Kommunikation auf den Import und Export in der Automobilbranche am Beispiel von Toyota
- 4.1. Eine Bewertung des Einflusses der interkulturellen Kommunikation in Bezug auf die Allgemeinheit
- 4.2. Eine Bewertung des Einflusses der interkulturellen Kommunikation zwischen Deutschland und Japan
- 4.3. Eine Bewertung des Einflusses der interkulturellen Kommunikation auf den Import und Export in der Automobilbranche
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Einfluss verbaler und nonverbaler Kommunikationsmittel in der interkulturellen Kommunikation auf den Import und Export in der Automobilbranche zwischen Deutschland und Japan, am Beispiel von Toyota. Das Ziel ist es, die Bedeutung interkultureller Kompetenz für den wirtschaftlichen Erfolg in diesem Kontext zu bewerten.
- Der Einfluss verbaler und nonverbaler Kommunikation auf den internationalen Handel
- Kulturelle Unterschiede in der Kommunikation zwischen Deutschland und Japan
- Herausforderungen und Chancen interkultureller Kommunikation in der Automobilbranche
- Fallstudie Toyota: Analyse der Kommunikationsstrategien und deren Auswirkungen
- Bewertung des Einflusses der interkulturellen Kommunikation auf den wirtschaftlichen Erfolg
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der interkulturellen Kommunikation ein und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet die Vielschichtigkeit des Begriffs "Kultur" und die steigende Bedeutung interkultureller Kompetenz im Kontext der Globalisierung, insbesondere in der Automobilbranche. Die Arbeit fokussiert auf die Bewertung des Einflusses verbaler und nonverbaler Kommunikationsmittel auf Import und Export, anhand des Beispiels Toyota.
2. Allgemeine Kommunikation anhand verbaler und nonverbaler Kommunikationsmittel mit Bezug auf die interkulturelle Kommunikation: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Kommunikation nach Friedemann Schulz von Thun dar und differenziert zwischen verbalen, nonverbalen und paraverbalen Kommunikationsmitteln. Es analysiert die kulturellen Eigenheiten dieser Kommunikationsformen und beleuchtet spezifische Aspekte der japanischen Kommunikationskultur. Dies schafft ein fundiertes Verständnis für die Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation.
3. Einfluss der interkulturellen Kommunikation auf den Import und Export in der Automobilbranche: Dieses Kapitel untersucht die besondere Relevanz von interkultureller Kommunikation innerhalb der globalisierten Automobilbranche. Es analysiert potentielle Kommunikationsprobleme im deutsch-japanischen Wirtschaftsaustausch, die durch kulturelle Unterschiede entstehen können. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen dieser Kommunikationsprobleme auf Import- und Exportaktivitäten.
4. Bewertung des Einflusses der interkulturellen Kommunikation auf den Import und Export in der Automobilbranche am Beispiel von Toyota: Dieses Kapitel stellt eine Fallstudie über Toyota dar, um die theoretischen Überlegungen praktisch zu veranschaulichen. Es analysiert die Kommunikationsstrategien von Toyota im Kontext der interkulturellen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan, bewertet deren Einfluss auf den Import und Export, und zieht daraus Schlussfolgerungen für den Umgang mit interkulturellen Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, verbale Kommunikation, nonverbale Kommunikation, Automobilbranche, Deutschland, Japan, Toyota, Import, Export, Wirtschaftsbeziehungen, kulturelle Unterschiede, Kommunikationsprobleme, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Arbeit: Interkulturelle Kommunikation in der Automobilbranche
Was ist das Thema der wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss verbaler und nonverbaler Kommunikationsmittel in der interkulturellen Kommunikation auf den Import und Export in der Automobilbranche zwischen Deutschland und Japan, am Beispiel von Toyota. Das Ziel ist die Bewertung der Bedeutung interkultureller Kompetenz für den wirtschaftlichen Erfolg in diesem Kontext.
Welche Aspekte der interkulturellen Kommunikation werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Unterschiede zwischen verbaler, nonverbaler und paraverbaler Kommunikation, kulturelle Eigenheiten dieser Kommunikationsformen (insbesondere im japanischen Kontext), potentielle Kommunikationsprobleme im deutsch-japanischen Wirtschaftsaustausch und die Auswirkungen auf Import- und Exportaktivitäten in der Automobilbranche.
Welche Rolle spielt Toyota in der Arbeit?
Toyota dient als Fallstudie, um die theoretischen Überlegungen praktisch zu veranschaulichen. Die Arbeit analysiert die Kommunikationsstrategien von Toyota im Kontext der interkulturellen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan und bewertet deren Einfluss auf den Import und Export.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf den theoretischen Grundlagen der Kommunikation nach Friedemann Schulz von Thun.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Allgemeine Kommunikation (verbal, nonverbal, paraverbal), Einfluss interkultureller Kommunikation auf Import/Export in der Automobilbranche, Bewertung des Einflusses am Beispiel Toyota, und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Kommunikation, verbale Kommunikation, nonverbale Kommunikation, Automobilbranche, Deutschland, Japan, Toyota, Import, Export, Wirtschaftsbeziehungen, kulturelle Unterschiede, Kommunikationsprobleme, Fallstudie.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Bewertung des Einflusses der interkulturellen Kommunikation auf den wirtschaftlichen Erfolg im Kontext des Import- und Exports in der Automobilbranche zwischen Deutschland und Japan.
Welche konkreten Themenschwerpunkte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss verbaler und nonverbaler Kommunikation auf den internationalen Handel, kulturelle Unterschiede in der Kommunikation zwischen Deutschland und Japan, Herausforderungen und Chancen interkultureller Kommunikation in der Automobilbranche, die Kommunikationsstrategien von Toyota und deren Auswirkungen sowie die Bewertung des Einflusses der interkulturellen Kommunikation auf den wirtschaftlichen Erfolg.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Der Einfluss verbaler und nonverbaler Kommunikationsmittel in der interkulturellen Kommunikation auf den Import und Export in der Automobilbranche. Am Beispiel von Toyota, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1244802