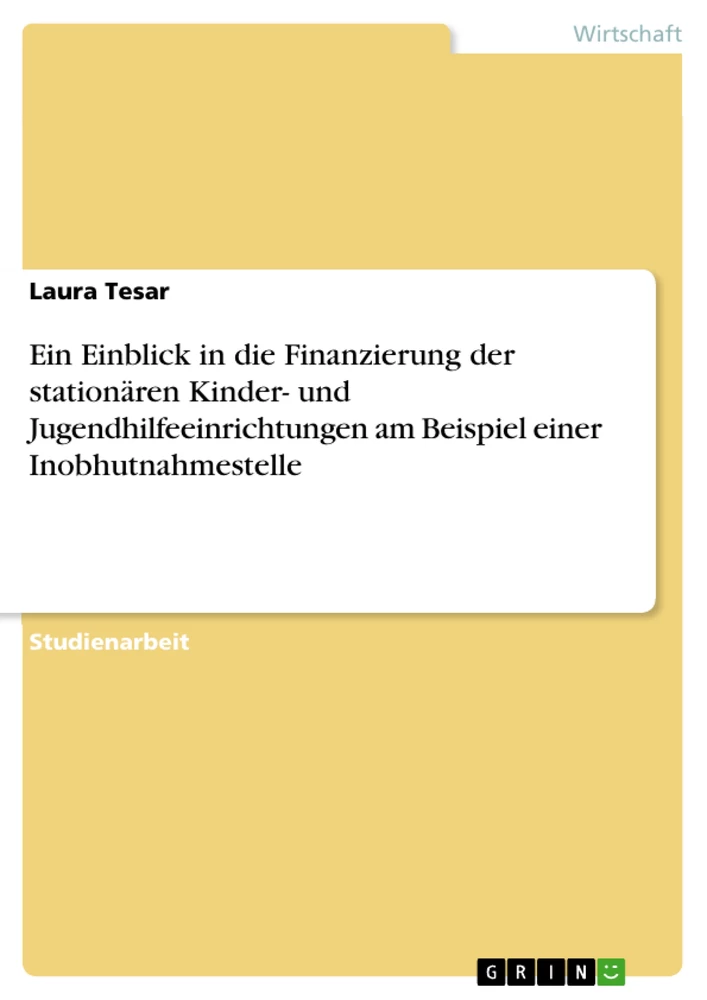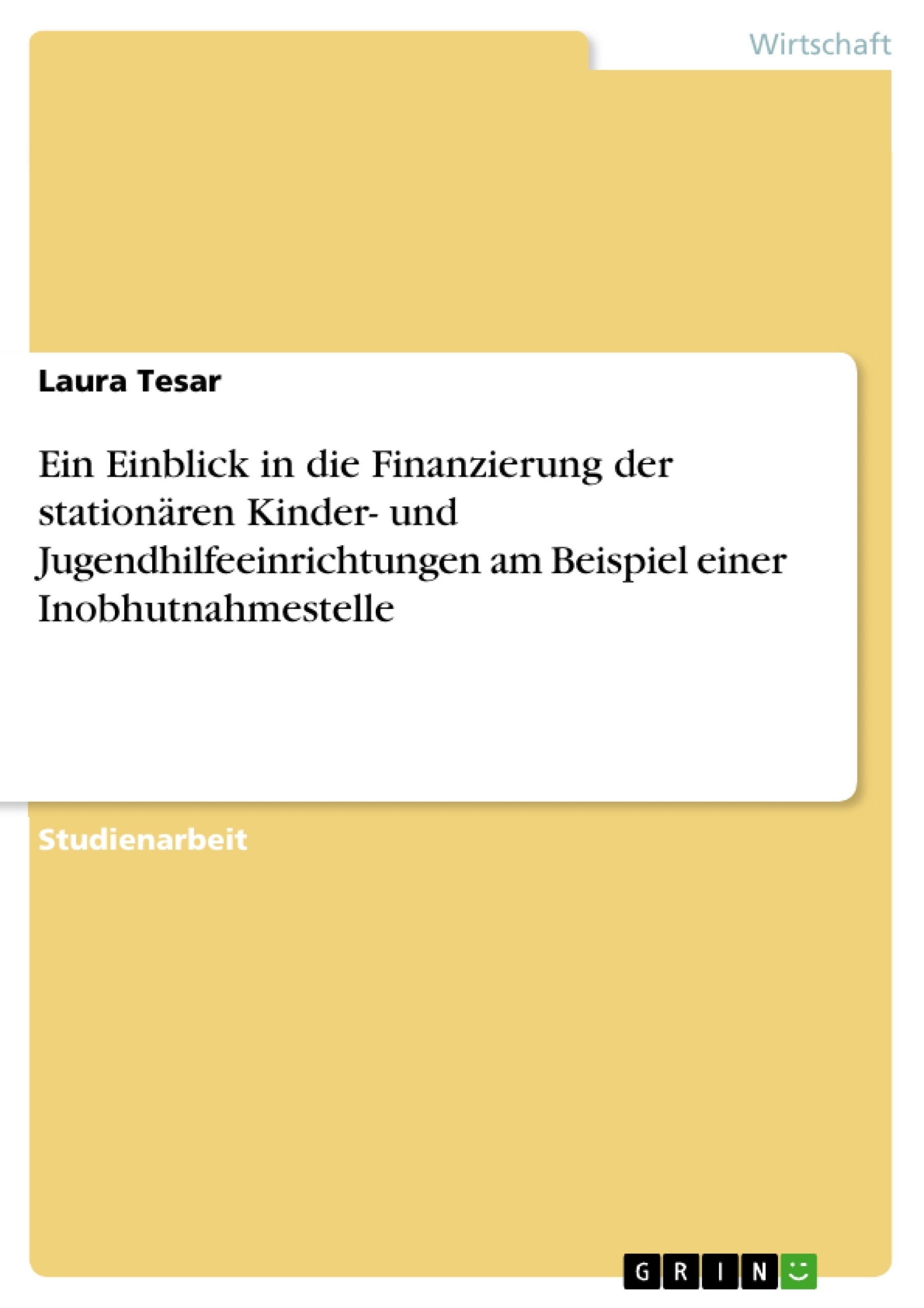In dieser Hausarbeit werden die unterschiedlichen Finanzierungsformen der Sozialwirtschaft am Beispiel der stationären Kinder und Jugendhilfe /Inobhutnahme erläutert.
In Bayern gibt es ca. 4177 Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, darunter fallen unter anderem Wohngruppen, Kinderheime und Inobhutnahmegruppen. Die damit verbundenen Kosten für Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen haben sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Die größte Steigerung der Ausgaben ist auf Kindertageseinrichtungen wie Kindergärten oder Krippen zurückzuführen, da diese in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurden. Doch auch die Kosten für Hilfen zur Erziehung sind rasant angestiegen. Ein Grund des Kostenanstiegs in der Jugendhilfe ist die stetig steigende Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund von Kindeswohlgefährdung stationär untergebracht werden. Im Jahr 2020 wurden rund 40 000 Kinder in Obhut genommen, im Vorjahr waren es ca. 45 000 Kinder.
Anlässlich der hohen Fallzahlen stellt sich die Frage, wer die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe finanziert. Die Sozialwirtschaft unterscheidet sich maßgeblich von anderen wirtschaftlichen Bereichen, da sozialen Einrichtungen unterschiedliche Möglichkeiten der Finanzierung zur Verfügung stehen.
Im Verlauf dieser Arbeit wird der Finanzierungsmix der Sozialwirtschaft verdeutlicht, indem die unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten differenziert dargestellt werden. Um die Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen aufzuzeigen, wird am Beispiel der Finanzierung einer Inobhutnahmegruppe erläutert, welche Formen der Einrichtung zur Verfügung stehen und wie diese spezifisch genutzt werden. Des Weiteren werden sowohl die Chancen als auch die Risiken der Finanzierung in einer Inobhutnahme vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe
- Gesetzlichen Grundlagen
- Besonderheiten der Sozialwirtschaft
- Finanzierungsquellen in der Sozialwirtschaft
- Öffentliche Finanzierung
- Direkte vs. indirekte Finanzierung
- Formen der Zuschüsse
- Leistungsvertrag
- Aufwendungsersatz
- Leistungsentgelt
- Selbstfinanzierung
- Finanzierung durch Privatpersonen und private Institutionen
- Gemeinwesenökonomie und solidarische Ökonomie
- Öffentliche Finanzierung
- Finanzierung einer Inobhutnahmestelle
- Bedeutung der öffentlichen Finanzierung
- Verwendung von Spenden
- Möglichkeiten der Selbstfinanzierung
- Trägerfinanzierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Finanzierung von stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, insbesondere mit dem Fokus auf Inobhutnahmestellen. Ziel ist es, die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten der Sozialwirtschaft aufzuzeigen und am Beispiel einer Inobhutnahmegruppe die spezifischen Finanzierungsformen und deren Anwendung zu erläutern.
- Finanzierungsmöglichkeiten der Sozialwirtschaft
- Öffentliche und private Finanzierung
- Selbstfinanzierung und Spenden
- Finanzierung einer Inobhutnahmegruppe
- Chancen und Risiken der Finanzierung in Inobhutnahmestellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den aktuellen Bedarf an stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und den damit verbundenen Kostenanstieg dar. Sie führt die Problematik der Finanzierung in diesem Bereich aus und kündigt die Themen der Arbeit an.
- Grundlagen: Dieses Kapitel erklärt die Unterschiede zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe, erläutert die gesetzlichen Grundlagen der Finanzierung und stellt das sozialrechtliche Leistungsdreieck als Besonderheit der Sozialwirtschaft vor.
- Finanzierungsquellen in der Sozialwirtschaft: Hier werden die verschiedenen Formen der Finanzierung in der Sozialwirtschaft detailliert dargestellt, darunter öffentliche Finanzierung, Selbstfinanzierung, Finanzierung durch Privatpersonen und Institutionen sowie Gemeinwesenökonomie und solidarische Ökonomie.
- Finanzierung einer Inobhutnahmestelle: Dieses Kapitel fokussiert auf die spezifische Finanzierung einer Inobhutnahmegruppe. Es beleuchtet die Bedeutung der öffentlichen Finanzierung, die Verwendung von Spenden, Möglichkeiten der Selbstfinanzierung und die Trägerfinanzierung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Sozialwirtschaft, Kinder- und Jugendhilfe, Inobhutnahme, Finanzierung, öffentliche Finanzierung, Selbstfinanzierung, Spenden, Trägerfinanzierung, sozialrechtliches Leistungsdreieck, Gemeinwesenökonomie, solidarische Ökonomie.
- Quote paper
- Laura Tesar (Author), 2021, Ein Einblick in die Finanzierung der stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen am Beispiel einer Inobhutnahmestelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1252992