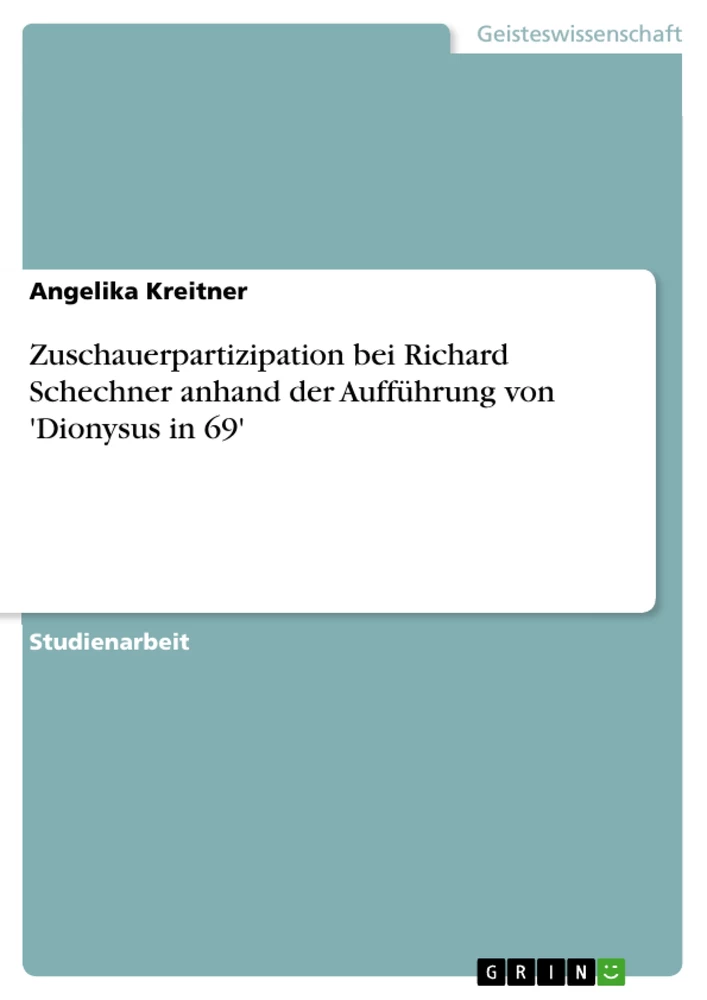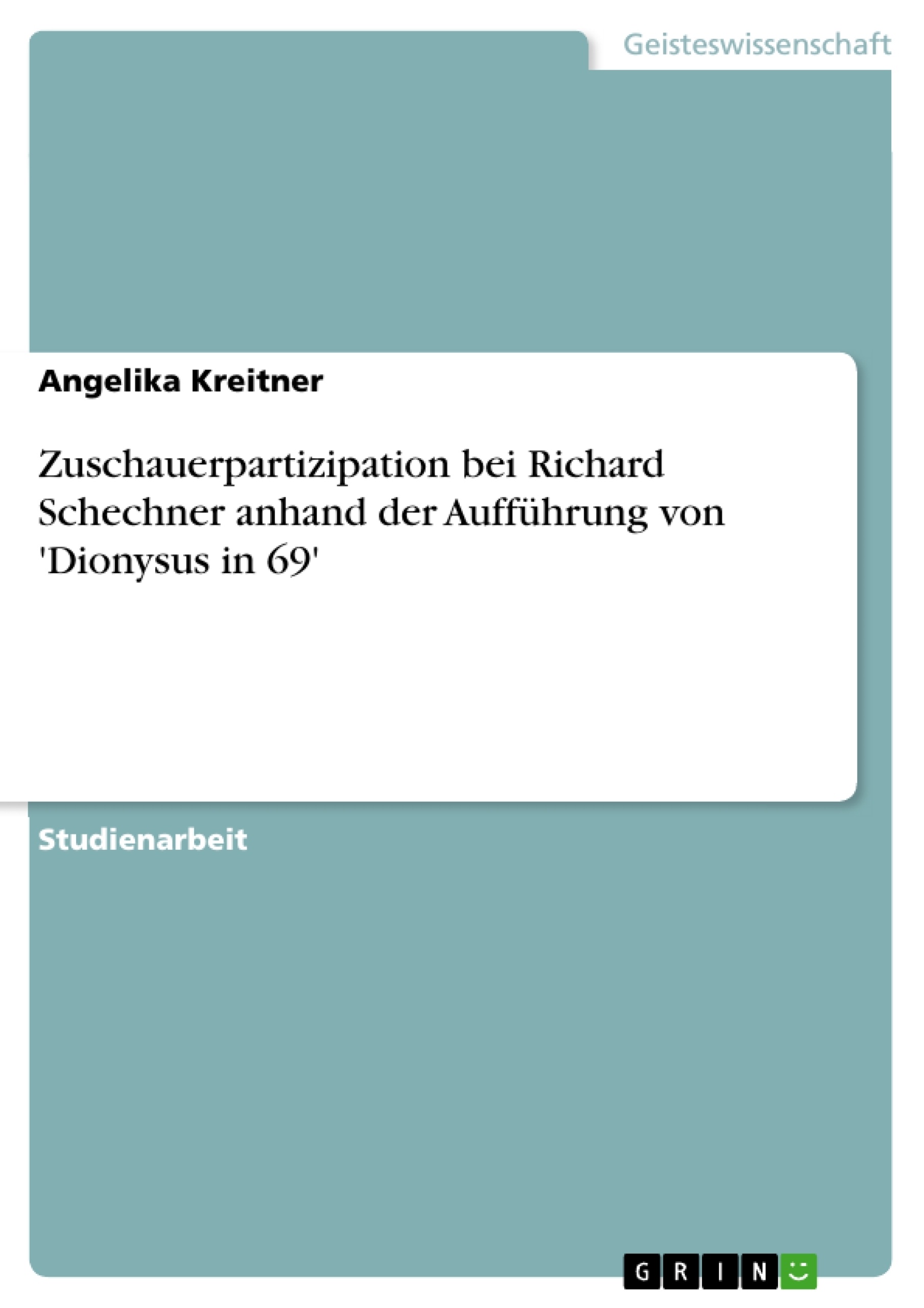„I felt that participation was a good thing – but I didn’t know why, or even how.“ schreibt der Schauspieler, Regisseur und Professor für Performance-Theorien Richard Schechner über seine Anfänge mit dem environmental theater.
Vorstellen möchte ich im Rahmen dieser Arbeit die Experimente von Schechners Performance Group in einer Adaptierung von Euripides’ Bakchen, genannt Dionysus in 69.
Im ersten Kapitel will ich die Aufführung selbst und ihre Wirkung kurz beschreiben und einige Überlegungen anstellen, mit welchen Mitteln die Zuschauerpartizipation erreicht werden sollte. Im zweiten Kapitel der Arbeit sollen theoretische Überlegungen Richard Schechners selbst sowie von Erika Fischer-Lichte und auch Hans-Thies Lehmann zur direkten Einbeziehung des Publikums vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
1. Dionysus in 69 – Die Aufführung
2. Grenzüberschreitungen zwischen Kunst und Realität
Resümee
Quellenangaben
Einleitung
Als junger Mann in der Happening- und Antikriegsbewegung der 1960er Jahre in den USA begann Schechner sich schon früh für die Umgestaltung des westlich- traditionellen Theaters hin zu einem environmental theater zu interessieren. Neben etwa der Bespielung des gesamten Raumes und der Öffnung für neue Schauspielmethoden war die aktive Beteiligung der Zuschauer ein wichtiger Aspekt im Theater Schechners.
„I felt that participation was a good thing – but I didn’t know why, or even how.“1 schreibt der Schauspieler, Regisseur und Professor für Performance-Theorien Richard Schechner über seine Anfänge mit dem environmental theater. Mit der Performance Group in New York, deren Regisseur er mehrere Jahre lang ab Mitte der 1960er war probte er unterschiedliche Methoden der Zuschauerpartizipation im Spielraum der Performance Garage. Beeinflusst in seinen Überlegungen zur Einbeziehung des Publikums war Schechner von John Cage und Allan Kaprow. Die Experimente fallen in die Zeit der Forderung nach Kunst = Leben.
Vorstellen möchte ich im Rahmen dieser Arbeit die Experimente der Performance Group in einer Adaptierung von Euripides’ Bakchen, genannt Dionysus in 69. Die Wahl auf die Aufführung fiel aufgrund der guten Verfügbarkeit des Filmes von Brian de Palma im Gegensatz zu anderen Schechner- Performances, die aber nicht weniger interessante Experimente der Publikumsbeteiligung darstellen. Im ersten Kapitel will ich die Aufführung selbst und ihre Wirkung kurz beschreiben und einige Überlegungen anstellen, mit welchen Mitteln die Zuschauerpartizipation erreicht werden sollte. Im zweiten Kapitel der Arbeit sollen theoretische Überlegungen Richard Schechners selbst sowie von Erika Fischer-Lichte und auch Hans-Thies Lehmann zur direkten Einbeziehung des Publikums vorgestellt werden.
1. Dionysus in 69– Die Aufführung
Die Adaptierung von Euripides’ Bakchen wurde erstmals im Sommer 1968 in New York gespielt. Zu Beginn der Proben war die Beteiligung des Publikums noch nicht geplant, nach Schechner schienen dann aber im Laufe der Erarbeitung des Spiels immer mehr Szenen eine Partizipation zu benötigen.
Der Raum der Performance Garage war ausgelegt mit schwarzen Matten, die Zuschauer saßen im ganzen Raum verteilt, an den Rändern als auch in der Mitte des Raums. Zwei turmähnliche Gerüste dominierten den Raum, weiters gab es mehrere Plattformen und Türme, die alle den Zuschauern als Sitzflächen, aber auch den Performern als Spielflächen dienten. Die Handlung spielte in verschiedenen Bereichen, auf den gesamten Raum verteilt. ‚Dominante’ Teile der Handlung wie das Geburtsritual des Dionysos oder der Tod von Pentheus spielten auf den schwarzen Matten und verlangten nach Zuschauerpartizipation. Chorische Szenen spielten meist unter den Zuschauern oder an der Peripherie des Raumes. Es gab aber auch Szenen, die privat, dem Zuschauer nicht verfügbar, in den Gerüsten eingebauten Verstecken spielen. Der gesamte Raum war, Schechner zufolge, ganz auf Partizipation angelegt. Durch die Überschreitung der herkömmlichen Grenze zwischen der Rolle als Zuschauer und der Rolle als Performer wurde versucht, Gemeinschaft zu erzeugen und einen Rollenwechsel durchzuführen. Diese Grenze zwischen Zuschauer und Spieler wurde mit verschiedenen Methoden aufzuheben versucht. In manchen Szenen waren für den außen stehenden (Film-) Betrachter Publikum und Performer tatsächlich nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Durch Szenen der Berührungen und des gemeinsamen rituellen, rhythmischen Summens wirken teilweise sogar die Grenzen zwischen den Individuen aufgelöst zu einer verschmolzenen Masse.
Natürlich ließen sich nicht alle Zuschauer auf eine derartig ungewohnte Erfahrung ein. Die Beteiligung auf höchst unterschiedliche Weise – von der starken Einbindung ins Stück über die Ekstase (selten) bis hin zur Distanzierung – war von der Performance Group intendiert. Die Erfahrung von großen Extremen war ein Teil des Konzeptes. Wichtig ist für Schechner auch gewesen, dass die Zuschauer zwischen unterschiedlichen Plätzen und Arten, zu sitzen, wählen können. Alle Teilnehmer sollten sich gegenseitig sehen können und entweder alleine oder in Gruppen, auf einem Turm oder am Boden, etc. der Performance beiwohnen können.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Dionysus in 69?
Die Arbeit befasst sich mit Richard Schechners Adaptierung von Euripides’ Bakchen, genannt Dionysus in 69, und untersucht die Methoden der Zuschauerpartizipation, die in dieser Performance angewendet wurden. Die Arbeit analysiert die Aufführung selbst sowie theoretische Überlegungen von Schechner, Erika Fischer-Lichte und Hans-Thies Lehmann zur direkten Einbeziehung des Publikums.
Was war Richard Schechners Interesse am environmental theater?
Schechner war daran interessiert, das traditionelle westliche Theater zu transformieren, indem er den gesamten Raum bespielte, neue Schauspielmethoden einführte und die Zuschauer aktiv beteiligte.
Welchen Einfluss hatten John Cage und Allan Kaprow auf Schechners Arbeit?
Schechner wurde in seinen Überlegungen zur Einbeziehung des Publikums von John Cage und Allan Kaprow beeinflusst. Diese Experimente fielen in die Zeit der Forderung nach Kunst = Leben.
Wie war der Raum der Performance Garage für Dionysus in 69 gestaltet?
Der Raum war mit schwarzen Matten ausgelegt. Zuschauer saßen im ganzen Raum verteilt. Turmähnliche Gerüste, Plattformen und Türme dienten als Sitz- und Spielflächen. Die Handlung spielte sich im gesamten Raum ab.
Wie wurde die Zuschauerpartizipation in Dionysus in 69 erreicht?
Durch die Überschreitung der Grenze zwischen Zuschauer und Performer, Berührungen und gemeinsames rituelles Summen wurde versucht, Gemeinschaft zu erzeugen und einen Rollenwechsel durchzuführen. Die Beteiligung der Zuschauer war unterschiedlich, von starker Einbindung bis zur Distanzierung.
Was war Schechner wichtig in Bezug auf die Zuschauerplätze?
Es war Schechner wichtig, dass die Zuschauer zwischen unterschiedlichen Plätzen und Arten, zu sitzen, wählen können, um sich gegenseitig zu sehen und entweder alleine oder in Gruppen der Performance beizuwohnen.
- Arbeit zitieren
- Angelika Kreitner (Autor:in), 2009, Zuschauerpartizipation bei Richard Schechner anhand der Aufführung von 'Dionysus in 69', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127078