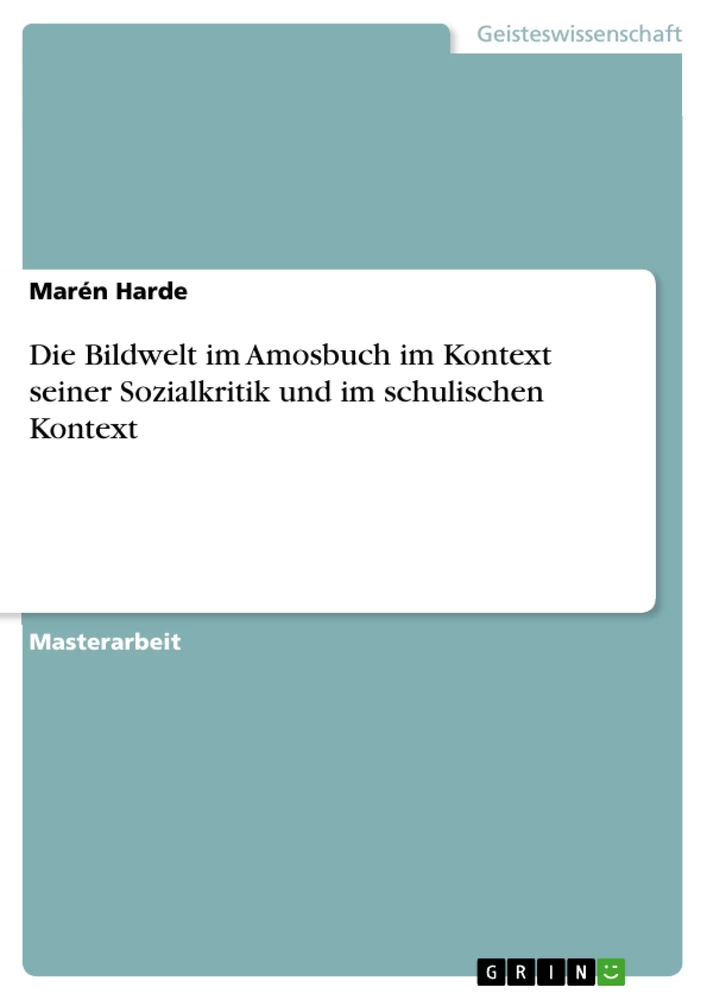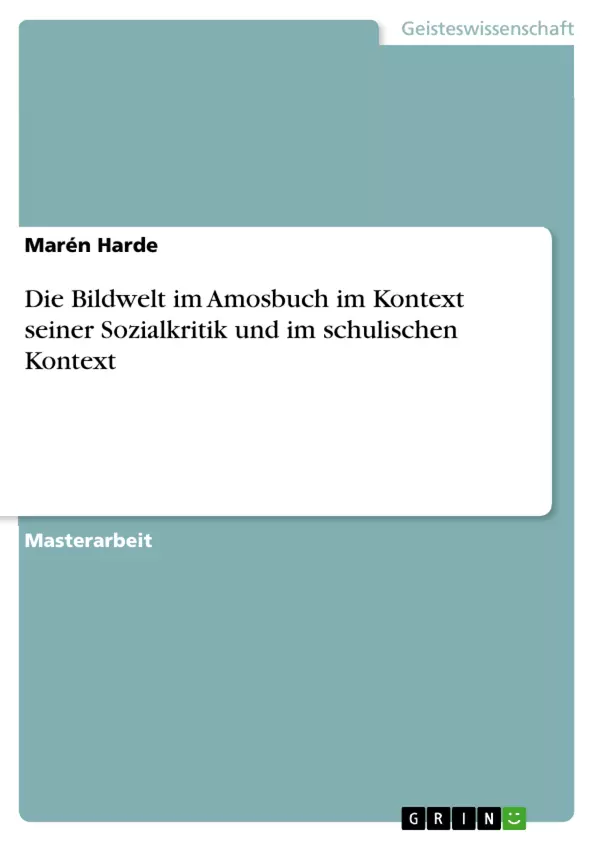In dieser Masterarbeit geht es um die Bildwelt im Amosbuch im Kontext seiner Sozialkritik. Bilder begegnen uns heute überall im Alltag. Bilder können oft auch "Scheinbilder" sein, die einer kritischen Auseinandersetzung bedürfen. Hierfür sollten Kinder und Jugendliche bereits früh sensibilisiert werden, um Ungerechtigkeiten zu erkennen. Eine Auseinandersetzung mit dem Propheten Amos bietet sich in diesem Zusammenhang an, da er zu seiner Zeit starke Sozialkritik äußerte.
Um die Bildwelt im Amosbuch im Kontext seiner Sozialkritik zu analysieren, werden die folgenden Fragen beantwortet: Wie wird die Sozialkritik im Amosbuch anhand von Bildern zum Ausdruck gebracht? Welche Bilder kommen hierbei zum Einsatz und wie werden diese sprachlich umgesetzt?
Zu Beginn der Arbeit steht ein Überblick zum Amosbuch und eine zeitgeschichtliche Einordnung. Daraufhin beginnt die Analyse der einzelnen Textpassagen, in denen die Bildwelt im Amosbuch im Kontext der Sozialkritik deutlich wird. Zuletzt erfolgt dann eine Auswertung der Gegenüberstellung der sozialkritischen Textpassagen im Amosbuch mit anschließender Ergebnissicherung. Abschließend erfolgt eine religionspädagogische Anknüpfung zu dem Thema, wie Amos im schulischen Kontext eingesetzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Analyse: Die Bildwelt im Amosbuch im Kontext seiner Sozialkritik
- 2.1 Überblick zum Amosbuch
- 2.1.1 Gliederung
- 2.1.2 Datierung
- 2.1.3 Die Figur Amos
- 2.2 Zeitgeschichte: Israel im 8. Jh. v. Chr.
- 2.2.1 Politisch-militärischer Überblick
- 2.2.2 Wirtschaftlicher Überblick
- 2.2.3 Gesellschaftlicher Überblick
- 2.3 Die Bildwelt im Amosbuch
- 2.3.1 Am 2,6-8: Die Vergehen Israels
- 2.3.1.1 Am 2,6: Ein Paar Schuhe
- 2.3.1.2 Am 2,7: Köpfe in Staub und Entheiligung des heiligen Namen
- 2.3.1.3 Am 2,8: Wein vom Gelde der Bestraften
- 2.3.1.4 Am 2,6-8: Zusammenschau
- 2.3.2 Am 4,1: Die Kühe des Baschan
- 2.3.2.1 Am 4,1: Zusammenschau
- 2.3.3 Am 5,7.10-12: Gegen die Unterdrücker
- 2.3.3.1 Am 5,7: Recht und Wermut
- 2.3.3.2 Am 5,10.12: Der im Tor Recht spricht
- 2.3.3.3 Am 5,11: Quadersteine und Weinberge
- 2.3.3.4 Am 5,7.10-12: Zusammenschau
- 2.3.4 Am 6,4-6: Gegen Schwelgerei und Selbstsicherheit
- 2.3.4.1 Am 6,4: Lager aus Elfenbein
- 2.3.4.2 Am 6,5.6: David, Öl und Josef
- 2.3.4.3 Am 6,4-6: Zusammenschau
- 2.3.5 Am 8,4-6: Menschenhandel und Handelsbetrug
- 2.3.5.1 Am 8,4: Arme und Elende
- 2.3.5.2 Am 8,5: Efa und Schekel
- 2.3.5.3 Am 8,6: Abfall von Korn
- 2.3.5.4 Am 8,4-6: Zusammenschau
- III. Auswertung: Die Bildwelt im Amosbuch im Kontext seiner Sozialkritik
- 3.1 Auswertung der Gegenüberstellung der sozialkritischen Textpassagen im Amosbuch
- 3.2 Ergebnisse der Gegenüberstellung der sozialkritischen Textpassagen im Amosbuch
- 3.3 Zusammenfassung: Die Bildwelt im Amosbuch im Kontext seiner Sozialkritik
- IV. Religionspädagogische Anknüpfung: Amos im schulischen Kontext
- 4.1 Curriculare Einordnung
- 4.2 Unterrichtsvorhaben
- 4.2.1 Umsetzung I
- 4.2.2 Umsetzung II
- 4.3 Lebensweltbezug und Zukunftsbedeutung für Schüler:innen
- V. Literaturverzeichnis
- Die Verwendung von Bildern als Mittel der Sozialkritik im Amosbuch
- Analyse der Bildsprache und ihrer Funktion im Kontext der Zeitgeschichte
- Die Bedeutung der Bildwelt für die Vermittlung der Botschaft des Propheten Amos
- Die Relevanz der Sozialkritik des Amos für die heutige Zeit
- Möglichkeiten der religionspädagogischen Anknüpfung des Amosbuches im schulischen Kontext
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Bildwelt im Amosbuch im Kontext seiner Sozialkritik zu analysieren. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Sozialkritik im Amosbuch anhand von Bildern zum Ausdruck gebracht wird, welche Bilder hierbei zum Einsatz kommen und wie diese sprachlich umgesetzt werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Amosbuches für die heutige Zeit heraus und beleuchtet die Bedeutung der Bildwelt im Kontext der Sozialkritik. Es wird die Forschungslücke in der Literatur zur Bildwelt im Amosbuch aufgezeigt und die Forschungsfrage der Arbeit formuliert.
Kapitel II analysiert die Bildwelt im Amosbuch im Kontext seiner Sozialkritik. Es wird ein Überblick über das Amosbuch, seine Datierung und die Figur Amos gegeben. Anschließend wird die Zeitgeschichte Israels im 8. Jh. v. Chr. beleuchtet. Im Fokus stehen die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten der Zeit, die den Hintergrund für die Sozialkritik des Amos bilden. Der Hauptteil des Kapitels beschäftigt sich mit der Analyse der Bildwelt im Amosbuch. Es werden verschiedene Textpassagen, die die Bildwelt des Amosbuches repräsentieren, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Bildwelt im Amosbuch, die Sozialkritik des Propheten Amos, die Zeitgeschichte Israels im 8. Jh. v. Chr., die Analyse der Bildsprache und die religionspädagogische Anknüpfung des Amosbuches im schulischen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die Bildwelt des Amosbuches für die Sozialkritik untersucht?
Der Prophet Amos nutzte starke visuelle Metaphern, um Ungerechtigkeiten seiner Zeit anzuprangern, was heute zur Sensibilisierung für "Scheinbilder" dient.
Welche historischen Umstände prägten das Wirken von Amos?
Amos wirkte im Israel des 8. Jahrhunderts v. Chr., einer Zeit politischer Stabilität, aber auch extremer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ungleichheit.
Was symbolisiert das Bild der "Kühe des Baschan" (Am 4,1)?
Es ist eine sozialkritische Metapher für die wohlhabende Oberschicht, die auf Kosten der Armen im Luxus lebte.
Wie kann das Amosbuch im Schulunterricht eingesetzt werden?
Religionspädagogisch bietet das Thema Anknüpfungspunkte zur Lebenswelt der Schüler, um über Gerechtigkeit, Menschenhandel und Betrug zu diskutieren.
Welche weiteren Bilder nutzt Amos gegen Unterdrücker?
Die Arbeit analysiert Bilder wie "ein Paar Schuhe", "Lager aus Elfenbein" oder "Wermut" als Symbole für Korruption und Herzlosigkeit.
- Quote paper
- Marén Harde (Author), 2022, Die Bildwelt im Amosbuch im Kontext seiner Sozialkritik und im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1280799