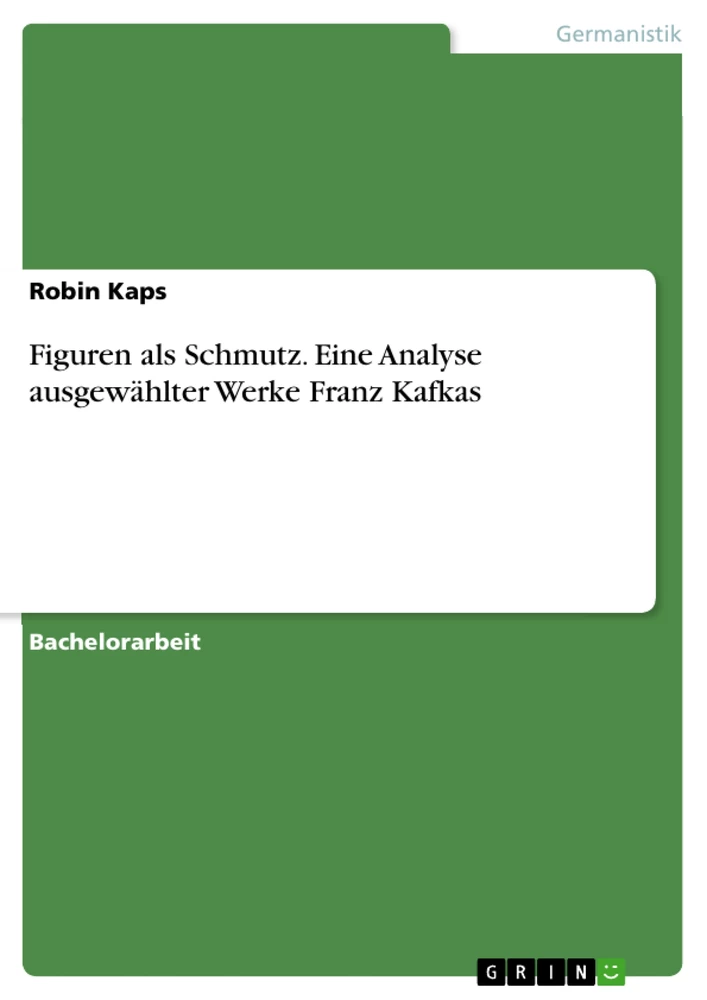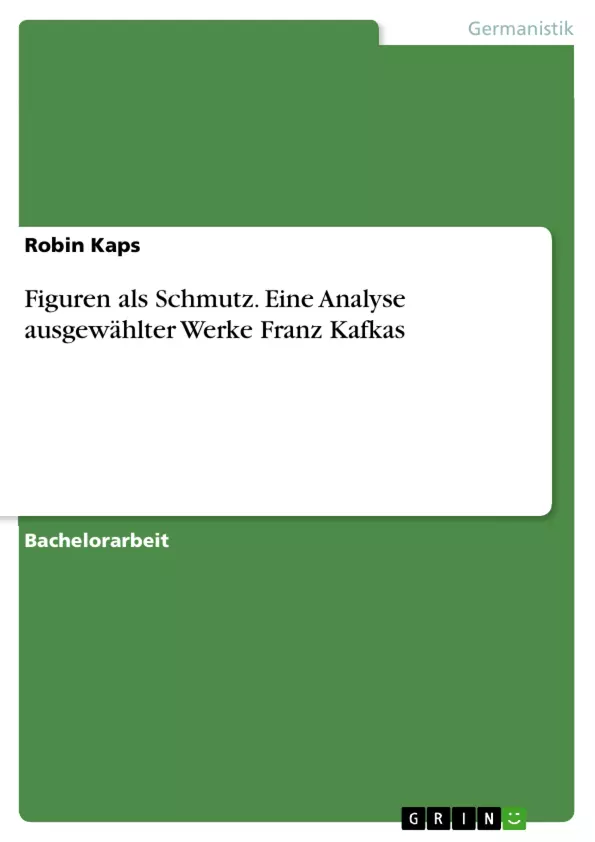Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit einer Thematik, die von der Kafka-Forschung bislang stiefmütterlich behandelt wurde. „Figuren als Schmutz“ analysiert in kleinschrittiger Textarbeit den Schmutz in Kafkas „Schloss“, „Prozess“ und „Verwandlung“. Hierbei handelt es sich um eine ontologische Konstante in Kafkas Werk, die systematisch verfolgt wird. Nach einer kurzen Reflektion über den Schmutzbegriff, untergliedert sich diese Arbeit in drei Hauptkapitel: Schmutzkommunikation und die Verwandlung in Schmutz, die verwehrte Beschmutzung des Beamten Klamm, vernichtende Reinheit.
Besondere Beachtung verdient die Transition von befleckten Figuren zu Figuren, die als Schmutz gelten. C. Enzensberger hat dazu ein eindrückliches Beispiel geliefert. Er schreibt, dass Farbige von Rassisten als Schmutz wahrgenommen werden, denen jede Möglichkeit der Reinigung verwehrt ist (nur schmutziges kann gereinigt werden (vom Schmutz), nicht aber der Schmutz).
Der Schmutz unterbricht bei Kafka die Kommunikation. Schmutz, Schrift und Sprache werden bei ihm eng geführt und diese Arbeit zeigt, dass Schrift und Sprache selbst zu Schmutz werden. Die Figur des Sekretärs (derjenige, der mit dem Sekret anderer befasst ist) dient hierbei als Kronzeuge.
Schmutz bedeutet bei Kafka nicht nur Negation. Der Schönheitsfleck wird zum Zeichen der Macht. Er hebt die um den Fleck befindliche Reinheit hervor. Im „Schloss“ sind es Frieda und der Graf Westwest, die ein solcher Fleck ziert und ihre Macht untermauert. Der Schönheitsfleck Friedas ist der Landvermesser, der Fleck des Grafen das Schloss.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Unzureichende Schmutzdefinition und Vorgehen
- 2. Schmutzkommunikation und die Verwandlung in Schmutz
- 3. Die verwehrte Beschmutzung des Beamten Klamm
- 4. Vernichtende Reinheit: In Schloß, Proceß und Verwandlung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der These, dass Figuren in ausgewählten Werken Franz Kafkas nicht nur als schmutzig gelten, sondern in den Texten den Status von Schmutz zugeschrieben bekommen und sich teilweise selbst zuschreiben. Die Analyse untersucht die Auswirkungen des Schmutzes auf die Kommunikation, die Funktion der Hierarchie und die Gefahr der Befleckung, wobei das Werk "Das Schloß" im Fokus steht und mit "Der Proceß" und "Die Verwandlung" verglichen wird.
- Die Bedeutung von Schmutz als struktureller und ordnungsbildender Begriff in Kafkas Werken
- Die Rolle von Schmutz in der Kommunikation zwischen Figuren, insbesondere im Kontext von "Das Schloß"
- Die Verwandlung von Figuren in Schmutz und die damit verbundenen Auswirkungen
- Die Funktion von Reinigung und Vernichtung in Bezug auf Schmutzfiguren
- Der Einfluss von Schmutz auf Hierarchien und Ordnungen in Kafkas Werken
Zusammenfassung der Kapitel
- 1. Einleitung: Das Kapitel führt die These der Arbeit ein, dass Figuren in Kafkas Werken als Schmutz gelten. Es wird auf die Notwendigkeit einer präzisen Schmutzdefinition hingewiesen und verschiedene theoretische Perspektiven auf Schmutz diskutiert.
- 2. Schmutzkommunikation und die Verwandlung in Schmutz: Dieses Kapitel untersucht, wie Schmutz die Kommunikation zwischen Figuren in Kafkas Werken beeinflusst. Es beleuchtet insbesondere die Verwandlung der Familie Barnabas in Schmutz und die Rolle eines scheinbar schmutzigen Briefes in diesem Prozess.
- 3. Die verwehrte Beschmutzung des Beamten Klamm: Das Kapitel analysiert K.'s Versuch, in die Ordnung des Schlosses einzudringen und Klamm zu beflecken. Es beleuchtet die Gründe für K.'s Scheitern und die Auswirkungen der verweigerten Befleckung.
- 4. Vernichtende Reinheit: In Schloß, Proceß und Verwandlung: Dieses Kapitel fokussiert auf die Reinigung, die Entfernung von Schmutzfiguren, und untersucht, wie dieser Prozess in den Werken "Das Schloß", "Der Proceß" und "Die Verwandlung" dargestellt wird.
Schlüsselwörter
Franz Kafka, Schmutz, Ordnung, Hierarchie, Kommunikation, Verwandlung, Reinigung, Befleckung, "Das Schloß", "Der Proceß", "Die Verwandlung", Familie Barnabas, Klamm.
- Quote paper
- Robin Kaps (Author), 2022, Figuren als Schmutz. Eine Analyse ausgewählter Werke Franz Kafkas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1280830