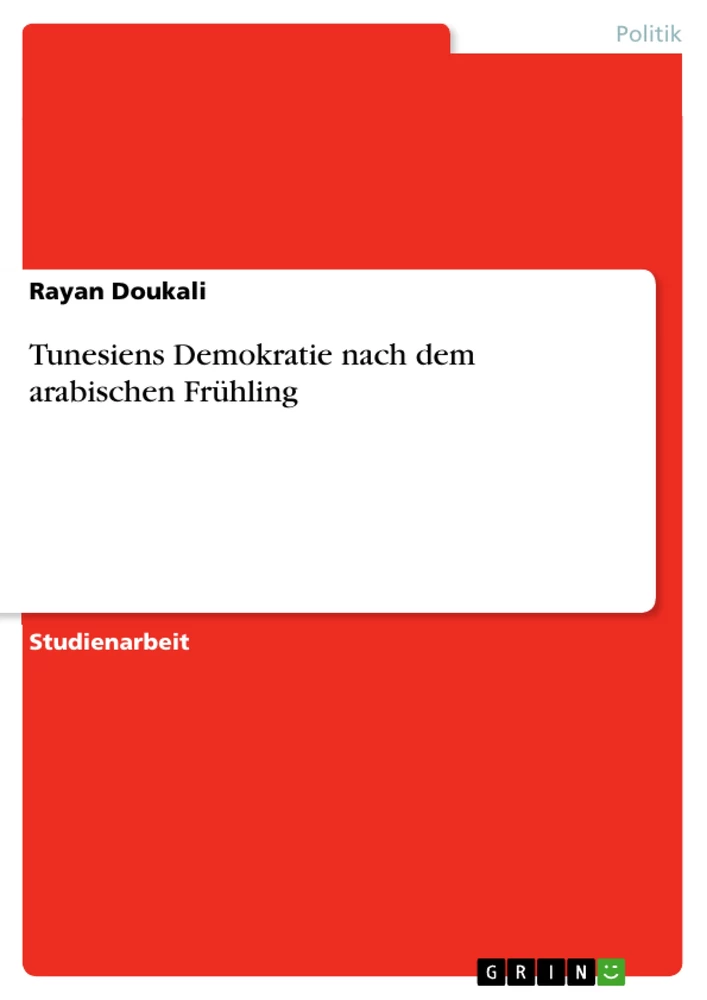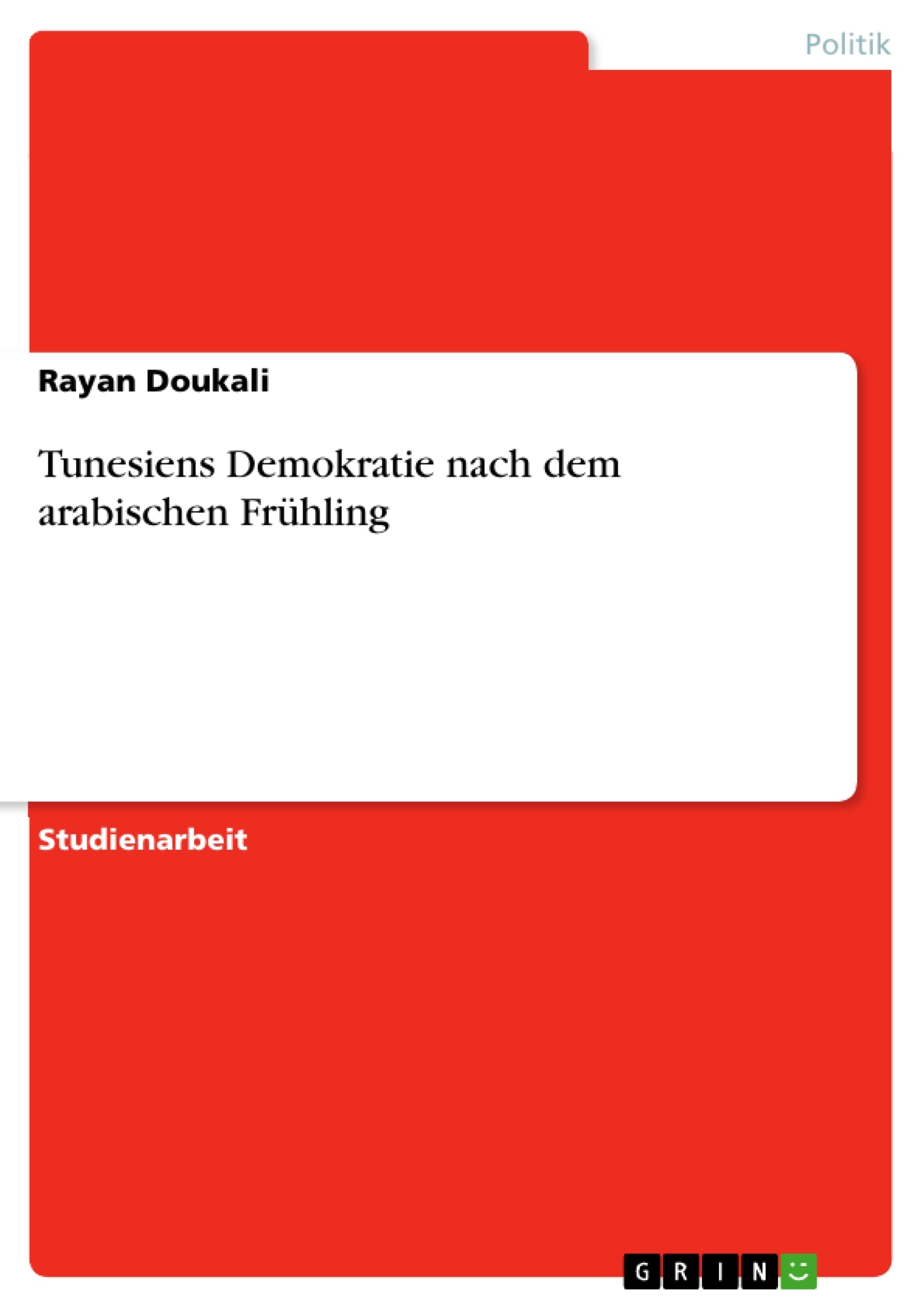Thema dieser Forschungsarbeit sind die Folgen des sogenannten arabischen Frühlings und die damit verbundene politische Revolution in Tunesien auf das politische System des Landes. Es wird mithilfe des Bertelsmann Transformation Indexes als Datengrundlage und der zur Zunahme der Demokratietheorie der „eingebetteten Demokratie“ von Wolfgang Merkel als theoretische Grundlage untersucht, ob die politische Revolution tatsächlich eine Verbesserung der Demokratiequalität in Tunesien zur Folge hatte. Da sich im Zeitraum vor dem sogenannten arabischen Frühling keine nennenswerten Veränderungen zugetragen haben und die Daten für 2019 noch nicht bestehen, liegt unser Untersuchungszeitraum zwischen 2011 und 2018. Welche konkreten Veränderungen nach der Revolution eingetreten sind und welchen Herausforderungen dem Land bevorstehen, werden im Folgenden ausführlich behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsvorhaben
- 1.2 praktische und wissenschaftliche Relevanz
- 2. Merkels „Eingebettete Demokratie“
- 2.1 die Theorie der „eingebetten Demokratie“
- 2.2 Annahmen
- 3. Forschungsdesign
- 3.1 Der Bertelsmann Transformation Index
- 3.2 methodisches Vorgehen und Konzeptualisierung
- 4. Analyse
- 4.1 Gesamtüberblick
- 4.2 Freie und faire Wahlen
- 4.3 Politische Freiheiten
- 4.4 Bürgerrechte
- 4.5 Horizontale Verantwortlichkeit
- 4.6 Effektive Regierungsgewalt
- 5. Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit befasst sich mit den Auswirkungen des arabischen Frühlings und der politischen Revolution in Tunesien auf das politische System des Landes. Ziel ist es zu untersuchen, ob die Revolution tatsächlich zu einer Verbesserung der Demokratiequalität in Tunesien geführt hat. Dies wird mithilfe des Bertelsmann Transformation Indexes (BTI) und der Theorie der „eingebetteten Demokratie“ von Wolfgang Merkel analysiert.
- Die Entwicklung des politischen Systems in Tunesien nach der Revolution
- Die Auswirkungen der Revolution auf die Demokratiequalität in Tunesien
- Die Anwendung des Bertelsmann Transformation Indexes zur Analyse der Demokratiequalität
- Die Relevanz von Wolfgang Merkels Theorie der „eingebetteten Demokratie“ für den tunesischen Kontext
- Die Herausforderungen, vor denen Tunesien im Hinblick auf die Festigung der Demokratie steht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Forschungsvorhaben vor, erläutert die Relevanz der Arbeit und formuliert die Forschungsfrage: Ist Tunesien seit der politischen Revolution 2010/2011 demokratischer als vorher?
Kapitel 2 erläutert die Theorie der „eingebetteten Demokratie“ von Wolfgang Merkel, die als theoretische Grundlage für die Untersuchung dient.
Kapitel 3 beschreibt das Forschungsdesign, wobei der Bertelsmann Transformation Index als Instrument und Datengrundlage vorgestellt wird.
Kapitel 4 analysiert die Entwicklung Tunesiens anhand des BTI und untersucht die einzelnen Indikatoren der Demokratiequalität.
Schlüsselwörter
Tunesien, arabischer Frühling, politische Revolution, Demokratiequalität, Bertelsmann Transformation Index, „eingebettete Demokratie“, Wolfgang Merkel, politisches System, Wahlbeteiligung, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Entwicklung, Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Hat der Arabische Frühling die Demokratie in Tunesien verbessert?
Die Forschungsarbeit untersucht genau diese Frage mithilfe des Bertelsmann Transformation Indexes (BTI) und analysiert die Entwicklung der Demokratiequalität zwischen 2011 und 2018.
Was versteht man unter "eingebetteter Demokratie"?
Dies ist eine Theorie von Wolfgang Merkel, die davon ausgeht, dass eine stabile Demokratie in ein System von unterstützenden Institutionen und gesellschaftlichen Bedingungen eingebettet sein muss.
Welche Rolle spielt der Bertelsmann Transformation Index (BTI)?
Der BTI dient als Datengrundlage, um den Stand von Demokratie und Marktwirtschaft sowie die Regierungsführung in Tunesien wissenschaftlich messbar zu machen.
Welche Indikatoren werden zur Analyse der Demokratiequalität genutzt?
Untersucht werden unter anderem freie und faire Wahlen, politische Freiheiten, Bürgerrechte, horizontale Verantwortlichkeit und die effektive Regierungsgewalt.
Vor welchen Herausforderungen steht Tunesien heute?
Zu den Herausforderungen gehören die Festigung der rechtsstaatlichen Strukturen, die wirtschaftliche Entwicklung und die dauerhafte Sicherung der erreichten politischen Freiheiten.
- Citar trabajo
- Rayan Doukali (Autor), Tunesiens Demokratie nach dem arabischen Frühling, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1283050