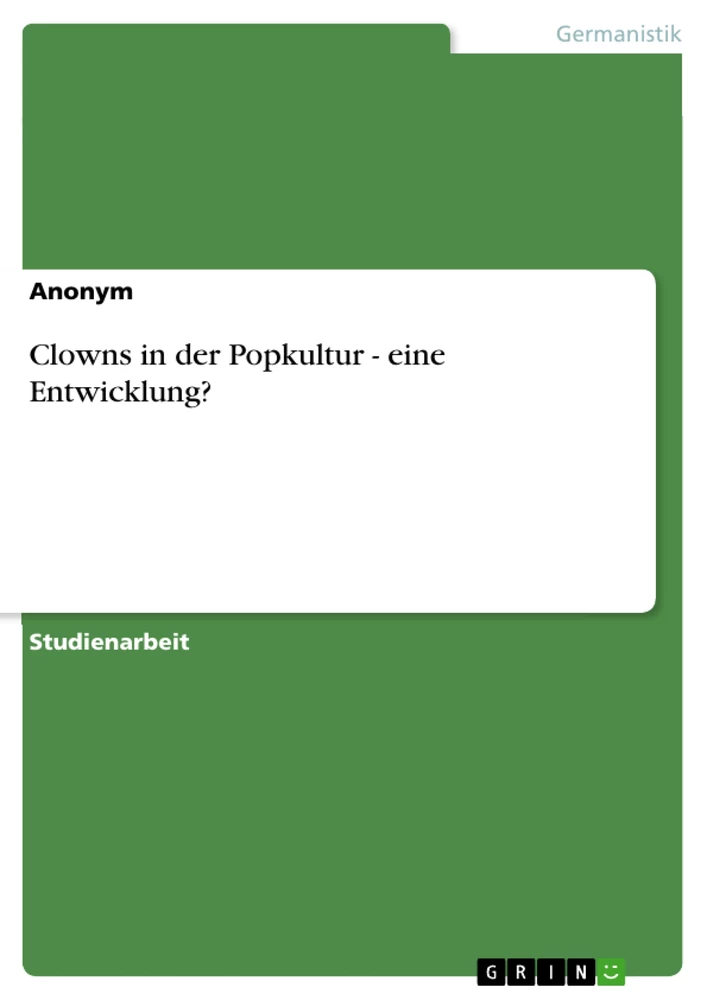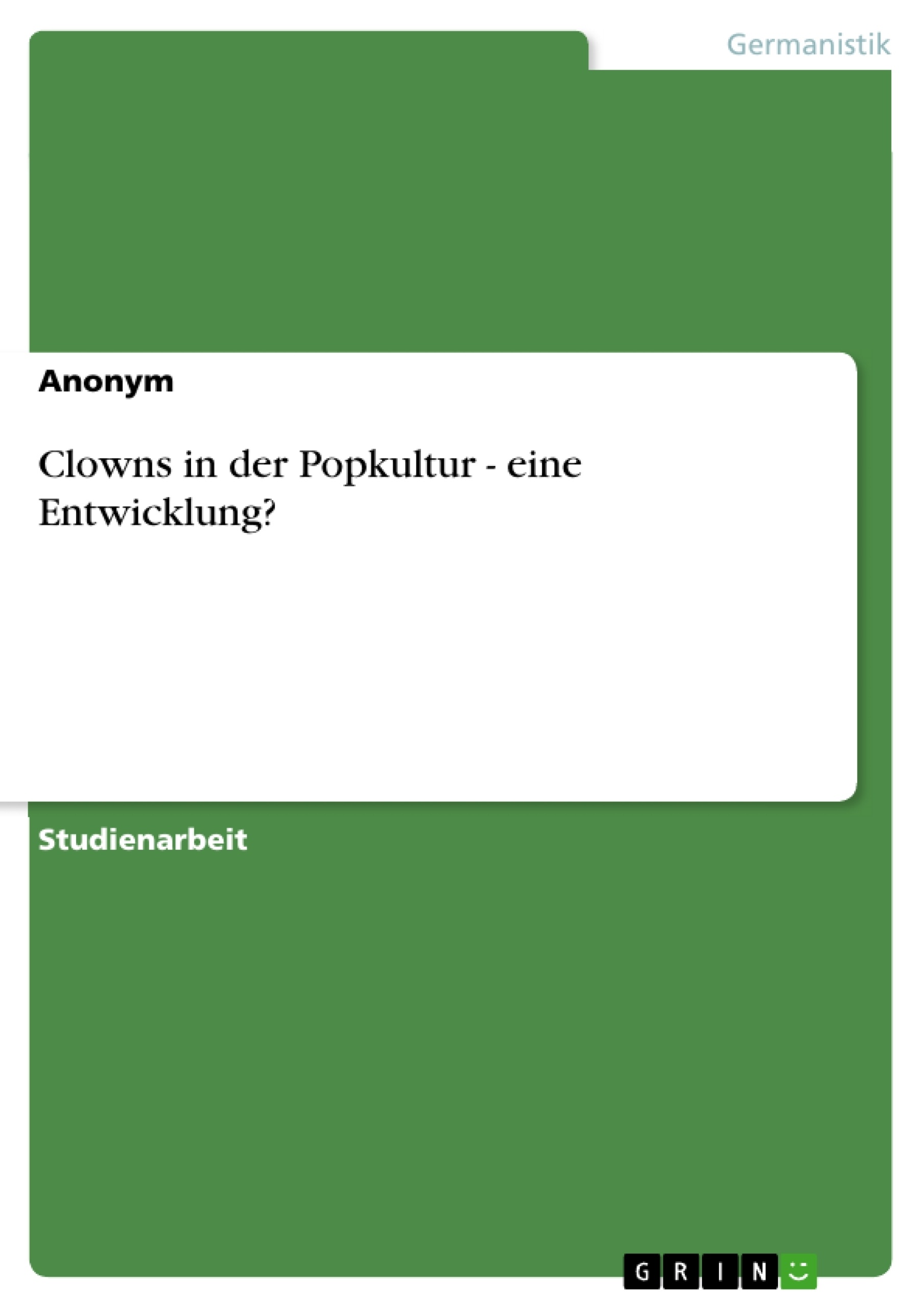In dieser Ausarbeitung soll die Frage geklärt werden, welchen Prozess die Clown-Figur in der Popkultur unternimmt und welche Merkmale dieses Charakterisieren. Dabei soll zunächst die Entstehung des Clowns aufgezeigt sowie dessen ursprüngliche Funktion dargestellt werden. Danach werden anhand von wissenschaftlicher Literatur Merkmale der modernen Clown-Gestalt herausgearbeitet. Diese aufgestellten Merkmale sollen dann auf die filmische Darstellung von ES (Pennywise der tanzende Clown, 2017) bezogen werden. Dabei berücksichtigt werden ebenfalls traditionelle clowneske Charakteristika, damit dargestellt werden kann, inwiefern der Entwicklungsprozess der Figur stattfindet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Entstehung der Clown-Figur – ein historischer Umriss
- 1.1 Etymologie des Clown Begriffs
- 1.2. Die „Geschichte“ des Clowns – Ursprünge, Abstammung, Ahnen und Funktionen
- 2. Prototyp Clown
- 2.1. Die Merkmale der prototypischen Clown-Figur
- 3. Clowns in der Popkultur - eine Entwicklung
- 3.1 Der,,Evil-Killer-Clown
- 3.2. Der Horrorclown am Beispiel von Pennywise
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung analysiert die Entwicklung der Clown-Figur in der Popkultur und beleuchtet insbesondere die Transformation vom traditionellen, humorvollen Clown zum unheimlichen, gar bedrohlichen Horrorclown. Der Fokus liegt dabei auf der Veränderung der Merkmale und Funktionen dieser Figur in zeitgenössischen Filmen.
- Etymologie und historische Entwicklung der Clown-Figur
- Merkmale des prototypischen Clowns
- Die Entwicklung des "Evil-Killer-Clown" in der Popkultur
- Die Darstellung des Horrorclowns am Beispiel von Pennywise in "ES" (2017)
- Die Integration traditioneller Clown-Merkmale in die moderne Horrorfigur
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt den Leser in die Thematik des Clowns in der Popkultur ein und stellt die zentrale Frage nach der Entwicklung dieser Figur von der traditionellen, humorvollen Gestalt zum unheimlichen Horrorclown. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Assoziationen, die der Clown heutzutage hervorruft und skizziert den Fokus der Ausarbeitung, der auf die Veränderung der Merkmale und Funktionen der Figur in zeitgenössischen Filmen liegt.
- Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung und dem historischen Hintergrund der Clown-Figur. Es beleuchtet die Etymologie des Wortes "Clown" und geht auf verschiedene Theorien zu seinem Ursprung ein. Es werden die verschiedenen Bedeutungen des Wortes "Clown" im Laufe der Geschichte beleuchtet und die Bedeutung der Figur als Verkörperung des Abwechselungs von Normen und Traditionen herausgestellt.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Merkmalen des prototypischen Clowns. Es wird auf die traditionellen Merkmale wie bunte Kleidung, rote Nase, tollpatschige Bewegungen und das breite Grinsen eingegangen.
- Das dritte Kapitel analysiert die Entwicklung des "Evil-Killer-Clown" in der Popkultur. Es beleuchtet die Veränderung der Clown-Figur von der humorvollen Gestalt zum unheimlichen, gar bedrohlichen Horrorclown, wie er oft in Filmen dargestellt wird. Dabei werden verschiedene Beispiele für diesen Trend genannt und die Gründe für diese Entwicklung untersucht.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit der Clown-Figur in der Popkultur, insbesondere mit ihrer Entwicklung vom traditionellen, humorvollen Clown zum unheimlichen Horrorclown. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Clown, Popkultur, Evil Clown, Horrorclown, Pennywise (ES), Entwicklung, Merkmale, Funktionen, Tradition, Moderne, Film, Popkultur, Tradition, Etymologie.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Clown-Figur historisch entwickelt?
Die Figur hat ihre Ursprünge in Hofnarren und komischen Gestalten des Theaters, die traditionell dazu dienten, Normen und Traditionen spielerisch zu hinterfragen.
Was sind die Merkmale eines „prototypischen“ Clowns?
Dazu gehören bunte Kleidung, eine rote Nase, tollpatschige Bewegungen, ein breites Grinsen und eine insgesamt humorvolle Ausstrahlung.
Was ist ein „Evil-Killer-Clown“?
Dies ist eine moderne Entwicklung in der Popkultur, bei der die traditionellen Merkmale des Clowns ins Unheimliche und Bedrohliche verkehrt werden.
Welche Rolle spielt Pennywise in dieser Analyse?
Pennywise aus dem Film „ES“ (2017) dient als Beispiel für den modernen Horrorclown, an dem gezeigt wird, wie klassische clowneske Elemente für den Grusel genutzt werden.
Warum empfinden viele Menschen Clowns heute als unheimlich?
Die Arbeit untersucht den Prozess, durch den die Maskerade und das erstarrte Lächeln in der Popkultur zunehmend mit Gefahr statt mit Freude assoziiert werden.
Was bedeutet die Etymologie des Begriffs „Clown“?
Die Arbeit beleuchtet die sprachliche Herkunft des Wortes und wie sich seine Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Clowns in der Popkultur - eine Entwicklung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1284374