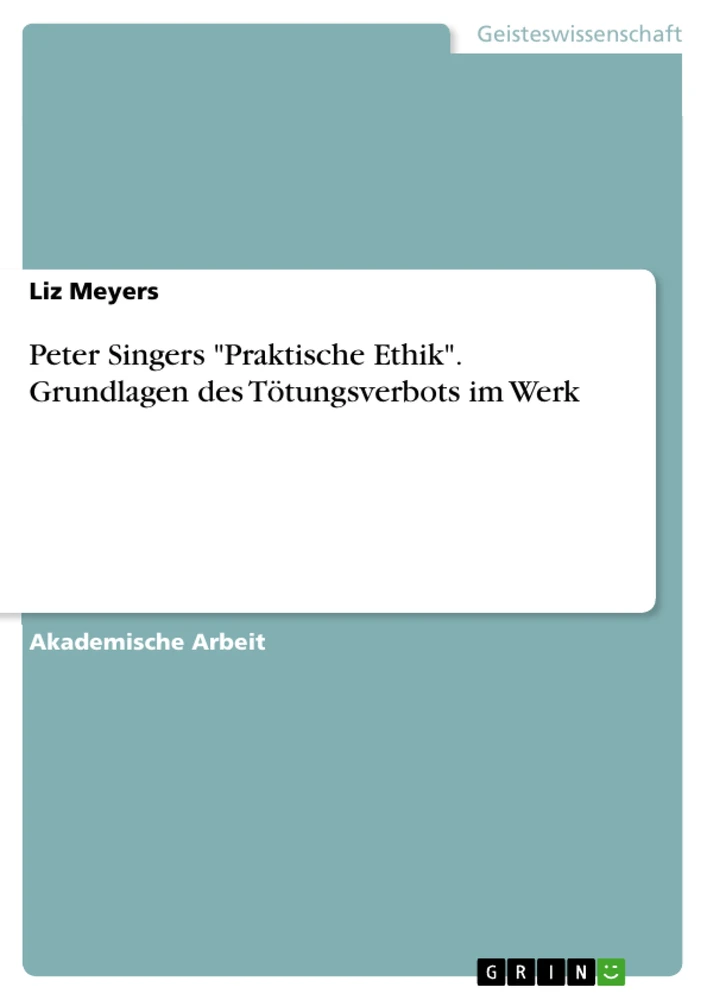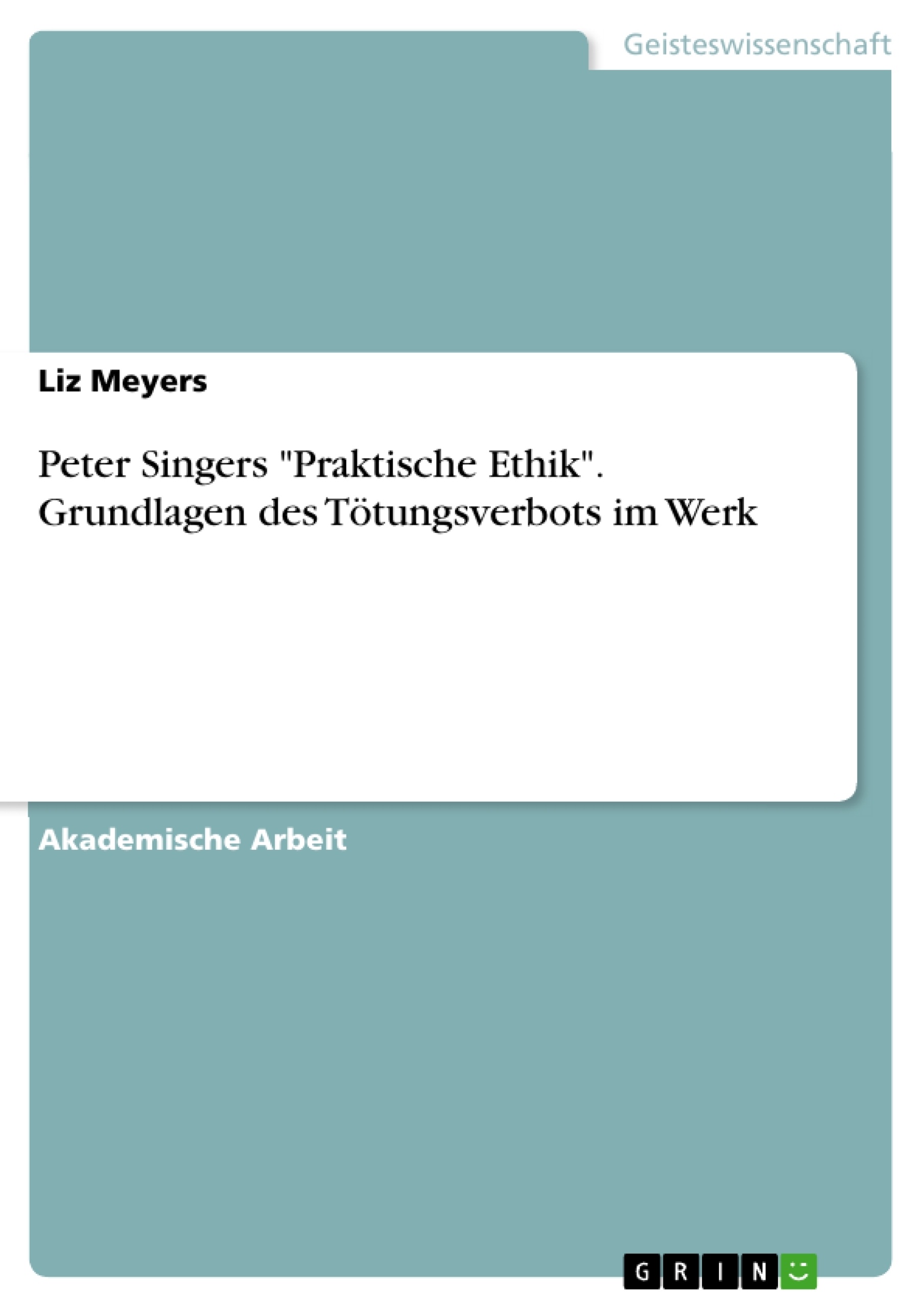Die vorliegende Arbeit stellt Peter Singers Überlegungen zu den Grundlagen des Tötungsverbots in seinem Werk "Praktische Ethik" dar. Singers Unterscheidung des Wertes unterschiedlicher Lebewesen, welche seiner Argumentation vom Tötungsverbot zugrunde liegt und die Kriterien für eine solche Theorie stehen im Zentrum dieser Arbeit und versuchen auf folgende Fragen Antwort zu geben: Welche Wesen unterliegen dem Tötungsverbot? Wie wird der Lebensschutz für unterschiedliche Lebewesen begründet?
Im Werk "Praktische Ethik", erstmals im Jahre 1984 in Deutschland erschienen, widmet sich der australische Philosoph und Bioethiker Peter Albert David Singer zahlreichen gegenwärtigen Fragestellungen und Problemen der Ethik, darunter auch die Frage nach dem Wert unterschiedlicher Lebewesen und den Grundlagen des Tötungsverbots. Durch eine zugespitzte und klare Veranschaulichung seiner Argumente, wie es die moderne Ethik verlangt, versucht Singer praktisch-ethische Lösungen zu erarbeiten. Mit bewusst provokanten Äußerungen zielt er darauf ab, unüberlegte Bräuche und Perspektiven zu erschüttern.
Das philosophische Werk fiel nicht nur durch die ungewöhnliche Grenzüberschreitung der Fachdiskussion auf, sondern ebenfalls durch das Auslösen starker Entsetzung sowie Ablehnung seitens der Leser*innen und Nicht-Leser*innen, welche mit tabuisierten Themen wie dem der Euthanasie und der Abtreibung nicht vertraut sind. So führte die Veröffentlichung seines Werkes von Vorwürfen des Nationalsozialismus, der Warnung vor dem Risiko solcher Überlegungen für Menschen mit Behinderung bis hin zu Aufständen und Störaktionen bei Lehrveranstaltungen und Tagungen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Singers Kriterien zur Unterscheidung des Wertes unterschiedlicher Lebewesen
- 2.1. Die Spezieszugehörigkeit
- 2.2. Der Grad des Bewusstseins
- 2.2.1. Der Grad des Bewusstseins unter Betrachtung des klassisch-hedonistischen Utilitarismus
- 2.2.2. Der Präferenz-Utilitarismus
- 2.3. Die Relevanz von Wunsch und Interesse für das Recht auf Leben
- 2.4. Die Respektierung der Autonomie
- 2.5. Bewusstes Leben
- 2.5.1. Vergleich des Werts von bewusstem und selbstbewusstem Leben
- III. Kritik
- 3.1. Singers Unterscheidung des Wertes von Lebewesen nach dem Bewusstseinsgrad
- 3.2. Das personale Leben
- 3.3. Unterschiedliche Probleme der präferenz-utilitaristischen Theorie
- 3.3.1. Präferenzen als Kriterium zur moralischen Beurteilung
- 3.3.2. „I prefer not to“ eine kritische Betrachtung von Michael Hauskeller
- 3.4. Das Recht auf Leben
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich Peter Singers Überlegungen zu den Grundlagen des Tötungsverbots in seinem Werk „Praktische Ethik“. Im Fokus steht die Unterscheidung des Wertes unterschiedlicher Lebewesen, die Singers Argumentation zum Tötungsverbot untermauert. Die Arbeit analysiert die Kriterien, die Singer für die Bestimmung des Werts von Lebensformen heranzieht, und untersucht die Frage, welche Wesen von dem Tötungsverbot geschützt werden.
- Unterscheidung des Wertes von Lebewesen nach dem Bewusstseinsgrad
- Das Tötungsverbot in der Perspektive des Utilitarismus
- Kritik an Singers Argumentation
- Der Wert von Selbstbewusstsein für den Lebensschutz
- Die Rolle von Wunsch und Interesse für das Recht auf Leben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Peter Singers Werk „Praktische Ethik“ und dessen Rezeption vor. Sie beleuchtet die Problematik des Tötungsverbots im Kontext moderner Forschungserkenntnisse in Biologie und Medizin. Singers Werk wird als Versuch beschrieben, ethische Lösungen für aktuelle Fragestellungen zu finden, wobei er bewusst provokative Äußerungen zur Erschütterung gängiger Perspektiven nutzt.
Kapitel II analysiert Singers Kriterien zur Unterscheidung des Wertes unterschiedlicher Lebewesen. Er kritisiert die Ansicht, dass das menschliche Leben einen besonderen Wert habe, der sich von anderen Lebewesen unterscheide. Singer argumentiert, dass nicht die Spezieszugehörigkeit, sondern der Grad des Bewusstseins ausschlaggebend für die ethische Bewertung von Leben sei. Er unterscheidet zwischen Lebewesen ohne Bewusstsein, nur bewussten Lebensformen und solchen, die Selbstbewusstsein besitzen. Nur Lebewesen mit Selbstbewusstsein, die Singer als „Personen“ definiert, genießen laut seinem Modell ein uneingeschränktes Recht auf Leben.
Kapitel III beleuchtet die Kritik an Singers Argumentation. Es werden verschiedene Einwände gegen seine Unterscheidung des Wertes von Lebewesen nach dem Bewusstseinsgrad diskutiert. Insbesondere wird Singers Argumentation im Kontext des klassischen und des präferenz-utilitaristischen Modells untersucht.
Das Fazit fasst Singers Überlegungen zu den Grundlagen des Tötungsverbots zusammen und bietet einen verständlichen Überblick über die behandelten Punkte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der praktischen Ethik, insbesondere die Frage nach dem Wert von Lebewesen und den Grundlagen des Tötungsverbots. Schlüsselbegriffe sind Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Person, Spezieszugehörigkeit, Utilitarismus, Präferenz-Utilitarismus, Ethik, Lebensschutz, moralische Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Wer gilt nach Peter Singer als „Person“?
Singer definiert Personen als Lebewesen, die über Selbstbewusstsein, Rationalität und ein Verständnis ihrer eigenen Zukunft verfügen.
Warum ist Singers „Praktische Ethik“ so umstritten?
Seine Thesen zum Wert unterschiedlichen Lebens, insbesondere im Kontext von Abtreibung und Euthanasie, lösten starke Entrüstung und Vorwürfe der Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut aus.
Was kritisiert Singer an der Spezieszugehörigkeit?
Singer lehnt den „Speziesismus“ ab und argumentiert, dass die Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung allein kein ethisches Kriterium für den Lebensschutz sein darf.
Was ist der Präferenz-Utilitarismus?
Dies ist eine Form des Utilitarismus, bei der moralische Handlungen danach bewertet werden, inwieweit sie die Präferenzen (Wünsche und Interessen) aller betroffenen Wesen fördern.
Welche Kriterien bestimmen den Wert eines Lebewesens bei Singer?
Ausschlaggebend sind der Grad des Bewusstseins, die Fähigkeit Schmerz zu empfinden und vor allem das Vorhandensein von Selbstbewusstsein.
- Citation du texte
- Liz Meyers (Auteur), 2021, Peter Singers "Praktische Ethik". Grundlagen des Tötungsverbots im Werk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1291453